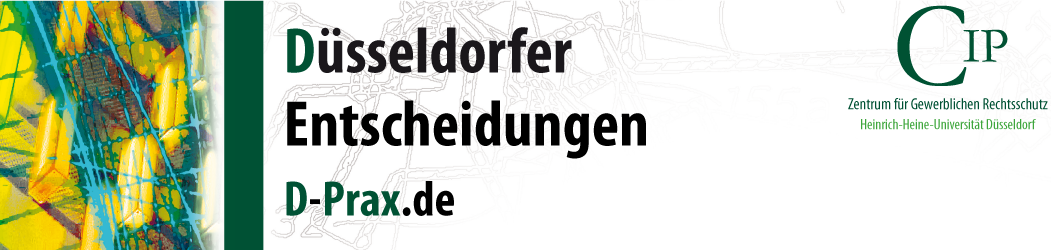Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3348
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 4. Juli 2024, I–2 U 30/20
Vorinstanz: 4a O 21/19
- I. Die Berufung der Beklagten gegen das am 16.06.2020 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass
- 1.
im Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils im zweiten Absatz nach den Worten „an einer Oberfläche“ die Worte „der lichtabgewandten Rückseite“ eingefügt werden, so dass es dort heißt: „… an einer Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrates“; - 2.
im Tenor zu I. 3. des landgerichtlichen Urteils die Datumsangabe „30.01.2019“ durch die Datumsangabe „30.01.2020“ ersetzt wird und es dort nach den Worten „auf den gerichtlich“ statt „(Urteil des … vom…)“ heißt: „(Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16.06.2020)“. - II. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
- III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
- Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,- EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
- IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
- V. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 750.000,- EUR festgesetzt.
- Gründe:
- I.
- Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 2 220 XXA B1 (nachfolgend: Klagepatent), das die Bezeichnung „Verfahren zum Herstellen einer Solarzelle mit einer oberflächenpassivierenden Dielektrikumdoppelschicht und eine entsprechende Solarzelle“ trägt, noch auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung in Anspruch, nachdem sie ihr weitergehendes Begehren auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung bereits erstinstanzlich zurückgenommen hat.
- Als Inhaberhin des deutschen Teils des Klagepatents ist seit dem 30.01.2020 die B im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen. Zuvor war ab dem 30.01.2019 die C als Patentinhaberin im Register eingetragen.
- Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 06.11.2008 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 14.11.2007 eingereicht. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 27.08.2014 im Patentblatt bekannt gemacht. Das Klagepatent steht in Kraft.
- Die erteilten Patentansprüche 9, 12 und 13, die jeweils eine Solarzelle betreffen und die die Klägerin in erster Instanz in Kombination geltend gemacht hat, lauten wie folgt:
- „9.
Solarzelle aufweisend: ein Siliziumsubstrat (1); eine erste Dielektrikumschicht (3), die Aluminiumoxid aufweist, an einer Oberfläche des Siliziumsubstrates (1); gekennzeichnet durch eine zweite Dielektrikumschicht (5) an einer Oberfläche der ersten Dielektrikumschicht (3), wobei sich die Materialien der ersten und der zweiten Dielektrikumschicht unterscheiden und wobei in die zweite Dielektrikumschicht Wasserstoff eingelagert ist.“ - „12.
Solarzelle nach einem der Ansprüche 9 bis 11, wobei die erste Dielektrikumschicht eine Dicke von weniger als 50nm, vorzugsweise weniger als 30nm und stärker bevorzugt weniger als 10nm aufweist.“ - „13.
Solarzelle nach einem der Ansprüche 9 bis 12, wobei die zweite Dielektrikumschicht eine Dicke von mehr als 50nm, vorzugsweise mehr als 100nm und stärker bevorzugt mehr als 150nm aufweist.“ - Auf einen von dritter Seite erhobenen Einspruch, dem u.a. die Beklagte beigetreten ist, hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes das Klagepatent – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – durch Entscheidung vom 29.09.2022 eingeschränkt aufrechterhalten, nämlich ohne die erteilten Verfahrensansprüche mit insgesamt fünf eine Solarzelle betreffenden Sachansprüchen sowie einer entsprechend angepassten Beschreibung. Zuvor war bereits am 06.11.2017 eine (Zwischen-)Entscheidung der Einspruchsabteilung ergangen (vgl. Anlage K 3). Diese entfaltete aufgrund der am 01.08.2017 erfolgten Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der damals eingetragenen Mitinhaberin des Klagepatents, der D GmbH, und der daraufhin ausgesprochenen rückwirkenden Unterbrechung des Einspruchsverfahrens seitens der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamtes jedoch keine Wirkung (vgl. Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vom 13.07.2020, Anlage TW-B 1). Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29.09.2022 haben sowohl die Patentinhaberin als auch die Beklagte Beschwerde eingelegt, über die bislang noch nicht entschieden worden ist.
- Der von der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes durch die Entscheidung vom 29.09.2022 eingeschränkt aufrechterhaltene Patentanspruch 1 lautet wie folgt:
- „Solarzelle aufweisend: ein Siliziumsubstrat; eine erste Dielektrikumschicht, die Aluminiumoxid aufweist, an einer Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrates; eine zweite Dielektrikumschicht an einer Oberfläche der ersten Dielektrikumschicht, wobei sich die Materialien der ersten und der zweiten Dielektrikumschicht unterscheiden und wobei in die zweite Dielektrikumschicht Wasserstoff eingelagert ist, wobei die erste Dielektrikumschicht eine Dicke von weniger als 50 nm aufweist, wobei die zweite Dielektrikumschicht eine Dicke von mehr als 50 nm.“
- Die Klägerin ist eine Tochtergesellschaft der nunmehr als Patentinhaberin im Register eingetragenen E, einem Herstellerunternehmen auf dem Gebiet der Photovoltaiktechnologie.
- Bei der Beklagten handelt es sich um die deutsche Tochtergesellschaft eines Konzerns mit Hauptsitz in Norwegen und einem operativen Sitz in Singapur. Die Muttergesellschaft der Beklagten bietet über ihre deutschsprachigen Internetseiten (vgl. Anlage K 7) Solarzellen, beispielsweise ein Produkt mit der Bezeichnung „F“, an (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen). Unter „Bezugsquelle“ wird auf den erwähnten Internetseiten auch die Möglichkeit angegeben, die Beklagte zu kontaktieren. Diese ist zudem als Ansprechpartnerin u.a. für Europa genannt. Es existieren zwei Varianten der angegriffenen Ausführungsformen, solche mit dem Zelltyp „G“ und solche mit dem Zelltyp „H“. Sie stimmen in ihrem Aufbau insofern überein, als sich auf einem Siliziumsubstrat – auf der lichtabgewandten Rückseite – eine ca. 1-2 nm dicke Siliziumoxidschicht befindet, auf der wiederum eine Aluminiumoxid (Al2O3) enthaltende Dielektrikumschicht angeordnet ist, auf die eine weitere Siliziumnitrid enthaltende Dielektrikumschicht folgt.
- Die Klägerin sieht im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents.
- Sie hat in erster Instanz behauptet, sie sei ausschließliche Lizenznehmerin an dem Gegenstand des Klagepatents und als solche aktivlegitimiert. Die I als Inhaberin des Klagepatents habe ihr (der Klägerin) mit Vertrag vom 22.02.2019 eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent erteilt und außerdem alle Ansprüche abgetreten. Die Klägerin hat vor dem Landgericht ferner geltend gemacht, dass die angegriffenen Ausführungsformen sämtliche Merkmale der erteilten Patentansprüche 9, 12 und 13 verwirklichen. Bei den angegriffenen Ausführungsformen sei insbesondere die erste Dielektrikumschicht „an der Oberfläche des Siliziumsubstrats“ angeordnet. Eine dazwischenliegende Siliziumoxidschicht von 1 bis 2 nm Dicke führe nicht aus der Merkmalsverwirklichung heraus.
- Die Beklagte, die Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das gegen das Klagepatent anhängige Einspruchsverfahren beantragt hat, hat die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten und eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Das Klagepatent verlange, dass die drei Schichten (Siliziumsubstrat und die beiden Dieletrikumschichten) unmittelbar und ohne dazwischen befindliche Zwischenschichten oder sonstigen Unterbrechungen aufeinanderlägen. Der Anspruchswortlaut „an einer Oberfläche“ beschreibe eine unmittelbare Anordnung der einen Schicht „an“ der anderen Schicht. Zwischen dem Siliziumsubstrat und der ersten Dieletrikumschicht dürfe keine Zwischenschicht liegen. Bei den angegriffenen Ausführungsformen befinde sich jedoch eine 1 bis 2 nm dicke Siliziumoxidschicht unmittelbar auf dem Siliziumsubstrat. Jedenfalls sei das Verfahren vor dem Hintergrund des laufenden Einspruchsverfahrens auszusetzen. Denn der geltend gemachte Anspruch sei nicht ausführbar und ihm mangele es sowohl an der Neuheit als auch an der erfinderischen Tätigkeit.
- Mit Urteil vom 16.06.2020 hat das Landgericht Düsseldorf eine Verletzung des Klagepatents bejaht und – auf der Grundlage der damals noch geltenden erteilten Anspruchsfassung und gemäß der von der Klägerin verfolgten Kombination der Ansprüche 9, 12 und 13 – wie folgt erkannt:
- „I. Die Beklagte wird verurteilt,
- 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
- Solarzellen aufweisend ein Siliziumsubstrat und eine erste Dielektrikumschicht, die Aluminiumoxid aufweist, an einer Oberfläche des Siliziumsubstrates,
- in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen
oder zu besitzen, - wenn die Solarzellen eine zweite Dielektrikumschicht an einer Oberfläche der ersten Dielektrikumschicht aufweisen, wobei sich die Materialien der ersten und der zweiten Dielektrikumschicht unterscheiden und wobei in die zweite Dielektrikumschicht Wasserstoff eingelagert ist, wobei die erste Dielektrikumschicht eine Dicke von weniger als 50 nm aufweist, wobei die zweite Dielektrikumschicht eine Dicke von mehr als 50 nm aufweist;
- 2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter I.1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben oder – nach Wahl der Beklagten – diese selbst zu vernichten;
- 3. die unter I.1. bezeichneten, seit dem 30.01.2019 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.“
- Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
- Die Klägerin sei für die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche aufgrund eines wirksam geschlossenen ausschließlichen Lizenzvertrages mit der I aktivlegitimiert. Dass die E am 30.01.2020 als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragen worden sei, stehe dem nicht entgegen. Nach § 15 Abs. 3 PatG berühre der Rechtsübergang nicht Lizenzen am Klagepatent, die Dritten vorher erteilt worden seien. Die Norm führe nicht dazu, dass ein Lizenznehmer lediglich dem neuen Patentinhaber ein Nutzungsrecht entgegenhalten könne. Vielmehr bleibe auch die Ausschließlichkeit bestehen. Denn in dieser Exklusivität sei dem Lizenznehmer die Lizenz erteilt worden. Der Umfang der Lizenz, die der Lizenznehmer gegen den Rechtsnachfolger des Lizenzgebers habe, bestimme sich danach, was für die Fortsetzung der Nutzung der Erfindung erforderlich sei und welche Ansprüche wegen der Sukzession vom Lizenzvertragspartner nicht mehr erfüllt werden könnten. Die Ausschließlichkeit der Lizenz könne vom neuen Patentinhaber weiter aufrechterhalten werden, indem keine weiteren Lizenzen vergeben würden. Die Rechtsstellung als ausschließlicher Lizenznehmer könne dieser in Form der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auch nach der Übertragung des Klagepatents weiter durchsetzen.
- Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung zu. Die angegriffenen Ausführungsformen machten wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Insbesondere verfügten sie über eine erste, Aluminiumoxid aufweisende Schicht an der Oberfläche des Siliziumsubstrats.
- Die bei den angegriffenen Ausführungsformen zwischen dem Siliziumsubstrat und der ersten Dielektrikumschicht zu findende Siliziumoxidschicht führe nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Der Fachmann wisse, dass eine solche Zwischenschicht bei der Verwendung des vom Klagepatent als bevorzugt beschriebenen ALD-Verfahrens zum Abscheiden der ersten Dielektrikumschicht regelmäßig entstehe. Gleichwohl lehre ihn das Klagepatent nicht, eine solche Schicht zu vermeiden, sondern nehme deren Entstehung billigend in Kauf. Es bestünden keine funktionalen Gründe dafür, „an der Oberfläche“ auf einen unmittelbaren Kontakt zu beschränken und deshalb die Ausführungsbeispiele als nicht patentgemäß anzusehen. Die Aluminiumoxid aufweisende Dielektrikumschicht solle die Oberfläche des Siliziumsubstrats passivieren und auf diese Weise Rekombinationen verhindern. Hierbei wirke die dielektrische Schicht über ein elektrisches Feld passivierend. Dies setze zwar eine räumliche Nähe zur Substratoberfläche voraus, da das Feld nicht unbegrenzt wirke, so dass die erste Dielektrikumschicht in Bezug auf die Substratoberfläche nicht beliebig angeordnet werden könne. Ein unmittelbares Anliegen sei aus funktionalen Gründen gleichwohl nicht erforderlich. Entsprechendes gelte für die Passivierung durch die zweite Dielektrikumschicht. Auch insoweit werde die patentgemäße Funktion durch eine dünne Siliziumoxid-Zwischenschicht nicht beeinträchtigt. Die patentgemäß vorgesehene Wanderung der Wasserstoffatome zur Substratoberfläche werde durch eine Siliziumoxid-Zwischenschicht von 1 bis 2 nm Dicke nicht relevant beeinflusst.
- Die erfindungsgemäße Solarzelle sei nicht auf die Herstellung der ersten Dielektrikumschicht im ALD-Verfahren beschränkt. Anforderungen an das bei der Herstellung der ersten Dielektrikumschicht eingesetzte Verfahren fänden sich ausschließlich im Verfahrensanspruch 1 sowie in Unteranspruch 10.
- Schließlich sei die Freiheit der Schichten von „Pinholes“ nicht Teil der geltend gemachten Anspruchskombination. Im Anspruchswortlaut finde sich kein Anhaltspunkt, der darauf hindeute, dass nur Solarzellen mit Schichten ohne „Pinholes“ beansprucht seien. Die Freiheit der Schichten von „Pinholes“ werde zwar in der Klagepatentbeschreibung als einer der Vorteile der Erfindung genannt. Dies gelte jedoch nicht zwingend für die Lehre der streitgegenständlichen Anspruchskombination.
- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Klageabweisung weiterverfolgt. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie u.a. geltend:
- Die Klägerin habe ihre behauptete Stellung als ausschließliche Lizenznehmerin nicht nachgewiesen. Unstreitig seien hierbei auf Seiten der vermeintlichen Patentinhaberin diverse Satzungsverstöße begangen worden, die zur Unwirksamkeit der Bestellung der angeblich vertretungsberechtigten Vorstände geführt hätten. Diese seien somit nicht für die Patentinhaberin vertretungsberechtigt gewesen und hätten daher auch nicht zu Gunsten der Klägerin eine wirksame Lizenz erteilen können.
- Soweit das Landgericht davon ausgehe, dass die angegriffenen Solarzellen eine erste, aluminiumoxidhaltige Dielektrikumschicht an einer Oberfläche des Siliziumsubstrats aufwiesen, sei diese Feststellung rechtsfehlerhaft und beruhe diese auf Verstößen gegen die generell geltenden Auslegungsgrundsätze und -vorgaben.
- Entgegen der Auffassung des Landgerichts sehe das Klagepatent das „plasma assisted ALD-Verfahren“ nicht als standardmäßiges ALD-Verfahren an. Das Klagepatent unterscheide nicht zwischen den verschiedenen Varianten des ALD-Verfahrens. Des Weiteren entstehe bei einem solchen ALD-Verfahren weder „regelmäßig“ noch „naturgemäß“ an der Oberfläche des Siliziumsubstrats eine Siliziumoxidschicht. Eine solche Schicht könne vielmehr nach Abs. [0023] der Klagepatentbeschreibung auch beim plasma assisted ALD-Verfahren verhindert werden. Mit der Forderung nach einer Anordnung der ersten Dielektrikumschicht an der Oberfläche des Substrats sei klar, dass zwischen dem Substrat und der ersten Dielektrikumschicht keine weitere Schicht angeordnet sein dürfe, insbesondere keine Siliziumoxidschicht. Dies stehe im Einklang mit der Beschreibung des Klagepatents, die bewusst zwischen „Grenzflächen“ und „Schichten“ unterscheide und von einer Grenzfläche spreche, wenn es um das unmittelbare Aneinanderliegen der jeweils benachbarten Oberflächen der Schichten gehe. Die (geänderte) Beschreibung stelle in den Abs. [0011] und [0012] zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Solarzelle klar, dass eine Schicht auf die Oberfläche der jeweils vorhergehenden Schicht abgeschieden werde; Zwischenschichten seien dabei nicht vorgesehen. Die Auffassung, dass das Merkmal „an einer Oberfläche“ ein „direktes“ Aufbringen erfordere, habe die Klägerin im Übrigen selbst noch im Einspruchsverfahren vertreten. Auch der Federal Court of Australia sei in einem Verletzungsverfahren betreffend ein paralleles Patent aus der Familie des Klagepatents von einer Nichtverletzung wegen des Vorhandenseins einer Siliziumoxidschicht ausgegangen.
- Eine Zwischenschicht von 1 bis 2 nm falle entgegen der Auffassung des Landgerichts auch funktional ins Gewicht. Für den Fachmann sei klar, dass die erste Dielektrikumschicht möglichst dünn ausgestaltet sein müsse, damit die Wasserstoffatome aus der zweiten Dielektrikumschicht zum Siliziumsubstrat eine möglichst kurze und widerstandsarme Strecke zurücklegen könnten. Jede zusätzliche Zwischenschicht wirke dieser Funktion entgegen, vor allem, wenn sie auch noch aus einem anderen Material bestehe. Auch für die mit der aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht angestrebte Feldpassivierung sei ein unmittelbares Anliegen der ersten Dielektrikumschicht auf dem Siliziumsubstrat zwingend erforderlich. Denn die Feldstärke nehme exponentiell mit dem Abstand ab. Bei einem derart exponentiellen Zusammenhang zwischen der Feldstärke und dem Abstand zwischen Substrat und Aluminiumoxidschicht liege es für den fachkundigen Leser der Klagepatentschrift auf der Hand, dass die Aluminiumoxidschicht so nah wie möglich an der Substratoberfläche liegen müsse. Jede andere Implementierung führe zu einer exponentiellen negativen Beeinträchtigung der von der Erfindung beabsichtigten Funktion und damit zu einem Verlassen der patentgemäßen Lehre. Damit einhergehend spreche die Klagepatentschrift daher auch explizit von einer „Si/Al2O3-Grenzfläche“ und nicht etwas von einer Si/SiOx- oder einer SiOx/Al2O3-Grenzfläche.
- Dass das Landgericht zur Begründung seines abweichenden Verständnisses auf in der Klagepatentbeschreibung nicht als Stand der Technik gewürdigte Sekundärliteratur in Gestalt der Veröffentlichungen von J et al. und K et. al. (2006) [nachfolgend auch: K 2006] zurückgreife, sei bereits für sich genommen rechtsfehlerhaft. Solche Sekundärliteratur gehöre nicht zur Offenbarung des Klagepatents und sei daher nicht als Auslegungsmaterial zugänglich. Auf die in Abs. [0009] erwähnte Schrift von K et al. (2007) [nachfolgend auch: K 2007] werde nur im Hinblick auf eine bestimmte Materialauswahl für die Dielektrikumschicht zur Oberflächenpassivierung und gerade nicht hinsichtlich der konkreten Anordnung der Schichten verwiesen. Der Schrift selbst entnehme der Fachmann mit keinem Wort, dass bei der plasmaunterstützten Atomlagenabscheidung zwangsweise oder überhaupt eine Siliziumdioxidschicht zwischen dem Siliziumsubstrat und der Aluminiumoxidschicht entstehe. Nichts anderes gelte für die in Abs. [0043] genannte Schrift von L et al., die vom Klagepatent nur im Rahmen der Ausführungsbeispiele für das Verfahren der thermischen ALD-Abscheidung der Al2O3-Dünnschicht zitiert werde. Auch diese Schrift befasse sich mit dem Ersatz von Siliziumdioxid als dielektrische Schicht durch andere Dielektrika, wie zum Beispiel Aluminiumoxid und offenbare sogar ausdrücklich einen Weg, wie der Fachmann auf die aus seiner Sicht kritische Zwischenschicht verzichten könne. Der Fachmann erkenne, dass nur derjenige Herstellungsprozess unter Schutz gestellt werde, bei der eine solche Zwischenschicht nicht entstehe, denn nur dann liege die erste Dielektrikumschicht an der Oberfläche des Substrats an.
- Überdies verstoße die Auslegung des Landgerichts gegen den allgemeinen Grundsatz der Rechtssicherheit. Für den Fachmann sei nicht nachvollziehbar, wie dick eine (vermeintlich) zulässige Zwischenschicht sein dürfe. Diese müsste im Übrigen dann konsequenterweise auch als erste Dielektrikumschicht angesehen werden, die dann aber entgegen der Lehre des Klagepatents kein Aluminiumoxid aufweise.
- Schließlich grenze sich das Klagepatent gegenüber den im Stand der Technik als nachteilig empfundenen „Pinholes“ ab, so dass bei richtiger Auslegung nur solche Schichten von der Lehre des Klagepatents umfasst sein dürften, die vollständig frei von solchen „Pinholes“ seien.
- Ausgehend von einem zutreffenden Verständnis machten die angegriffenen Ausführungsformen, die unstreitig zwischen Siliziumsubstrat und erster Dielektrikumschicht eine 1 bis 2 nm dicke Siliziumdioxidschicht aufwiesen und auch nicht frei von „Pinholes“ seien, von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.
- Im Übrigen werde sich das Klagepatent im Rechtsbestandsverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen. So beruhe der geltend gemachte Anspruch insbesondere angesichts der im Einspruchsverfahren entgegengehaltenen JP2007/234XXBA (PS92; Anlage TW-B 7/7a) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
- Die Beklagte beantragt,
- das Urteil des Landgerichts Düsseldorf „aufzuheben“ und die Klage abzuweisen;
- hilfsweise, das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Europäischen Patentamts über den Rechtsbestand des Klagepatents auszusetzen.
- Die Klägerin beantragt,
- die Berufung mit den Maßgaben zurückzuweisen, dass der Urteilstenor die Fassung des durch die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts aufrechterhaltenden Patentanspruchs 1 erhält, im Tenor zu I. 3. des landgerichtlichen Urteils (Rückruf) die Datumsangabe „30.01.2019“ durch die Datumsangabe „30.01.2020“ ersetzt wird und es dort nach den Worten „auf den gerichtlich“ statt „(Urteil des … vom…)“ heißen soll: „(Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 16.06.2020)“.
- Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Einzelnen entgegen, wobei sie u.a. geltend macht:
- Sie sei aktivlegitimiert. Unabhängig von der durch die Beklagte in der Berufungsbegründung geäußerten Kritik an den diesbezüglichen Feststellungen im landgerichtlichen Urteil ergebe sich ihre Aktivlegitimation in der Berufungsinstanz nunmehr aus dem Gesichtspunkt der gewillkürten Prozessstandschaft. Wie aus der als Anlage K 23 zur Akte gereichten Lizenzvereinbarung ersichtlich, habe die B ihr, der Klägerin, inzwischen eine einfache Lizenz am Klagepatent erteilt und sie zugleich ausdrücklich ermächtigt, gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung im eigenen Namen geltend zu machen. An der Durchsetzung der Ansprüche habe sie auch ein eigenes Interesse, da sie für den Vertrieb der von der B produzierten Solarprodukte in Deutschland zuständig sei.
- Des Weiteren sei das Landgericht zutreffend zu dem Schluss gelangt, dass gerade der im Klagepatent selbst zitierte Stand der Technik L et al. belege, dass dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt das Entstehen einer dünnen Siliziumoxid-Zwischenschicht beim Abscheiden einer anspruchsgemäßen, Aluminiumoxid enthaltenden ersten Dielektrikumschicht in dem in der Klagepatentbeschreibung als besonders vorteilhaft beschriebenen ALD-Verfahren bekannt gewesen sei. Diese werde auch durch die – in K 2007 zitierten – Veröffentlichungen von K et al. (2006) und J et al. bestätigt. Hieraus habe das Landgericht den zutreffenden Schluss gezogen, dass es erfindungsgemäß nicht zwingend eines unmittelbaren Kontakts zwischen dem Substrat und der ersten Dielektrikumschicht bedürfe. Die gesamte Argumentation der Beklagten kreise um den Hinweis, dass das Klagepatent auch Möglichkeiten und Verfahren zur Vermeidung einer solchen Zwischenschicht offenbare. Dabei verkenne die Beklagte, dass das Landgericht dieser Erkenntnis im erstinstanzlichen Urteil nicht widersprochen, sondern zu Recht darauf abgestellt habe, dass das Klagepatent auf solche Verfahren eben nicht beschränkt sei. Soweit die Beklagte behaupte, sie, die Klägerin, habe im Einspruchsverfahren noch selbst behauptet, dass das Merkmal „an einer Oberfläche“ ein „direktes“ Aufbringen erfordere, so stamme der entsprechende Schriftsatz nicht von ihr, sondern von der damaligen Patentinhaberin, der V; die Verwendung des Begriffs „direkt“ betreffe auch nicht die dünne Zwischenoxidschicht, sondern beziehe sich auf die Position der „dicken“ Schichten innerhalb eines Schichtstapels
- Die von der Beklagten erwähnte Entscheidung des Federal Court of Australia könne schon deshalb nicht auf das hiesige Verfahren übertragen werden, da die zu beurteilenden Ansprüche und die Patentbeschreibungen Unterschiede aufwiesen; so werde im australischen Patent beispielsweise das Dokument K 2007 nicht als Stand der Technik gewürdigt.
- In Bezug auf die seitens der Beklagten aufgestellte Behauptung, jede zusätzliche Zwischenschicht wirke der Funktion der beanspruchten Dielektrikumschichten entgegen, habe diese bereits nicht dargelegt, dass die hier in Rede stehende Siliziumoxid-Zwischenschicht mit einer Dicke von 1 bis 2 nm die im Klagepatent beschriebenen Vorteile der Wasserstoffdiffusion verhindere. Dies sei im relevanten Dickenbereich auch nicht der Fall, weil Wasserstoff durch eine so dünne Schicht ohne Weiteres diffundieren könne. Jedenfalls sei es aber gerade der Kern der Erfindung, die beiden patentgemäßen Dielektrikumschichten zu kombinieren. Weil das Klagepatent Verfahren zur Abscheidung der gewollten aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht nicht ausschließe, bei denen Siliziumoxid-Zwischenschichten von 1 bis 2 nm Dicke entstünden, nehme es auch in Kauf, dass hierdurch gegebenenfalls der „Diffusionsweg“ von Wasserstoffatomen marginal größer werden könne. Das Klagepatent lehre sogar eine bis zu 50 nm dicke erste Dielektrikumschicht, die aus Sicht des Klagepatents einer Diffusion von Wasserstoff aus der zweiten Dielektrikumschicht durch diese erste Dielektrikumschicht hindurch gerade nicht im Weg stehe. Dass es zur Erreichung des mit der ersten Dielektrikumschicht angestrebten Feldeffektes zwingend eines unmittelbaren Anliegens der ersten Dielektrikumschicht auf dem Siliziumsubstrat bedürfe, treffe nicht zu und sei durch nichts belegt. Insbesondere nehme die Stärke des elektrischen Feldes nicht – wie von der Beklagten behauptet – exponentiell mit dem Abstand ab. Das von der Beklagten bemühte Abstandsgesetz sei eine Theorie, die allein für Punktladungen gelte, und die im hier maßgeblichen Bereich zweidimensionaler Schichten („Flächenladungen“) von vornherein nicht anwendbar sei.
- Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Prozessführungsbefugnis bzw. Aktivlegitimation wie folgt entgegengetreten:
- Soweit sich die Klägerin nunmehr zur Begründung der Aktivlegitimation auf eine einfache Lizenz mit Prozessstandschaftserklärung berufe, fehle es bereits an dem erforderlichen Eigeninteresse der Klägerin. Hierfür bedürfe es eines eigenen Interesses des Prozessstandschafters an der Durchsetzung des für ihn fremden (Unterlassungs-)Anspruchs, das über das bloße wirtschaftliche Interesse hinausgehe. Der Prozessstandschafter benötige eine konkrete Einschränkung hinsichtlich der eigenen Interessen am betroffenen Schutzrecht. Mit Blick auf die Klägerin als einfache Lizenznehmerin sei dies nicht der Fall, denn sie trage nicht einmal vor, dass die vermeintlichen Verletzungshandlungen der Beklagten auch den Umsatz mit eigenen, erforderlichenfalls erfindungsgemäßen Erzeugnissen schmälerten und die Unterbindung der angeblichen Verletzung deshalb ganz konkret auch im geschäftlichen Interesse der Lizenznehmerin liege. Die pauschale und von ihr, der Beklagten, bestrittene Behauptung, die Klägerin nehme selbst am Markt teil, sei hierfür nicht ausreichend.
- Überdies fehle es auch an einer wirksamen Erteilung der einfachen Lizenz. Es sei mit Nichtwissen zu bestreiten, dass die Unterzeichner der betreffenden Lizenzvereinbarung im Zeitpunkt der Unterzeichnung vertretungsbevollmächtigt gewesen seien. Die als Anlage K 23 vorgelegte Vereinbarung sei eine bloße Privaturkunde und beweise nicht den Abschluss des einfachen Lizenzvertrags. Es fehle an einer öffentlichen Urkunde, die dessen Wirksamkeit und/oder der dazugehörigen Erklärungen bestätigten. Die notariellen Beurkundungen Anlagen K 33a/34a belegten nicht die inhaltliche Richtigkeit der beurkundeten Erklärungen. Die notarielle Urkunde gemäß Anlage K 33a könne diese Bestätigung ohnehin schon deshalb nicht erbringen, da diese nicht die Erklärung des (angeblich) unterzeichnenden Herrn M beurkunde, sondern diejenige einer angeblich bevollmächtigten Person N, bei der bereits unklar sei, warum diese etwas zu der Unterzeichnung bekunden könne. Soweit die Klägerin die (angebliche) Kopie eines Personalausweises des Herrn M zur Akte gereicht habe, so versäume sie es, diesen als Original vorzulegen. Ungeachtet dessen sei die dortige Unterschrift aber auch nicht identisch mit derjenigen unter der Anlage K 23.
- Höchst vorsorglich werde auch der wirksame (materiell-rechtliche) Übergang des Klagepatents und der Nebenansprüche von der ursprünglichen (angeblichen) Inhaberin C auf die angebliche Lizenzgeberin, die E, mit Nichtwissen, und zwar hinsichtlich aller der in der Präambel der Vereinbarung genannten Vorgänge, bestritten. Jedenfalls sei der klägerische Vortrag zur angeblichen „Umwandlung“ der ausschließlichen in eine einfache Lizenz präkludiert.
- Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
- Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 20.04.2023 (Bl. 726 f. GA) Beweis darüber erhoben, ob der Lizenzvertrag zwischen der E und der Klägerin für letztere seitens Herrn O unterzeichnet worden ist; wegen des Ergebnisses der Zeugenvernehmung wird auf das Sitzungsprotokoll vom 25.05.2023 verwiesen (Bl. 821 ff. GA). Außerdem hat der Senat gemäß Beweisbeschluss vom 20.04.2023 (Bl. 731 ff. GA) die Einholung eines schriftlichen Gutachtens eines Sachverständigen und gemäß Beschluss vom 08.05.2024 (Bl. 1077 GA) dessen Anhörung in der mündlichen Verhandlung vom 06.06.2024 angeordnet. Wegen des Ergebnisses wird auf das von Prof. Dr. P, Universität Q, erstattete schriftliche Gutachten vom 18.12.2023 (Bl. 953 ff. GA) sowie das Sitzungsprotokoll vom 06.06.2024 verwiesen.
- II.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. - Zu Recht hat das Landgericht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte wegen unmittelbarer Patentverletzung zur Unterlassung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung verurteilt. Der Klägerin stehen entsprechende Ansprüche aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 und 3 PatG zu. Denn die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents auch in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes vom 29.09.2022 Gebrauch. Der Urteilsausspruch (Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils) ist – entsprechend dem zweitinstanzlichen Antrag der Klägerin – lediglich an diese nach dem Teilwiderruf geltende Fassung von Patentanspruch 1 anzupassen gewesen. Außerdem hat der Senat den Tenor zu I. 3. des landgerichtlichen Urteils dahin konkretisiert, dass er in dem dortigen Klammerzusatz das Urteil des Landgerichts (vollständig) angegeben hat. Schließlich ist der titulierte Rückrufanspruch – entsprechend der von der Klägerin in der Berufungsinstanz erklärten Teilklagerücknahme – auf ab dem 30.01.2020 in Verkehr gebrachte Erzeugnisse zu beschränken gewesen.
- A.
Die Klägerin ist zur Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche berechtigt. - 1.
Soweit sie sich zur Begründung ihrer Aktivlegitimation im Berufungsverfahren nicht mehr auf ihre vermeintliche Stellung als ausschließliche Lizenznehmerin, sondern auf eine einfache Lizenz in Verbindung mit einer gewillkürten Prozessstandschaft beruft, ist hierin eine zulässige Klageänderung zu sehen, die in der Berufungsinstanz zuzulassen ist. - a)
Während der ausschließliche Lizenznehmer – wie der Patentinhaber – aus einem originären Recht klagen kann und damit ein eigenes Recht im eigenen Namen geltend macht, kann sich die Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers in Bezug auf Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf nur nach den Grundsätzen der gewillkürten Prozessstandschaft ergeben (Senat, Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15, BeckRS 2015, 18754 Rn. 4 u. 20; OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.2020 – 15 U 77/14, GRUR-RS 2020, 43243 Rn. 92 – Digitales Buch, Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 15 Rn. 310; BeckOK PatR/Fricke, 31. Ed. 15.1.2024, PatG § 140a Rn. 9; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. D Rn. 339 u. 360). Eine solche zeichnet sich dadurch aus, dass der Kläger keinen eigenen Anspruch geltend macht, sondern im eigenen Namen fremde Rechte, nämlich diejenigen des Patentinhabers und Lizenzgebers (Senat, Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/17, BeckRS 2015, 18754 Rn. 20; Urt. v. 18.12.2014 – I-2 U 19/14, BeckRS 2015, 03253 Rn. 24). Bei einem derartigen Wechsel von einer Klage aus eigenem Recht zu einer solchen in Prozessstandschaft handelt es sich somit um eine Klageänderung, die nur unter den in § 533 Nr. 1 und 2 ZPO normierten Voraussetzungen zulässig ist (vgl. BGH, Beschl. v. 26.01.2017 – XI ZR 279/14, BeckRS 2017, 101938). Denn bei einem Anspruch aus eigenem und einem Anspruch aus fremdem Recht handelt es sich auch bei einheitlichem Klageziel um unterschiedliche Streitgegenstände (BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 27 – World of Warcraft II, m.w.N.).b)
Die Voraussetzungen einer Klageänderung liegen hier vor. Insbesondere ist diese sachdienlich, so dass es auf eine Einwilligung der Beklagten nicht ankommt. - aa)
Die Sachdienlichkeit richtet sich auch in der Berufungsinstanz im Grundsatz nach den zu § 263 ZPO geltenden Regeln. Sie hängt mithin davon ab, ob eine Entscheidung auch über die geänderte Klage im selben Verfahren objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise ausräumt und einem anderenfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, NJW 2000, 800, 803 m.w.N.; Senat, InstGE 10, 248 – Occluder; Urt. v. 22.02.2018 – I-2 U 21/17, BeckRS 2018, 9342 – Montage von Dämmplatten; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 14/21, GRUR-RS 2021, 30146 Rn. 19 – Klageerweiterung; GRUR 2022, 1510 Rn. 57 – Abdeckungsentfernungsvorrichtung). Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium für die Sachdienlichkeit einer Klageänderung sein, denn dann müsste die Änderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kläger mit seiner Erweiterung schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er im Fall der Nichtzulassung der Klageänderung im anhängigen Prozess ein weiteres Verfahren einleiten wird. Als weitere, wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit muss daher der bisherige Prozessstoff für die Beurteilung der Erfolgsaussichten der nunmehr zur Entscheidung des Gerichts gestellten Anträge Verwendung finden können (OLG Düsseldorf, InstGE 10, 248 – Occluder, m.w.N.; InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissioniersystem). - Das ist vorliegend der Fall. Der Wechsel auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus fremdem Recht im eigenen Namen hat weder auf die den Kern der Auseinandersetzung bildende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents noch auf die Beurteilung der Verletzungsfrage Einfluss. Sämtliche im Zusammenhang mit der Schutzbereichsbestimmung und Verletzungsprüfung aufgeworfenen Fragen haben nach wie vor Bestand. Es erscheint daher zweckmäßig und geboten, auch die nunmehr streitgegenständlichen Ansprüche im vorliegenden Verfahren zu behandeln.
- bb)
Der Zulässigkeit der Klageänderung steht auch § 533 Nr. 2 ZPO nicht entgegen, der voraussetzt, dass die Klageänderung auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. § 533 knüpft die Zulassung einer Klageänderung in zweiter Instanz insoweit zusätzlich an die Voraussetzung, dass die Tatsachengrundlage nach § 529 ZPO zulässig in den Prozess eingeführt werden kann (Zöller/Heßler, ZPO, 35. Aufl. 2024, § 533 Rn. 35). Dies ist hier der Fall. Die Klägerin beruft sich in der Berufungsinstanz auf eine als Anlage K 23 vorgelegte (einfache) Lizenzvereinbarung mit der seit dem 30.01.2022 im Register als Patentinhaberin eingetragenen E. Bei der Vorlage dieser Vereinbarung handelt es sich zwar um neues tatsächliches Vorbringen. An dessen Berücksichtigungsfähigkeit kann vor dem Hintergrund, dass die Vereinbarung auf den 14.12./17.12.2020 und damit nach dem Zeitpunkt der Verkündung des landgerichtlichen Urteils datiert, jedoch kein Zweifel bestehen, da der Klägerin eine frühzeitigere Vorlage nicht möglich war und ihr deshalb nicht der Vorwurf einer Nachlässigkeit gemacht werden kann (§§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO). Mit der von ihr in zweiter Instanz vorgelegten (einfachen) Lizenzvereinbarung und ihrem diesbezüglichen Vortrag kann die Klägerin daher im Berufungsrechtszug gehört werden. - 2.
Die Klägerin ist prozessführungsbefugt. Sie kann die allein zur Entscheidung des Senats gestellten Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf als einfache Lizenznehmerin im eigenen Namen geltend machen. Die dafür notwendigen Voraussetzungen der gewillkürten Prozessstandschaft liegen vor. - a)
Hierfür bedarf es einer wirksamen Ermächtigung des Prozessstandschafters zur gerichtlichen Verfolgung der Ansprüche des Rechtsinhabers sowie eines eigenen (schutzwürdigen) Interesses an der Durchsetzung des für ihn fremden Unterlassungs , Rückruf- und Vernichtungsanspruchs (vgl. BGH, GRUR 2016, 1048 Rn. 21 – An Evening with Marlene Dietrich; GRUR 2017, 397 Rn. 30 – World of Warcraft II, jeweils m.w.N.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2014 – I-2 U 19/14, BeckRS 2015, 3253 Rn. 25, Urt. v. 12.11.2020 – I-15 U 77/14, GRUR-RS 2020, 43243 Rn. 93 – Digitales Buch; Zöller/Althammer, ZPO, 35. Aufl. 2024, Vorbem. zu §§ 50-58 Rn. 40). Hinsichtlich eines einfachen Lizenznehmers ist letzteres regelmäßig zu bejahen, wenn die geltend gemachten Verletzungshandlungen auch seinen Umsatz mit den erfindungsgemäßen Erzeugnissen schmälern und deren Unterbindung deshalb auch im geschäftlichen Interesse des Lizenznehmers liegt. Bedingung ist diesbezüglich allerdings, dass der Lizenznehmer in irgendeinem Umfang tatsächlich am Markt teilnimmt oder zumindest eine alsbaldige Marktpräsenz zumindest bevorsteht, weil nur dann die mutmaßlichen Verletzungsprodukte eine Vermögenseinbuße auf Seiten des Lizenznehmers bewirken. Vor diesem Hintergrund obliegt dem Lizenznehmer die schlüssige Behauptung einer schon gegenwärtigen oder zumindest in naher Zukunft absehbaren Marktteilnahme. Verneinendenfalls kann sich das Eigeninteresse alternativ aus einer vom Lizenznehmer dem Lizenzgeber gegenüber eingegangenen Verpflichtung zur Rechtsverfolgung ergeben (OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.2020 – I-15 U 77/14, GRUR-RS 2020, 43243 Rn. 93 – Digitales Buch).b)
Beides – Prozessführungsermächtigung und schutzwürdiges Eigeninteresse – ist hier gegeben. - aa)
Eine wirksame Ermächtigung der Klägerin zur gerichtlichen Verfolgung der hier verfolgten Ansprüche der als Patentinhaberin eingetragenen E liegt vor. - (1)
Die als Anlage K 23 vorgelegte (einfache) Lizenzvereinbarung vom 14.12./17.12.2020, auf die sich die Klägerin zum Beleg ihrer Prozessführungsermächtigung in der Berufungsinstanz beruft und die sie auch im Original zur Akte gereicht hat (vgl. Sitzungsprotokoll vom 30.03.2023, Bl. 638 ff. GA), ist aus den bereits ausgeführten Gründen als neues Angriffsmittel zu berücksichtigen (§§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ZPO). - (2)
Ausweislich dieser Vereinbarung hat die seit dem 30.01.2020 im Patentregister als Patentinhaberin eingetragene E der Klägerin – unter gleichzeitiger Ersetzung der zuvor erteilten ausschließlichen Lizenz – eine einfache Lizenz am Klagepatent (§ 1 der Vereinbarung) erteilt und die Klägerin ausdrücklich zur Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gegen die Beklagte in dem hiesigen Rechtsstreit (§ 3.2 der Vereinbarung) ermächtigt. - (3)
Es steht zur Überzeugung des Senats unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der mündlichen Verhandlungen und des Ergebnisses der in zweiter Instanz durchgeführten Beweisaufnahme fest, dass die Lizenzvereinbarung gemäß Anlage K 23 durch die Abgabe entsprechender Willenserklärungen von Herrn M für die E als Lizenzgeberin und Herrn O für die Klägerin als (einfache) Lizenznehmerin wirksam zustande gekommen ist. - (3.1)
Im Hinblick auf die von der Klägerin behauptete Unterzeichnung der Lizenzvereinbarung durch Herrn O hat der Senat diesen als Zeugen gemäß Beweisbeschluss vom 20.04.2023 (Bl. 726 f. GA) in der Sitzung am 25.05.2023 durch den (damaligen) Vorsitzenden als beauftragten Richter (§ 375 ZPO) vernommen. Auf der Grundlage der protokollierten Aussage des Zeugen O (Bl. 821 ff. GA), an deren Wahrheitsgehalt auch die Beklagte keine Zweifel geäußert hat, hat der Senat keinen Zweifel daran, dass der Zeuge O die in Rede stehende Lizenzvereinbarung gemäß Anlage K 23 eigenhändig unterzeichnet hat, wie dies auch aus der von der Klägerin als Anlage K 31a/b eingereichten und von ihr auch im Original vorgelegten (vgl. Sitzungsprotokoll vom 30.03.2023, Bl. 638 ff. GA) schriftlichen Erklärung des Zeugen hervorgeht. - (3.2)
In Bezug auf Herrn M, der die in Rede stehende Vereinbarung nach dem Vortrag der Klägerin für die E unterzeichnet haben soll, hat die Klägerin mit der Anlage K 33a/b, die sie auch im Original zur Akte gereicht hat (vgl. Sitzungsprotokoll vom 30.03.2023, Bl. 638 ff. GA), die Apostille einer in Südkorea notariell errichteten Urkunde vorgelegt. Diese betrifft eine schriftliche Erklärung von Herrn M, aus der hervorgeht, dass er die Lizenzvereinbarung eigenhändig unterzeichnet hat. Hinsichtlich dieser schriftlichen Erklärung wird von einer Frau N als Bevollmächtigte von Herrn M bestätigt, dass die betreffende Erklärung von Herrn M stammt. Ausweislich des von der Klägerin als Anlage K 42a/b vorgelegten südkoreanischen Notargesetzes übt ein Notar auch nach südkoreanischem Recht ein öffentliches Amt aus (vgl. Artikel 2). Deshalb ist die von ihm errichtete Urkunde – wie bei einem deutschen Notar – als öffentliche Urkunde gemäß § 415 ZPO einzustufen und erbringt gemäß § 415 Abs. 1 ZPO vollen Beweis über den beurkundeten Vorgang, also darüber, dass die Erklärung samt dem niedergelegten Inhalt und den Begleitumständen (Zeit, Ort, Behörde, Urkundsperson) zutreffend und vollständig so, wie beurkundet und nicht anders, abgegeben wurde (vgl. Musielak/Voit/Huber/Röß, 21. Aufl. 2024, ZPO § 415 Rn. 10). Denn die Bestimmung des § 415 Abs. 1 ZPO gilt, wie sich aus § 438 ZPO ergibt, auch für ausländische öffentliche Urkunden (BGH, NJW-RR 2007, 1006). Damit ist zwar nicht die inhaltliche Richtigkeit der beurkundeten Erklärung von Frau N bewiesen, dass die beigefügte schriftliche Erklärung, auf die sich seine Erklärung bezieht, tatsächlich von Herrn M stammt. Ebenso wenig ist hiermit die inhaltliche Richtigkeit der in Bezug genommenen schriftlichen, nach den Angaben der Frau N von Herrn M stammenden Erklärung, wonach dieser die Vereinbarung gemäß Anlage K 23 unterzeichnet hat, belegt. Denn öffentliche Urkunden erbringen nur vollen Beweis für die Abgabe der darin beurkundeten Erklärungen (formelle Beweiskraft), nicht aber für deren inhaltliche Richtigkeit (materielle Beweiskraft) (BGH, NJW-RR 2007, 1006, 1007). Die von der Klägerin vorgelegte notarielle Urkunde allein erbringt daher nur Beweis darüber, dass Frau N als Bevollmächtigte von Herrn M eine Erklärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass die dem Notar vorliegende schriftliche Erklärung, wonach Herr M die Lizenzvereinbarung gemäß Anlage K 23 unterschrieben hat, von Herrn M stammt. Sie allein erbringt hingegen keinen Beweis darüber, ob die in Bezug genommene schriftliche Erklärung tatsächlich von Herrn M stammt und sie erbringt auch keinen Beweis darüber, ob die Namensunterschrift unter der Anlage K 23 tatsächlich echt ist. - Unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der mündlichen Verhandlungen und des Ergebnisses der in zweiter Instanz durchgeführten Beweisaufnahme ist der Senat jedoch in einer Gesamtschau gleichwohl davon überzeugt, dass neben Herrn O auch Herr M die Vereinbarung gemäß Anlage K 23 für die E unterschrieben hat. Ausweislich der Anlage K 33a/b hat Herr M unter Vorlage einer schriftlichen Erklärung vor einem südkoreanischen Notar durch einen Dritten als Bevollmächtigten von ihm bestätigen lassen, dass er die in Rede stehende Vereinbarung eigenhändig unterschrieben hat. Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht den Tatsachen entspricht, sind weder dargetan noch ersichtlich. Insbesondere behauptet die Beklagte nicht, dass die E den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit der Klägerin in Abrede stellt und/oder sich gegen die vorliegende Prozessführung der Klägerin wendet. Im Gegenteil folgt aus der Tatsache, dass Herr M der Klägerin eine Kopie seines Reisepasses („Passport“) zum Nachweis der eigenhändigen Unterzeichnung des Lizenzvertrages gemäß K 23 durch ihn zur Verfügung gestellt hat, die die Klägerin als Anlage K 41 vorgelegt hat, dass Herr M sich zu dem Abschluss des Lizenzvertrages gemäß Anlage K 23 für die E bekennt und er die Unterschrift unter diesem Vertrag als die seine anerkennt. Zwar bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen, dass die Anlage K 41 tatsächlich Herrn M zeige und dass die abgebildeten Seiten tatsächlich Bestandteil des behaupteten Ausweisdokuments seien. Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der von der Klägerin vorgelegten Ausweiskopie entgegen ihren Angaben nicht um die Kopie des Reisepasses von Herrn M handelt, sind jedoch weder dargetan noch ersichtlich.
- Dies legt zugleich nahe, dass die E von dem vorliegenden Rechtsstreit Kenntnis hat und die Führung dieses Prozesses durch die Klägerin, bei der es sich unstreitig um ihre Tochtergesellschaft handelt, ihrem Willen entspricht. Letzteres ergibt sich insbesondere auch aus der von der Klägerin im Einspruchsverfahren eingereichten Beschwerdebegründung der E vom 20.09.2023 (Anlage K 52, dort Rn. 6). Aus dieser geht hervor, dass die E positive Kenntnis davon hat, dass die Klägerin die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch nimmt. Insbesondere lässt sich den dortigen Ausführungen entnehmen, dass die E Kenntnis von dem vorliegenden Berufungsverfahren hat. Die E geht damit offenbar vom Bestehern eines Lizenzvertrages zwischen ihr und der Klägerin aus, was nahelegt, dass dieser von Herrn M für die E unterzeichnet wurde. Im Übrigen ließe dies aber jedenfalls den Schluss zu, dass die Klägerin den vorliegenden Verletzungsrechtsstreit mit Ermächtigung der E als ihrer koreanischen Konzernmutter führt. Alles andere erscheint unter den gegebenen Umständen fernliegend.
- (3.3)
Soweit die Beklagte in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestreitet, dass die Unterzeichner der Vereinbarung gemäß Anlage K 23 zum damaligen Zeitpunkt vertretungsbevollmächtigt waren, hat die Klägerin durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges (Anlage K 32, dort lfd. Nr. 22) nachgewiesen, dass der für die Klägerin handelnde Herr O zum maßgeblichen Zeitpunkt der Lizenzeinräumung einer von mehreren Geschäftsführern der Klägerin und als solcher auch einzelvertretungsberechtigt war. - Der für die E handelnde Herr M war zur selben Zeit Representative Director, was sich aus der als Anlage K 34a/b vorgelegten Abschrift einer Apostille eines Handelsregisterauszugs ergibt, in dem Herr M unter „Details of Executives“ (Angaben zur Unternehmensführung) an dritter Stelle als – am 02.01.2020 ernannter – „Representative Director“ angegeben ist. Die dort wiedergegebenen ersten Ziffern der „Registration no.“ (Melderegisternummer) „641XXC“ finden sich zudem in der als Anlage K 41 vorgelegten Kopie des Reisepasses („Passport“) von Herrn M wieder (vgl. letzte Zeile, …KOR641XXC…). Der Senat hat daher keine Zweifel, dass Herr M Representative Director der E war und als solcher nach Art. 34 Abs. 1 der als Anlage K 35 a/b vorgelegten Satzung berechtigt war, die Gesellschaft zu vertreten und deren Geschäft zu leiten.
- bb)
Als einfache Lizenznehmerin an dem Gegenstand des Klagepatents hat die Klägerin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der eingeklagten Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf. Ausweislich des als Anlage K 24 zur Akte gereichten Handelsregisterauszugs umfasst ihr Geschäftsbereich die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Komponenten zur regenerativen Stromerzeugung. Sie bietet derartige Produkte auf der Internetseite http://www.q-cells.de an (vgl. Anlagen K 25/K 30) und nimmt damit am relevanten Markt für Solarzellen teil. Sie ist eine Tochtergesellschaft der E, bei der es sich um einen der führenden Hersteller auf dem Gebiet der Photovotaiktechnologie handelt, und ist nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag für den Vertrieb von deren Produkten in Deutschland zuständig (vgl. Schriftsatz v. 22.12.2020, S. 4 [Bl. 441 GA]). Nach dem ebenfalls unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Klägerin machen insbesondere die auf der Website beworbenen Produkte der Reihe „R“ (Anlage K 30) von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch (vgl. Berufungsduplik, Rn. 3 [Bl. 565 GA]). Dem diesbezüglichen Vorbringen der Klägerin ist Beklagte nicht (mehr) entgegengetreten. - cc)
Auf die materiell-rechtliche Wirksamkeit der behaupteten Übertragung des Klagepatents von der S auf die E kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht an. - (1)
Zwar muss der Lizenznehmer zur Darlegung seiner Berechtigung notfalls die Wirksamkeit der ihn begünstigenden Lizenzeinräumung nachweisen. Für die angesichts der Beschränkung der Klage auf Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche allein maßgebliche Prozessführungsbefugnis ist aber nicht entscheidend, ob der Lizenzgeber im Zeitpunkt der Lizenzerteilung materiell-rechtlich zur Lizenzvergabe berechtigt war. Wird das Klagepatent übertragen, entscheidet gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 PatG vielmehr allein der Rollenstand des Patentregisters darüber, wer prozessführungsbefugt ist. Im Verletzungsprozess gilt nur derjenige als klagebefugt, der als Patentinhaber in der Rolle eingetragen ist. Wem das Privileg, als Patentinhaber in der Rolle eingetragen zu sein, zuteil wird, der gilt auch als zur Erteilung einer Lizenz berechtigt. Dass dem so ist, folgt aus der Tatsache, dass für die eigene Prozessführungsbefugnis des Patentinhabers nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG der Rolleneintrag den Ausschlag gibt und es nicht darauf ankommt, ob der Registrierte auch materiell-rechtlicher Schutzrechtsinhaber geworden ist (BGHZ 197, 196 = GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren). - Folgerichtig kommt es auch für die – abgeleitete – Prozessführungsbefugnis des Lizenznehmers nicht darauf an, ob der Lizenzgeber das Patent sachlich-rechtlich erworben hat, sondern genügt es, dass er im Register als Schutzrechtsinhaber eingetragen ist. Sollte der Lizenzgeber das lizenzierte Patent nicht rechtswirksam erworben haben, würde er selbst die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung in gesetzlicher Prozessstandschaft (§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG) einklagen können und zugesprochen erhalten. Es erscheint nur folgerichtig, dass er seine eigene (gesetzliche) Prozessführungsbefugnis dann auch im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft an einen Dritten (= Lizenznehmer) weiter vermitteln kann (Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. D Rn. 361).
- Vorliegend hat die seit dem 30.01.2020 im Patentregister eingetragene E die Vereinbarung gemäß Anlage K 23 als Lizenzgeberin mit der Klägerin abgeschlossen. Das genügt unter dem erörterten Gesichtspunkt für eine Bejahung der Prozessführungsbefugnis der Klägerin als Lizenznehmerin jedenfalls für den Unterlassungs- und Vernichtungsanspruch, die ihre Grundlage in vollem Umfang bereits in solchen Benutzungshandlungen der Beklagten, die seit der Registerumschreibung auf die Lizenzgeberin vorgefallen sind, und in dem aktuellen Besitz/Eigentum der Beklagten finden. Einer Abtretung von Ansprüchen der I bedurfte es deswegen insoweit nicht, so dass deren – von der Beklagten bestrittene – rechtliche Wirksamkeit dahinstehen kann. Entsprechendes hat auch für den Rückrufanspruch zu gelten, soweit er sich auf nach der Eintragung der E in den Verkehr gebrachte patentgemäße Erzeugnisse bezieht.
- Zwar erwächst die Aktivlegitimation hinsichtlich der Ansprüche wegen Patentverletzung nicht aus der Eintragung einer Person als Inhaberin in das Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG. Denn die Eintragung im Patentregister hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren) keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage; sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend; ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist daher nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage am Klagepatent maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 53 f. – Fräsverfahren). Wird ein (in die Zukunft gerichteter) Unterlassungsanspruch geltend gemacht, ist diese Differenzierung allerdings ohne Belang. Soweit ein Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG besteht, ist der Beklagte auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG legitimierten Patentinhabers nämlich nicht zur Unterlassung gegenüber einem bestimmten Berechtigten, sondern zur Unterlassung schlechthin zu verurteilen (vgl. BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 55 – Fräsverfahren). Unabhängig von der materiellen Berechtigung am Klagepatent ist der im Register eingetragene Patentinhaber somit nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG prozessual berechtigt, aus dem Patent auf Unterlassung zu klagen.
- Gleiches hat für den Vernichtungs- und den Rückrufanspruch zu gelten (vgl. LGU, S. 11 = GRUR-RS 2020, 15928 Rn. 44 – Solarzelle; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn.69 ff.; Urt. v. 03.11.2020 – 4a O 63/19, GRUR-RS 2020, 43260 Rn. 28 – Krebsmedikament II). Auch im Falle der Geltendmachung der Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf durch den nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG durch den Rolleneintrag legitimierten Patentinhaber kommt es nicht auf dessen materielle Inhaberschaft an dem Klagepatent an. Soweit ein Vernichtungsanspruch aus § 140a Abs. 1 PatG und ein Rückrufanspruch aus § 140a Abs. 3 PatG bestehen, ist der Beklagte vielmehr auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG legitimierten Patentinhabers nicht zur Vernichtung und zum Rückruf der patentverletzenden Gegenstände gegenüber einem bestimmten Berechtigten, sondern zur Vernichtung und zum Rückruf schlechthin zu verurteilen (vgl. im Einzelnen LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn.69 ff. (73)).
- (2)
Zu beachten ist zwar, dass die prozessuale Berechtigung nur ab dem Zeitpunkt der Eintragung als Patentinhaber im Patentregister besteht (vgl. LGU, S. 11 = GRUR-RS 2020, 15928 Rn. 44 – Solarzelle; LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn. 74; Urt. v. 03.11.2020 – 4a O 63/19, GRUR-RS 2020, 43260 Rn. 28 – Krebsmedikament II). - Für den Unterlassungsanspruch ist dies freilich ohne Belang, weil der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn. 74). Ebenso scheidet eine zeitliche Begrenzung beim Vernichtungsanspruch aus (anders LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn. 74). Der Vernichtungsanspruch bezieht sich auch auf im Besitz und/oder Eigentum des Beklagten befindliche patentverletzende Erzeugnisse, an denen der Beklagte bereits vor der Registerumschreibung Besitz und/oder Eigentum erlangt hat. Dass auch solche Gegenstände auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG legitimierten Patentinhabers (bzw. dessen Prozessstandschafters) zu vernichten sind, folgt daraus, dass sich diese Verletzerprodukte auch aktuell im Besitz/Eigentum des Verletzers befinden. Insoweit besteht der zu beseitigende rechtswidrige Zustand auf Seiten des Verletzers fort.
- Ob Entsprechendes für den Rückrufanspruch gilt oder ob sich bei diesem die prozessuale Berechtigung nur auf solche Gegenstände beziehen kann, die von dem Beklagten ab dem Zeitpunkt der Registerumschreibung in den Verkehr gebracht worden sind (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14, BeckRS 2016, 131580 Rn. 74), muss der Senat nicht entscheiden. Denn die Klägerin hat zuletzt nur noch Rückrufansprüche ab dem Zeitpunkt der Registereintragung der E als Patentinhaberin geltend gemacht.
- B.
Das Klagepatent betrifft eine Solarzelle mit einer oberflächenpassivierenden Dielektrikumdoppelschicht. - Damit Solarzellen hohe Wirkungsgrade erreichen können, bedarf es einer effektiven Unterdrückung von Oberflächenrekombinationsverlusten. Zu solchen Verlusten kommt es, wenn die im Inneren der Solarzelle durch einfallendes Licht erzeugten Ladungsträgerpaare an die Oberfläche des Solarzellensubstrats diffundieren und dort rekombinieren, wodurch sie keinen Beitrag mehr zum Wirkungsgrad der Solarzelle leisten können. Um dies zu vermeiden, bedarf es einer möglichst guten Passivierung der Oberfläche der Solarzelle (Abs. [0002] Anlage TW-B9; die nachfolgenden Bezugnahmen auf die Klagepatentbeschreibung betreffen jeweils die mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 29.09.2022 angepasste Beschreibung gemäß Anlage TW-B9).
- Bei Laborsolarzellen wird hierfür häufig bei hohen Temperaturen von über 900° C Siliziumdioxid aufgewachsen. Ein solcher Hochtemperatur-Prozessschritt ist nach den Angaben des Klagepatents jedoch mit erheblichem Mehraufwand bei der Solarzellenprozessierung verbunden, weshalb bei der industriellen Solarzellenherstellung meist auf einen solchen Weg der Oberflächenpassivierung verzichtet wird. Hinzu kommt, dass kostengünstiges multikristallines Silizium gegenüber hohen Temperaturen empfindlich ist, was zu einer erheblichen Reduzierung der Ladungsträgerdauer und damit zu Wirkungsgradverlusten führen kann (Abs. [0003] f.).Als Alternative hierzu haben sich daher im Stand der Technik Niedertemperaturverfahren etabliert.
- Ein möglicher Weg hierfür ist die Oberflächenpassivierung mittels amorphem Siliziumnitrid oder -karbid, die bei Temperaturen von 300 – 400° C beispielsweise mittels einer plasmaunterstützten chemischen Gasphasenabscheidung (Plasma Enhenced Chemical Vapour Deposition, PECVD) aufgebracht werden. Die auf diese Weise hergestellten dielektrischen Schichten sind allerdings aufgrund der dabei entstehenden hohen Dichte kleiner Löcher oder Poren in der Schicht („Pinholes“) und der dadurch bedingten schlechten Isolationseigenschaften für großflächige Hocheffizienzsolarzellen nur begrenzt einsetzbar. Außerdem basiert die Passivierwirkung bei einer solchen Lösung größtenteils auf einer sehr hohen positiven Ladungsträgerdichte innerhalb der dielektrischen Schichten, die etwa bei Passivierung der Solarzellenrückseite bei der Verwendung von p-Typ Siliziumwafern zur Ausbildung einer Inversionsschicht führen kann, über die ein zusätzlicher Verluststrom von Minoritätsladungsträgern auf der Basis der Solarzelle zu den Rückseitenkontakten abfließen kann („parasitärer Shunt“). Auf hoch bordotierten p+-Oberflächen kann Siliziumnitrid sogar im Vergleich zu einer unpassivierten p+-Oberfläche zu einer Depassivierung führen (Abs. [0005]).
- Sehr gute Passivierungen sowohl auf p- als auch auf p+-Oberflächen wurden im Stand der Technik mit amorphen Siliziumschichten erzielt, die ebenfalls mittels plasmaunterstützter Gasphasenabscheidung bei sehr niedrigen Beschichtungstemperaturen von typischerweise unter 250° C hergestellt werden können, wie sie zum Beispiel bei T et al. beschrieben werden (Abs. [0006]). Die oberflächenpassivierende Eigenschaft solcher armorpher Siliziumschichten kann jedoch gegenüber Temperaturbehandlungen sehr anfällig sein. Bei den heutigen industriellen Solarzellenprozessen erfolgt die Metallisierung häufig mittels Siebdrucktechnik, wobei typischerweise als letzter Prozessschritt eine Feuerung der Kontakte in einem Infrarot-Durchlaufofen bei Temperaturen zwischen ca. 800° C und 900° C stattfindet. Obwohl die Solarzelle diesen hohen Temperaturen nur für wenige Sekunden ausgesetzt ist, kann dieser Feuerschritt zu einer erheblichen Degradation der Passivierwirkung der amorphen Siliziumschicht führen (Abs. [0007]).
- Gute Passivierergebnisse können auch mit Aluminiumoxidschichten erzielt werden, die mittels sequentieller Gasphasenabscheidung (Atomic Layer Deposition, ALD) bei z.B. etwa 200° C abgeschieden und anschließend bei etwa 425° C getempert werden. Allerdings wird bei der sequenziellen Gasphasenabscheidung innerhalb eines Abscheidungszyklus jeweils generell nur eine einzelne Moleküllage des abzuscheidenden Materials auf der Substratoberfläche angelagert. Da ein Abscheidungszyklus typischerweise 0,5 bis 4 s andauert, ergeben sich entsprechend niedrige Abscheideraten. Die Abscheidung von Aluminiumoxidschichten mit einer Dicke, die für eine Verwendung als Antireflexionsschicht oder als Rückseitenreflektor geeignet ist, erfordert daher Abscheidungsdauern, die eine Verwendung solcher Schichten bei industriell gefertigten Solarzellen bisher als kommerziell uninteressant erschienen ließen (Abs. [0008]).
- Wie die Klagepatentschrift einleitend weiter zum Stand der Technik ausführt, offenbaren die US 2006/157733 A1 sowie K et al.: „Excellent passivation of highliy doped p-type Si surfaces by negative-charge-dielectric A2O3”, 11. September 2007 (2007-09-11), Applied Physics Letters vol. 91, page 112107 (Anlage K 18/18a), Verfahren zum Passivieren einer Solarzelle, die das Abscheiden einer aus Aluminiumoxid bestehenden Dielektrikumschicht umfassen (Abs. [0009]). Gemäß dem im Einspruchsverfahren geänderten Abs. [0009] der Klagepatentbeschreibung zeigt ferner die EP 1 763 XXD (Anlage TW 13/13a) eine Solarzelle mit einem Siliziumsubstrat, an dessen lichtabgewandter Rückseite eine dielektrische Schicht aus niederqualitativem Oxid sowie darauf eine Passivierungsschicht aus wasserstoffhaltigem Siliziumnitrid angeordnet ist, und offenbart die JP 2007-234XXE A (Anlagen TW-B 7/7a) ein fotoelektrisches Umwandlungselement (Abs. [0009]).
- Vor dem geschilderten Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, eine Solarzelle bereitzustellen, deren Oberfläche gut passiviert ist und bei der die vorgenannten Nachteile herkömmlicher oberflächenpassivierender Schichten zumindest teilweise vermieden werden können. Insbesondere soll die Möglichkeit einer kostengünstigen, industriell realisierbaren Fertigung von Solarzellen mit einer sehr guten Oberflächenpassivierung geschaffen werden (Abs. [0010]).
- Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung der Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes vom 29.09.20022 eine Solarzelle mit folgenden Merkmalen vor (wobei das gegenüber der landgerichtlichen Verurteilung hinzugekommene Teil-Merkmal durch Unterstreichung hervorgehoben ist):
- 1. Solarzelle, aufweisend
- 1.1 ein Siliziumsubstrat (1),
- 1.2 eine erste Dielektrikumschicht (3) an einer Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrats
- und
- 1.3 eine zweite Dielektrikumschicht (5) an einer Oberfläche der ersten Dielektrikumschicht (3).
- 2. Die Materialien der ersten Dielektrikumschicht (3) und der zweiten Dielektrikumschicht (5) unterscheiden sich.
- 3. Die erste Dielektrikumschicht (3) weist auf
- 3.1 Aluminiumoxid (Al2O3)
- und
- 3.2 eine Dicke von weniger als 50 nm.
- 4. Die zweite Dielelektrikumschicht (5) weist eine Dicke von mehr als 50 nm auf.
- 4.1 In die zweite Dielektrikumschicht (5) ist Wasserstoff eingelagert.
- Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift, bei der es sich um deren einzige Figur handelt, zeigt eine Solarzelle mit einer ersten und einer zweiten Dielektrikumschicht. Zwar handelt es sich bei der gezeigten Solarzelle, wie in Abs. [0037] der im Einspruchsverfahren angepassten Klagepatentbeschreibung betont wird, um eine nicht (mehr) beanspruchte Solarzelle, weil bei dieser die erste Dielektrikumschicht (3) nicht an einer Oberfläche „der lichtabgewandten Rückseite“ des Siliziumsubstrats (1) vorgesehen ist, wie dies nunmehr von dem im Einspruchsverfahren geänderten Merkmal 1.2 verlangt wird. Gleichwohl veranschaulicht diese Figur schematisch und beispielhaft die schichtweise Anordnung einer erfindungsgemäßen Solarzelle, die ein Siliziumsubstrat (1) sowie eine (dünnere) erste Dielektrikumschicht (3) und eine (dickere) zweite Dielektrikumschicht (5) aufweist.
- 1.
Die Oberflächen eines Siliziums-Kristalls sind Orte mit hoher Rekombinationsaktivität, was bedeutet, dass die durch Licht generierten Ladungsträgerpaare – bestehend aus einem positiv geladenen Ladungsträger („Loch“) und einem negativ geladenen Ladungsträger (Elektron) – wieder verloren gehen können und damit nicht mehr für die Energieumwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie zur Verfügung stehen (Gutachten Prof. P, S. 4). Um eine solche Rekombination zu verhindern, weist die erfindungsgemäße Solarzelle eine dielektrische Passivierschicht auf. Sie setzt sich aus zwei Teilschichten zusammen – einer dünnen, aluminiumoxidhaltigen Schicht sowie einer dickeren, wasserstoffhaltigen Schicht (vgl. Abs. [0013]). Den Schlüssel zur Herbeiführung der angestrebten guten Oberflächenpassivierung sieht das Klagepatent in der Kombination zweier, aus unterschiedlichen Materialien bestehender Dielektrikumschichten, die sich ergänzen (vgl. Abs. [0015]). Beide Schichten tragen dabei auf unterschiedliche Weise zur Passivierung der Solarzellenoberfläche bei, einmal mittels eines elektrischen Feldes und das andere Mal auf chemischen Wege. - a)
Die erste, aluminiumoxidhaltige Dielektrikumschicht wirkt in erster Linie über ein elektrisches Feld passivierend (Feldeffektpassivierung). Die Feldeffektpassivierung bewirkt, dass in der dielektrischen Schicht vorhandene feste Ladungen – je nach ihrem Vorzeichen – die nahe der Oberfläche im Silizium-Kristall vorhandenen Ladungsträger zur Oberfläche hin entweder anziehen oder abstoßen. Dadurch wird idealerweise die Konzentration der ohnehin schon weniger oft vorhandenen Ladungsträgerart (Minoritätsladungsträger) noch weiter reduziert, so dass für einen Rekombinationsprozess eines Ladungsträgerpaares einer der Partner nur noch in verschwindend geringer Konzentration vorhanden ist. Auf die Solarzelle angewandt bedeutet dies, dass für die Passivierung der Oberfläche von p-dotiertem Silizium auf die Elektronen als Minoritätsladungsträger eine durch den Passivierschichtstapel hervorgerufene negative Ladung wirken sollte, damit die ebenfalls negativ geladenen Elektronen im Silizium-Kristall von der Oberfläche ferngehalten werden und die Löcher (positiv geladene Ladungsträger) somit keinen Rekombinationspartner haben (Gutachten Prof. P, S. 5 und 11). In einem gewissen Maße ist die oberflächenpassivierende Wirkung dieser Schicht aber auch auf eine chemische Passivierung zurückzuführen (Gutachten Prof. P, S. 7).Da sich mittels des in der Patentbeschreibung erwähnten Verfahrens der sequenziellen Gasphasenabscheidung (ALD), das beim Aufbringen einer Al2O3-Schicht herkömmlicherweise zum Einsatz kommt, innerhalb eines Abscheidungszyklus jeweils nur eine einzelne Moleküllage des abzuscheidenden Materials auf der Oberfläche anlagert, lassen sich Aluminiumoxidschichten mit der für ihre Verwendung als (alleinige) Antireflexschicht oder als Rückseitenreflektor erforderlichen Dicke nur mit hohem zeitlichen Aufwand herstellen, was ein solches Vorgehen nach den Angaben der Klagepatentschrift kommerziell uninteressant macht (Abs. [0008]). Vor diesem Hintergrund ist die in Merkmal 3.2. zu findende Forderung nach einer Dicke der ersten Dielektrikumschicht von weniger als 50 nm zu lesen: Je dünner die aluminiumoxidhaltige Schicht ausgebildet ist, desto schneller kann sie abgeschieden werden. Aufgrund ihrer durch die sequenzielle Gasphasenabscheidung erreichbaren hohen Qualität besitzt sie gleichwohl sehr gute oberflächenpassivierende Eigenschaften (Abs. [0031]). - b)
Allein den passivierenden Eigenschaften der Aluminiumoxidschicht vertraut das Klagepatent jedoch nicht, sondern bringt zusätzlich eine Schicht zur chemischen Passivierung zur Anwendung. Diese wirkt dergestalt, dass unabgesättigte Bindungen („dangling bonds“) oder Defekte an der Oberfläche des Silizium-Kristalls durch Absättigung reduziert werden (vgl. Gutachten Prof. P, S. 5, S. 10 f.; Prot. v. 06.06.2024, S. 21). Hierzu stellt der Patentanspruch 1 der ersten Dielektrikumschicht eine weitere, wasserstoffhaltige Schicht zur Seite. Ein Teil dieses Wasserstoffs kann durch die Aluminiumoxidschicht der ersten Dielektrikumschicht diffundieren und an der Grenzfläche zum Silizium unabgesättigte Siliziumbindungen absättigen, die nicht bereits durch die auf die Silizium-Scheibe aufliegenden ersten Dielektrikumschicht (chemisch) abgesättigt wurden, wodurch die Passivierqualität erhöht wird (Abs. [0015] a.E.; Abs. [0029]; Gutachten Prof. P, S. 5 a.E., S. 11 f.). - c)
Die Erfindung beruht damit auf der Erkenntnis, dass die Bildung einer Passivierungsschicht aus zwei Teilschichten mit unterschiedlichen Passivierungsmechanismen zu einer Verbesserung der Passivierungsqualität führen kann. Indem die erste Dielektrikumschicht auf die im Einsatz der Solarzelle vom einfallenden Licht abgewandte Rückseite des Substrates aufgebracht wird, kann die (auf der ersten Dielektrikumschicht angebrachte) zweite Dielektrikumschicht außerdem als Rückseitenreflektor wirken, so dass Licht, das die Solarzelle durchdringt, an der Rückseite weitestgehend reflektiert wird und somit das Solarzellensubstrat ein weiteres Mal durchläuft (Abs. [0019]). - d)
Den geschilderten kombinierten Wirkmechanismus hat der Durchschnittsfachmann vor Augen, wenn er sich der Beantwortung der Frage zuwendet, welche Anforderungen an die räumliche Anordnung der einzelnen Schichten zu stellen sind. - Erfindungsgemäß soll sich die erste Dielektrikumschicht an einer Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrats befinden (Merkmal 1.2.). Da die zweite Dielektrikumschicht wiederum an einer Oberfläche der ersten Dielektrikumschicht angeordnet sein soll (Merkmal 1.3.), gibt Patentanspruch 1 eine konkrete Schichtfolge vor: Von innen nach außen finden sich nacheinander das Siliziumsubstrat, die erste, aluminiumoxidhaltige Dielektrikumschicht und schließlich die zweite, wasserstoffhaltige Dielektrikumschicht. Ein solcher Aufbau korrespondiert mit der den einzelnen Schichten zugedachten Funktion. Nur wenn sich die aluminiumoxidhaltige Schicht zwischen dem Siliziumsubstrat und der wasserstoffhaltigen Schicht befindet, kann sich einerseits eine Si/Al2O3-Grenzfläche bilden und zugleich ein Teil des in der zweiten Dielektrikumschicht befindlichen Wasserstoffs durch die Al2O3-Schicht diffundieren und an der Grenzfläche zum Silizium unabgesättigte Siliziumbindungen passivieren (vgl. Abs. [0015]).
- 2.
Nichts gesagt ist damit bisher zu der den Kern der Auseinandersetzung der Parteien bildenden Frage, ob die in Merkmal 1.2. aufgestellte Forderung nach einer Anordnung der ersten Dielektrikumschicht an einer Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrats auch beim Vorliegen weiterer Zwischenschichten erfüllt sein kann oder ob es zwingend eines unmittelbaren Kontakts beider Schichten – des Siliziumsubstrats und der ersten Dielektrikumschicht – bedarf. - a)
Der Wortlaut des Patentanspruchs gibt hierauf keine eindeutige Antwort. Zwar lässt sich die Forderung nach einer Anordnung der ersten Dielektrikumschicht an einer Oberfläche des Siliziumsubstrats ausgehend vom allgemeinen Sprachgebrauch zwanglos im Sinne eines Aufeinanderliegens beider Schichten verstehen. Ausdrücklich gefordert wird ein solches Aufeinanderliegen jedoch ebenso wenig wie eine direkte Anordnung der ersten Dielektrikumschicht auf der Oberfläche des Siliziumsubstrats. - b)
Deutliche Hinweise, dass das Klagepatent, welches im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe sein eigenes Lexikon darstellt (BGH, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung, m.w.N.), die Forderung nach einer Anordnung der ersten Dielektrikumschicht auf der Oberfläche des Siliziumsubstrats im Sinne eines direkten Kontakts versteht, sucht der Fachmann auch in der – gemäß Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ im Rahmen der Auslegung stets zu berücksichtigten – Patentbeschreibung vergebens. Zwar setzt sich die dielektrische Passivierschicht danach aus zwei Teilschichten zusammen (Abs. [0013]). Das schließt das Vorhandensein weiterer Schichten jedoch ebenso wenig aus wie die Forderung nach einer „Dielektriumdoppelschicht“ (Abs. [0014]). Soweit Abs. [0020] die Reinigung der Substratoberfläche vor dem Abscheiden der ersten Dielektrikumschicht zur Vermeidung von Verschmutzungen thematisiert, handelt es sich hierbei lediglich um eine Option („kann die Oberfläche gründlich gereinigt werden“), ohne dass sich daraus auf die zwingende Notwendigkeit eines unmittelbaren Kontakts zwischen erster und zweiter Schicht schließen ließe. Im Übrigen hat der gerichtliche Sachverständige in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich trotz Durchführung einer Reinigungsprozedur vor der ALD-Abscheidung – beispielsweise mit verdünnter Flusssäure (FH), wie in der Veröffentlichung von K et al. (2006) beschrieben (Anlage K 19/19a bzw. TW 17/17a) – während der ALD-Abscheidung eine Oxid-Schicht bilden kann (vgl. Gutachten Prof. P, S. 8, 18 f.). Dies hat der gerichtliche Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung noch einmal bestätigt und ergänzend ausgeführt, dass es ist in der Praxis kaum möglich sei, mit nass-chemischen Reinigungsprozessen eine reine Siliziumoberfläche ohne jegliche Siliziumoxidschicht herzustellen (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 14 f.). - Nichts anders folgt aus dem in Abs. [0015] enthaltenen Hinweis auf eine Si/Al2O3-Grenzfläche, die nach der Klagepatentbeschreibung „beim ALD-Prozess naturgemäß entsteht“. Zu deren genauer technischer Ausgestaltung verhält sich die Klagepatentbeschreibung nicht.
- c)
Der angesprochene Fachmann, der sich mit dem Hinweis auf das ALD-Verfahren und der Frage nach der Ausgestaltung einer Si/Al2O3-Grenzschicht konfrontiert sieht, richtet seinen Blick daher auf die technischen Eigenschaften einer mittels eines ALD-Prozesses mit Al2O3 beschichteten Siliziumoberfläche. Dass es im Rahmen eines solchen Verfahrens zur Bildung einer Zwischenschicht aus Siliziumdioxid (SiO2) kommen kann, stellt die Beklagte nicht in Abrede. Hiervon geht auch der in der Klagepatentbeschreibung gewürdigte Stand der Technik aus. - aa)
So stellt die Bildung einer solchen Zwischenschicht den Ausgangspunkt der Überlegungen von L et al. (Anlagen K 21/21a) in der in Abs. [0043] der Klagepatentbeschreibung erwähnten Veröffentlichung dar. Die Autoren versuchen mittels eines ALD-Verfahrens ohne den Einsatz der sonst üblichen Sauerstoffquellen scharfe Silizium-Metalloxid-Grenzflächen ohne Siliziumoxid-Zwischenschicht zu erzeugen (vgl. Anlage K 21a, S. 1, Sp. 2 und 3 sowie S. 3, Sp. 1). Der gerichtliche Sachverständige hat in seiner Anhörung in diesem Zusammenhang ergänzend darauf hingewiesen, dass ihm persönlich außer dieser Schrift auch keine andere Methode bekannt sei, die eine solche Zwischenschicht-Bildung ausschließen könne (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 18). Diesen auf eine Vermeidung einer Siliziumdioxid-Zwischenschicht ausgerichteten Ansatz einer „thermischen ALD“ beschreibt das Klagepatent jedoch lediglich als eine Alternative, woraus der Fachmann den Schluss ziehen muss, dass es dem Klagepatent gerade nicht um die Vermeidung einer solchen Siliziumdioxid-Zwischenschicht geht. - Dass dem so ist, verdeutlicht dem Fachmann der in Abs. [0009] erwähnte, von der Klägerin als Anlage K 18 (deutsche Übersetzung Anlage K 18a) vorgelegte Aufsatz von K et al. (2007). Zwar findet dort eine Siliziumdioxid-Zwischenschicht keine ausdrückliche Erwähnung. Allerdings verweist die Schrift auf zwei Vorveröffentlichungen, in denen die Entstehung einer solchen Zwischenschicht beschrieben wird. Zum einen geht ein Aufsatz von J et al. (Anlage K 20/K 20a) von der Entstehung eines Übergangsbereichs mit Siliziumdioxid aus, der die die Autoren nicht davon abhält, gleichwohl von einer „Al2O3/Si“-Grenzfläche (vgl. Anlage K 20, S. 3440 letzter Absatz bis S. 3442 oben nebst Übersetzung Anlage K 20a) zu sprechen. Wie der Sachverständige in seinem Gutachten (S. 9 f.) ausgeführt hat, wirkt sich die Zwischenschicht nach der Publikation von J et al. sogar günstig auf die gewünschte Passivierwirkung aus. Denn es wird dort beschrieben, dass die festen negativen Ladung an der „Al2O3/Si“ Grenzfläche durch die Verbindung von Al-Atomen mit O-Atomen der „SiO2“-Zwischenschicht entstehen. Nach den Ausführungen von J et al. soll die negative feste Ladung, die für die gewünschte Passivierwirkung benötigt wird, damit gerade dadurch zustande kommen, dass eine „SiO2“-Zwischenschicht zwischen kristalliner Silizium-Scheibe und abgeschiedener Al2O3-Schicht vorhanden ist (Gutachten Prof. P, S. 10; Prot. v. 06.06.2024, S. 23). Zum anderen wird in einem von K 2007 in Bezug genommenen Aufsatz von K et al. aus dem Jahr 2006 (K 2006; Anlage K 19/19a bzw. TW 17/17a) über eine Oxidschicht zwischen dem Siliziumsubstrat und dem Aluminiumoxid mit einer Dicke von rund 1,5 nm berichtet, die als Resultat des Abscheideprozesses beobachtet wurde (vgl. Anlage K 19, S. 2, Sp. 2 nebst Übersetzung Anlage K 19a, von der die Übersetzung gemäß Anlage TW 17a nur unwesentlich abweicht).
- Auch wenn es sich weder bei der Publikation von K et al. (2006) noch bei der Veröffentlichung von J et al. um unmittelbar in der Klagepatentbeschreibung gewürdigten Stand der Technik handelt, knüpft der in Abs. [0009] genannte Aufsatz von K et al. (2007) an das dort offenbarte Fachwissen an, weshalb der Fachmann die besagten Schriften im Rahmen seiner Überlegungen berücksichtigen wird. Das gilt umso mehr, als ohnehin jeglicher Stand der Technik im Rahmen der Patentauslegung herangezogen werden kann, von dem der Nachweis geführt ist, dass er am Prioritätstag zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gezählt hat (BGH, GRUR 1978, 235, 236 f. – Stromwandler; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. A Rn. 81). Davon ist vorliegend auszugehen.
- Der gerichtliche Sachverständige hat im Rahmen seine Anhörung die Frage, ob es im Prioritätszeitraum zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns zählte, dass es bei der Herstellung einer Solarzelle im Rahmen der Aufbringung einer Aluminiumoxidschicht auf eine kristalline Silizium-Scheibe unter Anwendung des ALD-Verfahrens zur Ausbildung einer sehr dünnen Siliziumoxidschicht („natürliches Oxid“) auf der zu beschichtenden Oberfläche der Silizium-Scheibe kommen kann, ausdrücklich bejaht (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 7). Er hat hierzu bereits in seinem Gutachten (S. 8 f.) nachvollziehbar und überzeugend erläutert, dass sich auf einer kristallinen Silizium-Scheibe innerhalb kurzer Zeit eine sehr dünne SiO2-(bzw. SiOx-)Schicht als „natürliches Oxid“ bildet, sobald O2-Moleküle und Feuchtigkeit in der Umgebungsatmosphäre vorhanden sind. Dieser Wachstumsprozess kann nach seinen Erläuterungen – wie bereits in einer Veröffentlichung von Morita et al. aus dem Jahr 1990 geschildert – schon durch eine im Rahmen der Reinigungsprozedur vorgenommenen Spülung mit H2O beginnen, weshalb es sehr schwer bis unmöglich ist, eine vollständig SiOx-freie Oberfläche – die Formel SiOx drückt gegenüber SiO2 aus, dass es sich (noch) um eine ultradünne Oxidschicht handeln kann, deren stöchiometrische Zusammensetzung sich (noch) von Siliziumdioxid (SiO2) unterscheidet – für einen nachfolgenden Prozessschritt zu präparieren. Nach Einschätzung des Sachverständigen kann daher in der Praxis nicht davon ausgegangen werden, dass die Oberfläche einer kristallinen Silizium-Scheibe nach einem üblichen Reinigungsschritt zum Entfernen von Verunreinigungen an der Scheibenoberfläche vollständig frei von einer (zumindest sehr dünnen) SiOx-Schicht ist (Gutachten Prof. P, S. 8; Prot. v. 06.06.2024, S. 14 f.).
- Auch wenn in der von der Klagepatentschrift angesprochenen Veröffentlichung von K et al. (2007) eine Siliziumdioxid-Zwischenschicht nicht ausdrücklich erwähnt wird, wird der Fachmann vor diesem Hintergrund davon ausgehen, dass dort – ebenso wie bei K 2006 und J – keine vollständig SiOx-freie Oberfläche der Silizium-Scheibe vorliegt, jedenfalls aber nicht vorliegen muss, wenn diese in die ALD-Anlage zur Al2O3-Abscheidung verbracht wird. Wenn in der Publikation von K et al. (2007) von einem „c-Si/Al2O3 interface“ die Rede ist, schließt dies deshalb aus Sicht des Fachmanns nicht aus, dass sich gleichwohl zwischen der Silizium-Scheibe und der Aluminiumdioxid-Schicht eine natürliche Oxid-Schicht befinden kann (Gutachten Prof. P, S. 9).
- Der bei der Auslegung des Klagepatents zu berücksichtigende Stand der Technik führt den Fachmann, der bereits aufgrund seines allgemeinen Fachwissens Kenntnis vom raschen Wachstum einer natürlichen Oxidschicht hat, daher zu der Erkenntnis, dass das in der Patentbeschreibung als Möglichkeit zur Aufbringung der Al2O3-Schicht beschriebene ALD-Verfahren – zumindest – zur Ausbildung einer Siliziumoxid-Zwischenschicht führen kann.
- bb)
Konkrete Hinweise darauf, dass es eine solche Schicht für die Zwecke der Erfindung zu vermeiden oder zumindest vor Fertigstellung des Produktes wieder zu beseitigen gilt, sucht der Fachmann vergebens. - Hierfür reicht insbesondere nicht der in Abs. [0039] zu findende Hinweis auf die Aufbringung der aluminiumoxidhaltigen Verbindung in einer evakuierten Beschichtungskammer aus, selbst wenn diese die Entstehung einer Oxidschicht verhindern würde. Denn den Einsatz einer Evakuierungskammer erwähnt das Klagepatent allein im Zusammenhang mit der Erläuterung des bevorzugten Ausführungsbeispiels. Ein solches dient der Beschreibung von Möglichkeiten der Verwirklichung des Erfindungsgedankens und erlaubt daher grundsätzlich keine einschränkende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGH, GRUR 2004, 1023, 1024 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007 Rn. 21 – Ziehmaschinenzugeinheit; GRUR 2008, 779 Rn. 34 – Mehrgangnabe). In der allgemeinen Patentbeschreibung (Abs. [0021] ff.) findet sich ein Hinweis auf die notwendige Verwendung einer evakuierten Beschichtungskammer ebenso wenig wie in den Patentansprüchen, was für den Fachmann nur den Schluss zulässt, dass die Durchführung des ALD-Verfahrens unter Ausschluss von Sauerstoff möglich und ggf. auch wünschenswert, aber nicht zwingend ist.
- Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachten (S. 18 f.) hierzu im Übrigen erläutert, dass selbst der Einsatz einer evakuierten Beschichtungskammer bei der ALD-Abscheidung nicht zwangsläufig das Auftreten einer SiOx-Zwischenschicht verhindern kann. So erfolgt die ALD-Abscheidung von Al2O3 in K 2006 und K 2007 mittels Plasma-unterstützter ALD, wobei sich das zu beschichtende Substrat in einer evakuierten Beschichtungskammer befindet. Dennoch kann es ausweislich des Aufsatzes von K 2006 nach der Abscheidung zu einer sichtbaren Oxid-Schicht kommen. Die Verwendung einer evakuierten Beschichtungskammer verhindert also nicht zwangsläufig das Entstehen einer SiOx-Zwischenschicht, und zwar – wie sich aus K 2006 ergibt – selbst nach einer vorherigen Behandlung mit verdünnter Flusssäurelösung (Gutachten Prof. P, S. 18/19). Der für das Entstehen der SiOx-Zwischenschicht notwendige Sauerstoff kann nach den Erläuterungen des Sachverständigen z.B. aus dem sauerstoffhaltigen Gas stammen, mit dem die Sauerstoffkomponente der Al2O3-Schicht gebildet wird (Gutachten Prof. P, S. 19).
- cc)
Die Klagepatentbeschreibung führt den Fachmann nach allem zu dem Schluss, dass zumindest eine Siliziumdioxid-Zwischenschicht, wie sie im Rahmen des ALD-Verfahrens entstehen kann, unschädlich ist und nicht aus dem Schutzbereich herausführt. Ist dem aber so, kann es für die Anordnung der ersten Dielektrikumschicht auf der Oberfläche des Siliziumsubstrats weder eines direkten Kontaktes beider Schichten noch eines unmittelbaren Aufliegens beider Schichten aufeinander bedürfen. - In Übereinstimmung hiermit ist der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann davon ausgehen wird, dass mit dem in Merkmal 1.2 verwendeten Ausdruck „Oberfläche des Siliziumsubstrats“ die nach Reinigung real vorliegende Struktur gemeint ist, die durchaus auch eine (sehr dünne) natürliche Oxidschicht auf der kristallinen Silizium-Scheibe aufweisen kann (Gutachten Prof. P, S. 10). Auch nach seiner Einschätzung lässt es das Klagepatent zu, dass sich zwischen dem Substrat und der ersten aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht eine weitere sehr dünne Zwischenschicht aus Siliziumoxid befindet (Gutachten Prof. P, S. 11). Der Fachmann werde, so der Gerichtgutachter weiter, zu der Erkenntnis gelangen, dass das in der Klagepatentbeschreibung als Möglichkeit zur Aufbringung der Al2O3-Schicht beschriebene ALD-Verfahren zur Ausbildung einer SiOx-Zwischenschicht führen könne und dürfe (Gutachten Prof. P, S. 17).
- Etwas anderes folgt nicht daraus, dass das Klagepatent in seiner teilwiderrufenen Fassung keinen Verfahrensschutz mehr gewährt, in der Klagepatentbeschreibung (Abs. [0011] aber dennoch ausgeführt ist, dass die im Beschreibungstext verbliebene Schilderung von Beispielen des nicht beanspruchten Verfahrens zum Herstellen einer Siliziumsolarzelle der Erläuterung der erfindungsgemäßen Solarzelle dient. Selbst wenn die gezeigten Verfahrensbeispiele sämtlich zu Solarzellen führen würden, bei denen das Substrat und die Dielektrikumschichten im unmittelbaren Kontakt stehen, was nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen allerdings fernliegend ist (s.o.), bleibt es dabei, dass die Herstellungsprozeduren bloße Ausführungsbeispiele zur Hervorbringung einer patentgemäßen Solarzelle sind. Da sie bloß Beispiele eines möglichen Vorgehens umschreiben, darf aus ihnen nicht geschlossen werden, dass eine erfindungsgemäße Solarzelle nur und ausschließlich auf diese Weise gefertigt werden kann und deshalb diejenige Beschaffenheit haben muss, die mit den abgehandelten Herstellungsbeispielen verbunden ist.
- d)
Das bedeutet freilich nicht, dass die erste Dielektrikumschicht in beliebigem Abstand zum Siliziumsubstrat angeordnet sein darf. Da für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe, sondern deren technischer Sinn maßgeblich ist, wie er sich unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung des Patents objektiv ergeben (vgl. BGH, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze; GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; GRUR 2021, 574 Rn. 24 – Kranarm), wird der Fachmann sich die Frage stellen, welcher technische Zweck nach der im Patentanspruch niedergelegten und anhand der Patentbeschreibung ausgelegten technischen Lehre damit verbunden ist, dass die erste Dielektrikumschicht an der Siliziumsubstratoberfläche angeordnet ist. Hierbei wird er von folgenden Überlegungen ausgehen: - aa)
Um die angestrebte Feldpassivierung zu ermöglichen, weist die aluminiumoxidhaltige erste Passivierungsschicht ortsfeste negative Ladungen auf. Da die Elektronen in p-dotierten Substraten die Minoritätsladungsträger stellen, führt die Verwendung einer negativ aufgeladenen Passivierungsschicht dazu, dass die ebenfalls negativ geladenen Elektronen von der Substratgrenze abgehalten werden und die „Löcher“ somit keinen Rekombinationspartner haben (Gutachten Prof. P, S. 5; Prot. v. 06.06.2024, S. 3 f.). Eine solche Passivierung setzt zwar eine Nähe zur Substratoberfläche voraus, da das Feld nicht räumlich unbegrenzt wirkt. Im Übrigen schadet es dem Zwecke der Erfindung aber nur, wenn das von der ersten Dielektrikumschicht ausgehende elektrische Feld in einem Maße abnimmt, dass es die ihm zugewiesene Passivierungsaufgabe nicht mehr in einem praktisch relevanten Umfang erfüllen kann. Eine Zwischenschicht darf nur nicht dazu führen, dass sich die Konzentration der festen negativen Ladungen, die zum Abhalten von negativen freien Ladungen (Elektronen) in dem Siliziumsubstrat von der Substratoberfläche dienen, signifikant erniedrigt, so dass sich durch ihre Anwesenheit die Konzentration von Elektronen in dem Siliziumsubstrat nahe der Oberfläche signifikant erhöht (Gutachten Prof. P, S. 12). - Die Durchlässigkeit für Elektronen von dem Siliziumsubstrat an die Grenzfläche der aluminiumoxidhaltigen Schicht wird allerdings nicht signifikant negativ beeinflusst, solange die SiOx-Schicht hinreichend dünn ist (Gutachten Prof. P, S. 14 f., 21), so dass die durch diese Schicht tunnelnden Elektronen für eine negative Ladung in der Aluminiumoxidschicht sorgen können (Prot. v. 06.06.2024, S. 6). Der gerichtliche Sachverständige hat hierzu unter Verweis auf einen Aufsatz von U et al. 1999, S. 258, ausgeführt, dass das Tunneln der Ladungsträger durch eine SiOx-Schicht bis zu einer Schichtdicke von ca. 4 nm (< 4 nm) möglich ist (Gutachten Prof. P, S. 12 ff., 14 f.,) und bis zu einer solchen Dicke die Passiviereigenschaft nicht signifikant negativ beeinträchtigt wird (vgl. Gutachten Prof. P, S. 14 f., 20). Nach seiner Einschätzung ist zumindest bis zu einer Dicke von 4 nm davon auszugehen, dass die Passiviereigenschaften durch eine SiOx -Zwischenschicht nicht signifikant negativ beeinflusst werden (Gutachten Prof. P, S. 21).
- Im Rahmen seiner Anhörung hat der gerichtliche Sachverständige auf Nachfrage bekräftigt, dass jedenfalls eine – vorliegend in Rede stehende – 1 bis 2 nm dicke Siliziumoxidschicht die Feldeffektpassivierung nicht signifikant verändere und hierfür – auch wenn dieser Effekt nicht räumlich unbegrenzt wirke – kein unmittelbares Aufeinanderliegen beider Schichten, d.h. des Siliziumsubstrats und der Aluminiumoxidschicht, erforderlich sei (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 3 f.). Die gelte auch unter Berücksichtigung der positiven Flächenladung der Siliziumoxidschicht, auf die er im Gutachten nicht eingegangen sei. Denn diese sei deutlich kleiner als die negative Flächenladung der Aluminiumoxidschicht, so dass bei Dicken von 1 bis 2 nm die negative Flächendichte des Aluminiumoxids überwiege, so dass letztlich keine signifikante Abschwächung dieses negativen Flächenladungseffekts eintrete (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 5 u. 7).
- Auf die seitens der Klägerin erhobene Kritik, dass sich die Publikation von U et al. nicht auf den Anwendungsfall der Passivierung einer Solarzelle beziehe, hat der Gutachter ergänzend erläutert (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 6), dass es zwar zutreffe, dass es sich um eine andere Anwendung handele. Die als Standardwerk zu bezeichnende Veröffentlichung U et al. beschreibe aber den entscheidenden Effekt des Tunnelns von Elektronen, der auch in dem vorliegenden Fall der Siliziumdioxid-Zwischenschicht zwischen dem Substrat und der Aluminiumoxidschicht wichtig sei, da die negative Ladung in der Aluminiumoxidschicht erst ausgebildet werden könne, wenn Elektronen aus dem Siliziumkristall in die Aluminiumoxidschicht wanderten und dort die negative Ladung hervorriefen. Zu der Folgefrage, ab welcher Dicke der Zwischenschicht dieser Effekt des quantenmechanischen Tunnelns bzw. eine entsprechende Tunnelwahrscheinlichkeit nicht mehr gegeben ist, hat der Sachverständige betont, dass die Tabelle 6.1 der Veröffentlichung von U et al. in der Spalte „Gate-Oxide Thickness TOx“ von einem äquivalenten Oxiddickenwert ausgehe, für den bei Verwendung von anderen Materialien eine Umrechnung in eine Oxiddicke stattfinde. Die in der Tabelle genannten Werte von 1,5 bis 2 nm seien also effektive Werte, bei denen man davon ausgehen müsse, dass eine entsprechend geringe Tunnelwahrscheinlichkeit durch siliziumoxidhaltige Barrieren kaum erreicht werde, sondern hierfür letztlich andere Materialien zur Anwendung kommen müssten.
- Angesichts dieser gleichermaßen nachvollziehbaren wie überzeugenden Ausführungen bestehen für den Senat jedenfalls keine Zweifel, dass eine Siliziumoxidschicht mit einer Dicke von bis zu 2 nm keine relevanten negativen Auswirkungen auf die Feldpassivierung der ersten Dielektrikumschicht hat.
- bb)
Einen weiteren Baustein zur Erzielung der angestrebten guten Passiviereigenschaften bildet der in der zweiten Dielektrikumschicht eingelagerte Wasserstoff. Damit er passivierend wirken kann, muss er durch die erste Dielektrikumschicht diffundieren und an der Grenzfläche zur Siliziumschicht freie Bindungen des Siliziums („dangling bonds“) binden (Abs. [0015], [0029], [0048] a.E.). Prinzipiell können zwar zu dicke SiOx-Schichten zu einer Barriere für die Diffusion von Wasserstoff aus der wasserstoffreichen zweiten Dielektrikumschicht durch die erste Dielektrikumschicht und die SiOx-Zwischenschicht hin zur Oberfläche der Silizium-Scheibe werden (Gutachten Prof. P, S. 12). Solange sich der Wasserstoff – wie vorstehend beschrieben – aber anlagern und damit eine chemische Passivierung bewirken kann, besteht auch im Hinblick auf den der zweiten Dielektrikumschicht zugedachten Wirkmechanismus kein Grund, auf einem direkten Kontakt zwischen dem Siliziumsubtrat und der ersten Dielektrikumschicht zu bestehen. Insbesondere zieht der Fachmann aus der angestrebten Diffusion des Wasserstoffs und dem in der Klagepatentbeschreibung zu findenden Hinweis auf eine sehr dünne erste Dielektrikumschicht (vgl. Abs. [0013] und [0031]) nicht den Schluss, die zweite Dielektrikumschicht müsse so nah wie möglich am Siliziumsubstrat angeordnet sein. Solchen Überlegungen steht bereits entgegen, dass Patentanspruch 1 eine Dicke der ersten Dielektrikumschicht von bis zu 50 nm zulässt. Rein funktional ist daher – was auch der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat (Gutachten Prof. P, S. 12) – nur entscheidend, dass der Wasserstoff auch durch eine eventuell vorhandene weitere Schicht diffundieren und sich damit an der Substratoberfläche anlagern kann. - Letzteres ist jedenfalls bei einer hinreichend dünnen SiOx-Zwischenschicht der Fall. Solange die SiOx-Schicht, die sich zwischen dem Siliziumsubstrat und der ersten aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht befindet, nicht zu dick ist, wird nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen auch die chemische Passivierwirkung nicht nennenswert herabgesetzt, da die Diffusion von Wasserstoff durch eine solche SiOx-Zwischenschicht hindurch zur Grenzfläche mit dem Siliziumsubstrat nicht signifikant negativ beeinflusst wird (Gutachten Prof. P, S. 12, 14, 21). Hiervon ist nach seinen Angaben zumindest bis zu einer Dicke von 4 nm auszugehen (Gutachten Prof. P, S. 14, 21). Bis zu einer solchen Dicke der Zwischenschicht wird also die Diffusion von Wasserstoff aus der wasserstoffreichen zweiten Dielektrikumschicht durch die erste Dielektrikumschicht und die SiOx-Zwischenschicht hin zur Oberfläche des Siliziumsubstrats nicht nennenswert negativ beeinflusst.
- Die Anhörung des Sachverständigen hat auch diesbezüglich keine abweichenden Erkenntnisse erbracht. So hat der Gerichtsgutachter auf konkrete Nachfrage bekräftigt, dass eine – vorliegend in Rede stehende – 1 bis 2 nm dicke Siliziumoxidschicht die chemische Passivierung nicht signifikant beeinträchtige (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 3). Ergänzend hat er erläutert, dass allein entscheidend sei, dass im Rahmen des bei der Herstellung zur Anwendung kommenden Feuerungsschritts Wasserstoff in ausreichender Menge durch die aluminiumoxidhaltige Schicht an die Grenzfläche, also an die Oberfläche des Siliziumsubstrats, diffundiere, um dort offene Bindungen und Defekte abzusättigen (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 21 f.). In der Praxis habe sich gezeigt, dass sogar Siliziumoxidschichten von 10 nm oder mehr kein Hindernis für eine ausreichend hohe Passivierung an der Grenzfläche darstellten (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 22).
- Angesichts dessen bestehen für den Senat auch hier keine Zweifel, dass eine 1 bis 2 nm dicke Siliziumoxidschicht die chemische Passiviereigenschaft der zweiten Dielektrikumschicht nicht nennenswert negativ beeinflusst.
- e)
Keiner der den beiden im Patentanspruch genannten Diekektrikumschichten zugrunde liegenden Wirkmechanismen setzt damit zwingend ein unmittelbares Anliegen der ersten Dielektrikumschicht auf dem Siliziumsubstrat voraus. Eine eventuell zwischen beiden Schichten vorhandene Zwischenschicht führt vielmehr so lange nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, wie sie weder die durch die erste Dielektrikumschicht angestrebte Feldeffektpassivierung verhindert oder signifikant negativ beeinflusst, noch die Diffusion des in der zweiten Dielektrikumschicht vorhandenen Wasserstoffs an die Grenzfläche zum Siliziumsubstrat derart behindert, dass die chemische Passivierung verhindert oder erheblich negativ beeinflusst wird. - Das dargelegte Verständnis vom Klagepatent lässt sich ohne Weiteres auch mit der notwendigen Rechtssicherheit in Einklang bringen. Jede Solarzelle, in welcher sich die im Patentanspruch im Einzelnen genannten Schichten in der dort vorgegebenen Reihenfolge und der dort vorgegebenen Dicke finden, fällt unabhängig vom Vorhandensein weiterer Schichten in den Schutzbereich des Klagepatents, solange diese Zusatz-Schichten weder die mit der aluminiumoxidhaltigen ersten Dielektrikumschicht angestrebte Feldpassivierung noch die Diffusion des Wasserstoffs zur Siliziumsubstratoberfläche und die dortige Anlagerung verhindert oder signifikant negativ beeinflusst, was nach den Ausführungen des Sachverständigen zumindest bei einer SiOx-Zwischenschicht mit einer Dicke von bis zu 2 nm der Fall ist.
- Darauf, ob die angestrebte Feldeffektpassivierung und die ferner angestrebte chemische Passivierung im Falle einer SiOx-Schicht, die sich zwischen dem Siliziumsubstrat und der ersten aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht befindet, sogar bis zu einer Dicke von ca. 4 nm nicht wesentlich negativ beeinflusst werden, kommt es vorliegend mit Blick auf die angegriffenen Ausführungsformen nicht an. Jedenfalls bei einer 1 bis 2 nm dünnen SiOx-Zwischenschicht kann unter Zugrundelegung der Ausführungen des Gerichtsgutachters sowohl eine signifikante Verringerung des Feldeffekts als auch eine nennenswerte negative Beeinflussung der chemischen Passivierung und damit eine signifikante negative Beeinflussung der Passiviereigenschaften ausgeschlossen werden.
- f)
Diesem Auslegungsergebnis stehen weder die Äußerungen der US-Trade-Commission im ITC-Verfahren noch die Entscheidung des Federal Court of Australia noch die von der Beklagten angeführte Äußerungen der früheren Patentinhaberin im Einspruchsverfahren entgegen. - aa)
Soweit sich die Beklagte erstinstanzlich auf Äußerungen der US-Trade-Commission im ITC-Verfahren bezogen hat, ist das Landgericht nicht nur zutreffend unter Verweis auf die Rechtsprechung des Senats (GRUR-RR 2020, 137 Rn. 131 f. – Bakterienkultivierung) davon ausgegangen, dass es sich hierbei allenfalls um eine sachverständige Äußerung handelt, die das Verletzungsgericht zwar zur Kenntnis zu nehmen hat, die aber rechtlich nicht bindet. Die Kammer hat darüber hinaus auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich bei dem dieser Äußerung zugrunde liegenden US-Patent um ein anderes Schutzrecht handelt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil, denen der Senat beitritt, wird daher zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Auch die Beklagte ist auf den betreffenden Themenkreis im Berufungsverfahren nicht mehr zurückgekommen. - bb)
Entsprechendes gilt für die von der Beklagten im Berufungsrechtszug angeführte Entscheidung des Federal Court of Australia, von der die Beklagte entgegen Ziffer 4 a) der prozessleitenden Verfügung vom 23.09.2020 (Bl. 396 GA) keine deutsche Übersetzung vorgelegt hat und zu deren Einzelheiten sie auch schriftsätzlich nichts vorgetragen hat. Auch bei diesem Urteil handelt es sich allenfalls um eine sachverständige Äußerung, die der Senat zur Kenntnis zu nehmen hat, die ihn aber rechtlich in keiner Weise bindet. - Die Klägerin hat zu dieser Entscheidung angemerkt, dass sich sowohl die Ansprüche als auch die Patentbeschreibung des australischen Patents vom Klagepatent unterscheiden und z.B. der Aufsatz von K et al. (2007) dort nicht als Stand der Technik gewürdigt wird, weshalb das australische Gericht weder diese Publikation noch die in diesem Dokument erwähnten Aufsätze von K et al. (2006) und J et al. zur Auslegung herangezogen habe. Dem ist die Beklagte nicht entgegengetreten, so dass schon aus diesem Grund eine erhebliche Abweichung gegenüber dem Klagepatent besteht.
- Dem von der Beklagten zu den Akten gereichten Urteil ist im Übrigen zu entnehmen, dass auch das australische Gerichts davon ausgeht ist, dass die Entstehung eines „natürlichen Oxid“ („native silicon oxid“) dem Fachmann (als „background knowledge“) bekannt war (Anlage TW-B 15 Rn. 125). Allerdings nimmt das australische Gericht – soweit ersichtlich – an, dass der Fachmann die Entfernung der Oxid-Schicht im Wege einer Reinigung als notwendiges Erfordernis („requirement“) der patentgemäßen Lehre erkennt, auch wenn die Beschreibung diese – wie im Klagepatent – semantisch als optional („can be thoroughly cleaned“) beschreibt (Anlage TW-B 15 Rn. 145). Die Beschreibung des Entstehens einer dünnen Oxid-Schicht bei L et al. hat der Federal Court of Australia als nicht hilfreich zur Auslegung des Merkmals „an einer Oberfläche“ („on a surface“) angesehen (Anlage TW-B 15 Rn. 173) und es als fernliegend betrachtet, dass der Fachmann hieraus herleiten würde, dass es dem Patent gerade nicht auf die Entfernung jeglicher Oxid-Schicht von der Oberfläche der Silizium-Substrats ankomme (Anlage TW-B 15 Rn. 170). Diese Argumentation gleicht – soweit ersichtlich – im Wesentlichen derjenigen der Beklagten im hiesigen Verletzungsrechtsstreit. Diese vermag den Senat in Bezug auf das Klagepatent aus den vorstehend dargelegten Gründen jedoch nicht zu überzeugen. Das von der Klägerin vorgelegte Urteil des australischen Gerichts gibt daher keinen Anlass zu einer anderweitigen Auslegung des Klagepatentanspruchs.
- cc)
Soweit die Beklagte auf eine Äußerung der Klägerin im Einspruchsverfahren verweist, handelt es sich bei dieser – nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin – um eine solche der damaligen (Mit-)Patentinhaberin V. Äußerungen des Anmelders im Erteilungsverfahren können zwar als Indiz dafür heranzuziehen sein, wie der Fachmann den Gegenstand des Patents versteht (BGH, NJW 1997, 3377, 3380 – Weichvorrichtung II; GRUR 2016, 921 Rn. 39 – Pemetrexed; BGH, Urt. v. 17.12.2020 – X ZR 15/19, GRUR-RS 2020, 42976 Rn. 26 – L-Aminosäureproduktion; OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.03.2015 – I-2 U 16/14, GRUR-RS 2015, 05649 – Antifolat; Urt. v. 01.02.2018 – I-2 U 33/15, GRUR-RS 2018, 11286 Rn. 86 – Polysiliziumschicht; GRUR-RR 2020, 137 Rn. 123 ff. – Bakterienkultivierung; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 87 – Unterbauleiste; GRUR-RR 2023, 101 Rn. 60 – elektrohydraulisches Pressgerät). Entsprechendes gilt für Äußerungen des Patentinhabers im Rechtsbestandsverfahren (Senat, Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 9/21, GRUR-RS 2021, 39586 Rn. 62 – Halterahmen III). Vorliegend kann der von den Beklagten angeführten Stellungnahme der früheren Patentinhaberin jedoch keine maßgebliche indizielle Bedeutung für das Verständnis des Merkmals 1.2 beigemessen werden. Zum einen bezieht sie sich diese Äußerung unmittelbar nur auf die Anbringung der zweiten Dielektrikumschicht auf der Aluminiumoxidschicht und damit auf das Merkmal 1.3. Zum anderen setzt sich die damalige Patentinhaberin nicht näher mit der Formulierung bzw. dem Teil-Merkmal „an einer Oberfläche“ im Rahmen der Lehre des Klagepatents auseinander. Schließlich liegt hier mit dem vom Senat eingeholten Sachverständigengutachten eine gegenteilige sachverständige Stellungnahme vor, die das vom Senat gefundene Auslegungsergebnis bestätigt. - 3.
Die durch die Beklagte zunächst in den Mittelpunkt ihres Verteidigungsvorbringens gerückte Freiheit von „Pinholes“ liegt außerhalb der Erfindung. - Zwar hebt die Klagepatentbeschreibung im Abs. [0035] die Abwesenheit von „Pinholes“ als eine (von mehreren) wesentlichen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Solarzelle hervor. Dies geschieht allerdings ausdrücklich mit Blick auf die in der Patentbeschreibung abgehandelten Ausführungsformen der Erfindung, wenn es heißt: „Zusammenfassend zeichnet sich die Solarzelle gemäß Aspekten und Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung gegenüber bereits bekannten beschichteten Solarzellen unter anderem durch die folgenden Punkte aus: …“. Die nachfolgende Auflistung von Vorzügen reflektiert daher die in der Patentbeschreibung erörterten bevorzugten Ausführungsvarianten und erlaubt mit diesem Inhalt keine einschränkende Interpretation in Bezug auf diejenige Solarzelle, die – von allen vorteilhaften Ausstattungsvarianten befreit – lediglich den technischen Anweisungen des Patentanspruchs 1 folgt. Auch bezeichnet das Klagepatent die Entstehung besagter „Pinholes“ nicht generell als problematisch, sondern richtet seine Kritik gegen „Pinholes“, die in großer Anzahl bei einzelnen aus dem Stand der Technik bekannten Verfahren auftreten (Abs. [0005]).
- Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Patentanspruchs gehört, entscheidet sich im Übrigen danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (Art. 69 EPÜ). Die Einbeziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf nicht zu einer sachlichen Einengung oder inhaltlichen Erweiterung des durch seinen Wortlaut und Wortsinn festgelegten Gegenstands führen (BGH, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2007, 778 – Ziehmaschinenzugeinheit). Genau das verlangt die Beklagte hier jedoch mit ihrer Forderung nach der Freiheit der Schichten von „Pinholes“, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden hat. Weisen einzelne oder alle Schichten einer Solarzelle daher entsprechende „Pinholes“ auf, steht dies einer Verwirklichung der unter Schutz gestellten technischen Lehre nicht entgegen.
- C.
- Ausgehend von diesen Überlegungen machen die angegriffenen Ausführungsformen wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch.
- 1.
Dass die angegriffenen Solarzellen über ein Siliziumsubstrat (Merkmale 1. und 1.1.) verfügen, hat die Beklagte ebenso wenig in Abrede gestellt wie das Vorhandensein (mindestens) zweier Dielektrikumschichten auf der lichtabgewandten Rückseite. Auch steht zwischen den Parteien nicht in Streit, dass eine dieser Schichten Aluminiumoxid enthält und eine Dicke von weniger als 50 nm aufweist (Merkmale 3.1. und 3.2.). Auf der Oberfläche dieser Schicht ist unstreitig eine weitere, mehr als 50 nm dicke Schicht aus Siliziumnitrid angeordnet, in die Wasserstoff eingelagert ist (Merkmalsgruppe 4.). - 2.
Die bei den angegriffenen Ausführungsformen zwischen der Oberfläche der lichtabgewandten Rückseite des Siliziumsubstrats und der aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht zu findende Siliziumoxidschicht, die nach den eigenen Angaben der Beklagten nur 1 bis 2 nm dick ist, führt selbst dann nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, wenn es sich dabei um eine aus Siliziumdioxid bestehende Dielektrikumschicht handelt. Den Einsatz einer Siliziumdioxidschicht als Passivierschicht sieht das Klagepatent nicht per se als nachteilig an, sondern kritisiert lediglich den mit den im Stand der Technik beim Aufbringen der Schicht zum Einsatz kommenden Hochtemperaturverfahren verbundenen Mehraufwand und die dabei bestehende Gefahr von materialbedingten Wirkungsgradverlusten (Abs. [0003] f.). Abgesehen davon werden die alumuminiumoxid- und die wasserstoffhaltigen Dielektrikumschichten durch das Vorsehen einer weiteren Schicht in der Terminologie des Klagepatents weder zu einer „zweiten“ bzw. „dritten“ Dielektrikumschicht, noch befindet sich die aluminiumoxidhaltige Schicht nicht mehr an der Oberfläche des Siliziumsubstrats. - a)
Im Kern stellt das Klagepatent eine Solarzelle unter Schutz, deren Siliziumsubstrat mit einer aus zwei Teilschichten zusammengesetzten dielektrischen Passivierschicht beschichtet ist. Bei diesen aus unterschiedlichen Materialien bestehenden Teilschichten handelt es sich um eine sehr dünne aluminiumoxidhaltige Dielektrikumschicht und um eine dickere Dielektrikumschicht, in die Wasserstoff eingelagert ist (vgl. auch Abs. [0013]). Diese Schichten bezeichnet Patentanspruch 1 folgerichtig als erste und zweite Dielektrikumschicht, die in ihrem Zusammenwirken letztlich die angestrebte Passivierwirkung bereitstellen. Selbst wenn es sich bei der durch die Beklagte in den Mittelpunkt ihres Verteidigungsvorbringens gestellten Silizium(di)oxidschicht ebenfalls um eine Dielektrikumschicht handelt (was an dieser Stelle nicht entschieden zu werden braucht), ändert dies nichts an der Klassifizierung der anderen Schichten als erste und zweite Dielektrikumschicht. Einzig stellt sich vielmehr die Frage, welche Eigenschaften eine ggf. zwischen dem Siliziumsubstrat und der aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht zu findende zusätzliche Schicht aufweisen darf. - b)
Wie oben bereits festgestellt, führt eine weitere, zwischen dem Siliziumsubstrat und der aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht angeordnete Schicht nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, solange sie den mit den anderen Schichten implementierten Wirkmechanismus nicht in Frage stellt. Eine solche zusätzliche Schicht ist daher so lange unschädlich, wie sie weder die mit der aluminiumoxidhaltigen Dielektrikumschicht angestrebte Feldeffektpassivierung noch die Anlagerung des in der weiteren Dielektrikumschicht zu findenden Wasserstoffs an freie, an der Grenzfläche zur Siliziumschicht zu findende Bindungsstellen des Siliziums („dangling bonds“) verhindert bzw. signifikant negativ beeinflusst. Dies ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedenfalls bei einer Oxid-Schicht in der Größenordnung von 1 bis 2 nm, wie sie bei den angegriffenen Ausführungsformen vorliegt, nicht der Fall. - 3.
Soweit die Beklagte sich in der mündlichen Verhandlung vom 06.06.2024 im Anschluss an die Sachverständigenanhörung unter Verweis auf die Abbildung 10 ihres Privatgutachtens Anlage TW 22 erstmals auf den Standpunkt gestellt hat, dass die angegriffenen Ausführungsformen nicht patentverletzend seien, da die erste Schicht keine reine Aluminiumoxidschicht sei, verfängt dies nicht. Es steht nach den eigenen – privatgutachterlich gestützten – Ausführungen der Beklagten nicht in Streit, dass diese Schicht bei beiden angegriffenen Ausführungsformen Aluminium und Sauerstoff enthält (vgl. Duplik v. 20.04.2020, S. 18 [Bl. 127 GA]). Mehr verlangt der Patentanspruch 1 im Hinblick auf die Materialzusammensetzung auch nicht, so dass der Frage, ob und welche anderen Materialen in der Schicht bei den angegriffenen Ausführungsformen ebenfalls enthalten sind, nicht weiter nachgegangen werden muss. Zwar hat der Sachverständige bei seiner Anhörung angegeben, dass eine aluminiumoxidhaltige Schicht nach seinem Fachverständnis im Wesentlichen Aluminiumoxid – also nur Aluminium und Sauerstoff – beinhaltet, damit die Eigenschaft der negativen Ladung gewährleistet ist (vgl. Prot. v. 06.06.2024, S. 13 a.E.). Patentanspruch 1 spricht indes allein davon, dass die erste Dielektrikumschicht Aluminiumoxid aufweist, so dass weitere Bestandteile gestattet sind (vgl. z.B. Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Abschn. A Rn. 30). Eine reine Aluminiumoxidschicht verlangt Patentanspruch 1 seinem Wortlaut nach nicht. Für ein Erfordernis einer vollständig reinen Aluminiumoxidschicht finden sich auch in der Klagepatentbeschreibung keine Anhaltpunkte und hierfür ist auch kein funktionaler Grund erkennbar, solange die Feldeffektpassivierung und das Diffundieren von Wasserstoff nicht signifikant negativ beeinträchtigt wird. Entsprechendes hat die Beklagte indes weder behauptet noch unter Beweis gestellt und hierfür ist auch ansonsten nichts ersichtlich. - D.
- Hiervon ausgehend hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland zu Recht eine unmittelbare wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG gesehen. Dass die Beklagte im Hinblick auf diese Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung, zur Vernichtung und zum Rückruf verpflichtet ist, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Die entsprechenden Ansprüche der Klägerin folgen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 und 3 PatG. Auf die diesbezüglichen, von der Berufung nicht gesondert angegriffenen Ausführungen des Landgerichts wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen mit der Maßgabe, dass die Rückrufverpflichtung der Beklagten für ab dem 30.01.2020 in Verkehr gebrachte patentverletzende Erzeugnisse gilt.
- E.
- Zu einer Aussetzung der Verhandlung (§ 148 ZPO) bis zu einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentsamts besteht keine Veranlassung.
- 1.
Wenn das Klagepatent mit einem Einspruch oder mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, zum Rückruf sowie zur Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet es, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff auf den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung bzw. durch Erhebung eines Einspruchs führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent dem erhobenen Einspruch/der anhängigen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237 Rn. 4 – Kurznachrichten). - Wurde das Klagepatent bereits – wie hier – in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestätigt, so hat das Verletzungsgericht grundsätzlich die von der zuständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Klagepatents hinzunehmen. Grund, die parallele Rechtsbestandsentscheidung in Zweifel zu ziehen und von einer Verurteilung vorerst abzusehen, besteht nur dann, wenn das Verletzungsgericht die Argumentation der Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanz für nicht vertretbar hält oder wenn der Angriff auf den Rechtsbestand nunmehr auf (z. B. neue) erfolgversprechende Gesichtspunkte gestützt wird, die die bisher mit der Sache befassten Stellen noch nicht berücksichtigt und beschieden haben (st. Rspr. des Senats, vgl. z.B. Urt. v. 25.08.2022 – I-2 U 31/18, GRUR-RS 2022, 21391 Rn. 76 – Faserstrangherstellung, m.w.N.).
- 2.
Hiervon ausgehend besteht im Streitfall kein Anlass zu einer Aussetzung der Verhandlung bis zu einer Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren. - Die Einspruchsabteilung hat das Klagepatent im Umfang der im Verletzungsverfahren streitgegenständlichen Anspruchsfassung für rechtsbeständig erachtet. Damit überwiegt nunmehr das berechtigte Interesse der Klägerin daran, ihre Verbietungsrechte aus dem Klagepatent zügig gegen die Beklagte durchzusetzen. Das gilt umso mehr, weil sich das Einspruchsverfahren bereits geraume Zeit hinzieht und der Klägerin – trotz der Tatsache, dass sie über einen vorläufig vollstreckbaren Titel verfügt – ein weiteres Abwarten auf die Beschwerdeentscheidung nicht zuzumuten ist. Angesichts der vorliegenden Entscheidungsgründe der Einspruchsentscheidung überzeugen die von der Beklagten für eine überwiegende Vernichtungswahrscheinlichkeit angeführten Gründe – mangelnde Ausführbarkeit und Erfindungshöhe – den Senat nicht in dem für eine Aussetzung gebotenen Maße.
- a)
Die dem Senatsurteil zugrunde liegende Patentauslegung steht – wie oben im Zusammenhang mit dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit erörtert – der Ausführbarkeit der Erfindung für einen Durchschnittsfachmann nicht entgegen. Sie ist im Übrigen schon mit Rücksicht auf die Ausführungsbeispiele der Klagepatentschrift gegeben und müsste darüber hinaus nicht einmal über die gesamte Breite des Patentanspruchs bestehen. - b)
Die JP 2007-234XXE (PS92; Anlage TW-B 7/7a), auf die die Beklagte ihren Rechtsbestandsangriff zuletzt maßgeblich gestützt hat, hat der Einspruchsabteilung bei ihrer Entscheidung vorgelegen und ist von dieser auch gewürdigt worden (vgl. Rn. 8.7.12 ff. der Entscheidungsgründe der Einspruchsabteilung). Diese Würdigung hat der Senat zu respektieren, solange sie nicht auf – dem Verletzungsgericht einsichtigen – offensichtlich falschen Annahmen oder Schlussfolgerungen beruht. Solches ist nicht zu erkennen. - aa)
Die PS92 offenbart eine Solarzelle mit einer – z.B. Aluminiumdioxid enthaltenen (Abs. [0030]) – Inversionsverhinderungsschicht (13) an der Rückseite, die zwischen dem Siliziumsubstrat (1) und einer Siliziumnitrit-Schicht (11) eingebettet ist (Abs. [0028]). - (1)
Die Einspruchsabteilung hat angenommen, dass diese Entgegenhaltung bis auf das Merkmal 3.2. alle Merkmale des Patentanspruchs 1 offenbart (Rn. 8.7.17 der Entscheidungsgründe). Soweit sie das Merkmal 3.2. als nicht offenbart angesehen hat, trifft dies zu. Denn unmittelbar und eindeutig offenbart ist in der PS92 nur eine Inversionsverhinderungsschicht aus Aluminiumoxid mit einer Dicke von 80 nm, und zwar in Abs. [0044]. - (2)
Soweit die Einspruchsabteilung angenommen hat, dass der Fachmann ausgehend von der PS92 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gelangt (Rn. 8.7.21 der Entscheidungsgründe), erscheint diese Würdigung vertretbar. - In ihrer Beschreibung schlägt die PS92 zunächst eine Siliziumnitrit-Schicht (11) mit einer Dicke von ungefähr 80 nm vor (Abs. [0028]). Als Beispiele für das Schichtmaterial der Inversionsverhinderungsschicht (13) schlägt sie sodann mehrere Materialen vor, so u.a. Aluminiumoxid (Abs. [0029]). Im Weiteren wird im Beschreibungstext der PS92 „das Prinzip der Erfindung“ gemäß der PS92 anhand der Zeichnungen erläutert (Abs. [0032]). Unter Bezugnahme auf Figur 1 wird u.a. ausgeführt, dass zwischen der Rückelektrode (12) und der Siliziumnitrit-Schicht (11) eine dritte Struktur, nämlich eine Inversionsverhinderungsschicht (13), z.B. aus Aluminiumoxid, eingefügt ist (Abs. [0037]). Zur Dicke dieser Schicht wird in diesem Zusammenhang nichts gesagt. Im weiteren Beschreibungstext beschreibt die PS92 ein Ausführungsbeispiel, bei dem auf der Rückseite des Siliziumsubstrats eine Inversionsverhinderungsschicht (13) aus Aluminiumoxid mit einer Dicke von 80 nm abgeschieden wird. Im Anschluss wird eine Siliziumnitrit-Schicht (11) mit einer Dicke von ebenfalls 80 nm auf der gesamten Rückseite abgeschieden (Abs. [0044]).
- Soweit die Einspruchsabteilung angenommen hat, der PS92 selbst – insbesondere deren Abs. [0030]), in dem es lediglich heißt, dass sich die Effekte der p+-Schicht stark in Abhängigkeit von den Schichtbildungsverfahren und den Bedingungen ändern – lasse sich keine Anregung entnehmen, die Schichtdicken als solche zu verändern, erscheint dies zumindest vertretbar. Ebenso erscheint die weitere Annahme der Einspruchsabteilung, dass auch der Stand der Technik dem Fachmann keine alternative Schichtdicke aufzeige, die in dem gegebenen Anwendungsfall, also als Inversionsverhinderungsschicht unter einer Siliziumnitrit-Schicht mit positiven Ladungen zu einer ausreichenden Feldabschirmung führe, nicht offensichtlich falsch. Unabhängig davon stellt sich angesichts des Offenbarungsgehalts der PS92 die Frage, weshalb der Fachmann ausgehend von dieser Entgegenhaltung überhaupt eine Inversionsverhinderungsschicht aus Aluminiumoxid mit einer Dicke wählen sollte, die eine geringere
Dicke als die die zweite Dielektrikumschicht hat. - bb)
Die Beurteilung der Einspruchsabteilung, dass sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht durch eine Kombination der Entgegenhaltungen PS54 (Schmidt et al.; Anlage TW 16/16a) und PS2 (K et al. (2006), Anlage K 19/19a bzw. TW 17/17a) bzw. PS25 (K, APL 89, 2006) nahegelegt ist (vgl. Rn. 7.74 der Entscheidungsgründe), ist ebenfalls nicht unvertretbar. Sollte der Fachmann eine Kombination der Lehren dieser Druckschriften tatsächlich in Erwägung ziehen, erscheint vielmehr die Annahme der Einspruchsabteilung, er werde in diesem Fall der PS2 die Aluminiumoxid-Schicht entnehmen und hiermit den (gesamten) Schichtstapel der PS54 ersetzen, nicht aber über der Aluminiumoxid-Schicht eine weitere Siliziumnitrid-Schicht anordnen, plausibel. - III.
- Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
- Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
- Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).