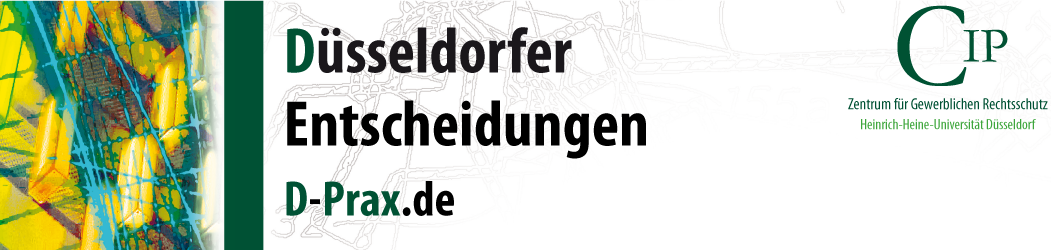Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3346
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 24. Mai 2024, I-2 U 20/19
Vorinstanz: 4c O 58/18
- A. Auf die Berufung der Beklagten wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 21.02.2019 verkündete Urteil der
4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: - I. Es wird festgestellt,
- dass der Klageantrag,
- die Beklagte zu verurteilen,
- es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
- ein Handwerkzeug, das einen Antriebszylinder mit einem einseitig wirkenden Arbeitskolben aufweist, der bei Druckentlastung von einer Rückstellfeder in seine Ausgangsstellung zurückgeschoben wird, sowie für den Antrieb des Antriebszylinders eine aus einem Tank gespeiste Pumpe und für den Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank eine Rückströmleitung aufweist, in der ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung angeordnet ist, wobei die Pumpe durch einen elektrischen Pumpenmotor angetrieben wird, in dessen Versorgungsleitung ein Leistungsschalter angeordnet ist,
- welches dazu geeignet ist, ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen auszuführen,
- wenn das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Pumpenmotor derart stromabhängig durch einen Mikroprozessor angesteuert wird, dass die Stromaufnahme des Pumpenmotors und der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils vom Mikroprozessor erfasst werden und dass der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter unterbrochen wird,
- Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,
- ohne
- – im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Patents EP 1 230 XXA für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, verwendet werden darf;
- – im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Patentinhaberin zu zahlenden angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Patentinhaberin für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, zu verwenden, das die vorstehend aufgelisteten Merkmale aufweist,
- in der Hauptsache erledigt ist.
- II. Die Beklagte wird verurteilt,
- 1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu I. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 10.09.2019 bis zum 10.01.2022 begangen hat, und zwar unter Angabea) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der vorstehend in l. beschriebenen
Erzeugnisse, - b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse
bestimmt waren, - c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen
oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, - wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie
vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen; - 2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. bezeichneten Handlungen in der Zeit vom 10.09.2019 bis zum 10.01.2022 begangen hat, und zwar unter Angabea) der Herstellungsmengen und -zeiten,
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
- c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen,
sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger, - d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und
Verbreitungsgebiet, - e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
- III. Es wird festgestellt,
- 1. dass der weitergehende Auskunftsantrag (Zeitraum vom 21.11.2009 bis zum 09.09.2019) in der Hauptsache erledigt ist;
- 2. dass der weitergehende Rechnungslegungsantrag (Zeitraum vom 21.11.2009 bis zum 09.09.2019) in der Hauptsache erledigt ist.
- IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die in Ziffer I. bezeichneten, in der Zeit vom 21.11.2009 bis 10.01.2022 begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.
- V. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- B. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin zu 4 % und die Beklagte zu 96 %.
- C. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
- Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,- Euro abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
- Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile erster und zweiter Instanz vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
- D. Die Revision wird nicht zugelassen.
- E. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 613.000,- Euro festgesetzt, wovon 600.000,- Euro auf die Berufung der Beklagten und 13.000,- Euro auf die Anschlussberufung der Klägerin entfallen.
- Gründe:
- I.
- Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des europäischen Patents 1 230 XXA (nachfolgend: Klagepatent). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte noch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung für die Zeit seit dem 10.09.2019, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch. Zudem begehrt sie hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens sowie ihrer Begehren auf Auskunft und Rechnungslegung jeweils für die Zeit bis zum 09.09.2019 die Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache, nachdem ihre insoweit in zweiter Instanz abgegebene Erledigungserklärung einseitig geblieben ist.
- Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 10.01.2002 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 12.01.2001 eingereicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 21.10.2009 im Patentblatt bekannt gemacht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 10.01.2022 – während des Berufungsrechtszugs – infolge Zeitablaufs erloschen.
- Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hy-draulischen Handwerkzeugen und eine Anordnung hierfür. Der im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:
- „Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, wobei das Handwerkzeug einen Antriebszylinder (1) mit einem einseitig wirkenden Arbeitskolben (2) aufweist, der bei Druckentlastung von einer Rückstellfeder (3) in seine Ausgangsstellung zurückgeschoben wird, sowie für den Antrieb des Antriebszylinders (1) eine aus einem Tank (7) gespeiste Pumpe (5) und für den Rückfluß der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank (7) eine Rückströmleitung (8) aufweist, in der ein vorgesteuertes Überdruckventil (9) mit Hysteresewirkung angeordnet ist, wobei die Pumpe (5) durch einen elektrischen Pumpenmotor (12) angetrieben wird, in dessen Versorgungsleitung (13) ein Leistungsschalter (14) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenmotor (12) derart stromabhängig durch einen Mikroprozessor (15) angesteuert wird, daß die Stromaufnahme des Pumpenmotors (12) und der Stromabfall nach dem Öffnen des überdruckventils (9) vom Mikroprozessor (15) erfaßt werden und daß der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter (14) unterbrochen wird.“
- Die nachfolgend wiedergegebenen Fig. 1 und 2 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Fig.1 zeigt ein Schaltbild einer Anordnung zum Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen zum Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen und Fig. 2 zeigt Kurvendarstellungen der Stromverläufe bei verschiedenen Betriebszuständen über die Zeit.
- Eine von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht durch Urteil vom 24.09.2019 abgewiesen (5 Ni 14/18 (EP), Bl. 380 ff. GA, nachfolgend: BPatG-Urteil). Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 07.12.2021 zurückgewiesen (X ZR 113/19, Anlage BK 8, nachfolgend: BGH-Urteil).
- Die Beklagte befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen und Werkzeugen für die Rohrbearbeitung. Sie stellt her und vertreibt unter der Bezeichnung „B“ ein Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf, das für die Herstellung von Pressverbindungen verwendet wird (angegriffene Ausführungsform).
- Als Anlage B 5 hat die Klägerin eine u. a. die angegriffene Ausführungsform betreffende Bedienungsanleitung vorgelegt. In dieser heißt es in Ziff. 3.1.1 zur angegriffenen Ausführungsform auszugsweise: „Nach vollendeter Pressung schaltet die Antriebsmaschine automatisch auf Rücklauf um und schaltet dann aus (Zwangsablauf)“.
- Der grundsätzliche Aufbau des Antriebszylinders der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aus den nachfolgend wiedergegebenen, von der Beklagten mit Beschriftungen versehenen Fotografien (Anlage B-B5):
- Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents.
- Mit Anwaltsschreiben vom 25.08.2017, wegen dessen Einzelheiten auf die Anlage B 8 Bezug genommen wird, mahnte sie die Beklagte erfolglos ab.
- Mit ihrer Klage hat die Klägerin hat die Beklagte zunächst wegen unmittelbarer Patentverletzung in Anspruch genommen. Nach einem Hinweis des Landgerichts, wonach auf der Grundlage des Vortrags der Klägerin nicht ersichtlich sei, dass die Beklagte das beanspruchte Verfahren selbst in der Bundesrepublik Deutschland angewendet und/oder zur Anwendung angeboten habe, hat die Klägerin ausgeführt, sie gehe weiterhin von einer unmittelbaren Verletzung des Verfahrensanspruchs aus, da die Beklagte das streitgegenständliche Verfahren mindestens bei der Funktionsprüfung der angegriffenen Ausführungsform selbst ausgeführt habe. Hilfsweise stütze sie ihre Klage auf eine mittelbare Patentverletzung. Im Verhandlungstermin vor dem Landgericht am 17.01.2019 hat die Klägerin ihre Klage zurückgenommen, soweit sie mit dieser eine Verurteilung der Beklagten wegen unmittelbarer Patentverletzung begehrt hat.
- Zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform hat die Klägerin in erster Instanz unter anderem vorgetragen, dass sich in verschiedenen Messversuchen gezeigt habe, dass die angegriffene Ausführungsform die Motorspannung und den Motorstrom überwache, da stets nach Abfall des Motorstroms der Motor automatisch ausgeschaltet worden sei. Sollte die angegriffene Ausführungsform jedoch, wie von der Beklagten behauptet, nur die Motorspannung detektieren und überwachen, spiele dies für die Verwirklichung der Lehre des Klagepatents keine Rolle. Der Fachmann könne – insoweit unstreitig – ohne weiteres aufgrund seines Fachwissens und unter Anwendung einer allgemein bekannten Formel von der Spannung auf den Stromwert und umgekehrt schließen.
- Die Beklagte, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens gebeten hat, hat eine Patentverletzung in Abrede gestellt. Zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform hat sie unter anderem geltend gemacht, diese überwache nicht den Motorstrom, sondern nur die (Akku-)Spannung, um den Motor nach Beendigung des Pressvorgangs auszuschalten. Außerdem hat sie in erster Instanz die „Einrede der Verjährung/Verwirkung“ erhoben.
- Durch Urteil vom 21.02.2019 hat das Landgericht dem Klagebegehren nach den zuletzt noch gestellten Anträgen weitgehend entsprochen, wobei es die Kosten des Rechtsstreits den Parteien je zur Hälfte auferlegt hat. Im Einzelnen hat es wie folgt erkannt:I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
- ein Handwerkzeug, das einen Antriebszylinder mit einem einseitig wirkenden Arbeitskolben aufweist, der bei Druckentlastung von einer Rückstellfeder in seine Ausgangsstellung zurückgeschoben wird, sowie für den Antrieb des Antriebszylinders eine aus einem Tank gespeiste Pumpe und für den Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank eine Rückströmleitung aufweist, in der ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung angeordnet ist, wobei die Pumpe durch einen elektrischen Pumpenmotor angetrieben wird, in dessen Versorgungsleitung ein Leistungsschalter angeordnet ist,
- welches dazu geeignet ist, ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen auszuführen,
- wenn das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Pumpenmotor derart stromabhängig durch einen Mikroprozessor angesteuert wird, dass die Stromaufnahme des Pumpenmotors und der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils vom Mikroprozessor erfasst werden und dass der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter unterbrochen wird,
- Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,
- ohne
- – im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Patents EP 1 230 XXA für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, verwendet werden darf;
- – im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Patentinhaberin zu zahlenden angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Patentinhaberin für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, zu verwenden, das die vorstehend aufgelisteten Merkmale aufweist.
- II. Die Beklagte wird weiter verurteilt, der Klägerin in einer geordneten Aufstellung darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie jeweils die unter l. genannten Verletzungshandlungen durch das Anbieten bzw. die Lieferung der B seit dem 21. November 2009 begangen hat, und zwar, soweit zutreffend, unter Angabea) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der vorstehend in l. beschriebenen Erzeugnisse,
- b) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der
Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren, - c) die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
- III. Die Beklagte wird weiter verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie jeweils die unter l. genannten Verletzungshandlungen durch das Anbieten bzw. die Lieferung der B seit dem 21. November 2009 begangen hat, und zwar, soweit zutreffend, unter Angabea) der Herstellungsmengen und -zeiten,
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
- c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger, - d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
- IV. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr aufgrund der Verletzungshandlungen nach l. seit dem 21. November 2009 entstanden sind und noch entstehen werden.
- V. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin Abmahnkosten in Höhe von Euro 10.916,22 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19. Januar 2018 zu zahlen.
- VI. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
- Durch das Anbieten und Liefern der angegriffenen Ausführungsform verletze die Beklagte das Klagepatent mittelbar im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG.
- Die angegriffene Ausführungsform weise ein in der Rückströmleitung angeordnetes, vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung auf. „Vorgesteuert“ bedeute nicht, dass das Überdruckventil kontinuierlich oder jedenfalls für jeden einzelnen Pressvorgang eingestellt, d. h. gesteuert werden könne. Der Begriff sei vielmehr dahingehend zu verstehen, dass das Überdruckventil zu einem Zeitpunkt vor der Verwendung des Handwerkzeugs zumindest einmal (vor)eingestellt worden sei, um bei einem bestimmten Druck zu öffnen. Die angegriffene Ausführungsform verfüge über ein mehrteiliges Überdruckventil mit einer Vorsteuer- und einer Hauptsteuerstufe, dessen Vorsteuerstufe mittels einer Schraubendruckfeder und eines Schraubenkopfes in die radiale Gewindebohrung in der Wandung des Antriebszylinders geschraubt werde, und die im Antriebszylinder angeordnet sei. Der zur Öffnung der Vorsteuerstufe und damit auch der Hauptsteuerstufe erforderliche Druck hänge davon ab, wie weit der Schraubenkopf eingeschraubt werde. Dadurch werde das Überdruckventil „voreingestellt“. Das Überdruckventil befinde sich auch in der Rückströmleitung. Denn jedenfalls die Hauptsteuerstufe – und damit ein wesentlicher Teil des aus mehreren Komponenten bestehenden Überdruckventils – sei in dieser angeordnet. Schließlich verfüge das Überdruckventil auch über eine Hysteresewirkung. Selbst wenn das Vorsteuerventil nur für einen kurzen Zeitraum öffne und sich dann umgehend wieder schließe, bleibe das Hauptsteuerventil auch dann geöffnet, wenn der Druck weiter abnehme.
- Die angegriffene Ausführungsform entspreche auch der weiteren Vorgabe des Patentanspruchs 1, wonach der Motor der Pumpe ausgeschaltet (gesteuert) und damit die weitere Förderung von Hydraulikflüssigkeit aus dem Tank in den Antriebszylinder unterbunden werde, wenn das Überdruckventil geöffnet sei und der Motor weniger Strom zur Förderung der Hydraulikflüssigkeit benötige. Insoweit müsse die Elektronik des Handwerkzeugs den Strombedarf derart überwachen, dass ein Stromabfall bemerkt werde. Zugleich erkenne der Fachmann, dass der Motorstrom erst bei Erreichen eines niedrigeren, vorbestimmten Wertes ausgeschaltet werde, er insoweit noch etwas nachlaufe. Dies bedinge jedenfalls die weitere (kurzzeitige) Überwachung des Stromverlaufs nach Erreichen einer maximalen Stromstärke. Dazu, wie der Strom zu überwachen bzw. zu bestimmen sei, mache das Klagepatent keine weiteren Angaben. In der angegriffenen Ausführungsform werde nach den eigenen Angaben der Beklagten die (Akku-)Spannung erfasst und die erfassten Daten würden genutzt, um die Presse bei Erreichen einer bestimmten Spannung abzuschalten. Zwischen den Parteien sei im Rahmen der mündlichen Verhandlung unstreitig gewesen, dass der Fachmann ohne weiteres unter Anwendung einer ihm auf Grund seines Fachwissens bekannten Gleichung von einem Spannungswert auf einen bestimmten Stromwert schließen könne und umgekehrt. Aus diesem unmittelbaren und eindeutigen Zusammenhang zwischen Spannung und Strom folge, dass ein Spannungswert immer mit einem Stromwert korreliere. Dies bedeute, dass das Abschalten des Motors bei einer vorbestimmten Spannung immer auch dem Abschalten des Motors bei einem vorbestimmten Stromwert entspreche, wobei aus dem unstreitigen automatischen Abschalten der angegriffenen Ausführungsform nach Abschluss des Pressvorgangs darauf geschlossen werden könne, dass in ihr ein bestimmter Spannungswert gespeichert sei.
- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie eine vollständige Abweisung der Klage erstrebt.
- Die Klägerin hat mit der Berufungserwiderung Anschlussberufung eingelegt, mit der sie sich gegen die vom Landgericht getroffene Kostenentscheidung gewendet hat. Mit Schriftsatz vom 11.12.2023 hat sie ihre Anschlussberufung zurückgenommen.
- Die Beklagte macht unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens mit ihrer Berufung geltend:
- Ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung zeichne sich, wie Abs. [0004] der Klagepatentschrift zu entnehmen sei, dadurch aus, dass es in einem Bypass angeordnet sei und eine Kegelspitze sowie einen nachgeschalteten größeren Ventilteller besitze, der nach dem Öffnen der Kegelspitze wirksam werde. Es sei zudem nur ein einziges Überdruckventil vorgesehen, über das in geöffnetem Zustand und unter der Wirkung des zurückfahrenden Arbeitskolbens das Hydraulikmedium durch das geöffnete Überdruckventil zurück zum Tank ströme. Der Bundesgerichtshof habe klare konstruktive Vorgaben an die Gestaltung des Überdruckventils gemacht und ausgeführt, dass dessen Merkmale nicht auf ihre bloße Funktion reduziert und in einem Sinne interpretiert werden dürften, der mit der den Merkmalen eigenen räumlich-körperlichen Ausgestaltung nicht mehr in Einklang stehe. Dies geschehe indes, wenn der Sachverständige ausführe, ein vorgesteuertes Überdruckventil müsse neben einem Hauptventil zwingend noch ein Pilotventil aufweisen. Das Überdruckventil der angegriffenen Ausführungsform werde diesen Anforderungen nicht gerecht. Insbesondere verfüge die angegriffene Ausführungsform – anders als es das Landgericht angenommen habe – nicht über ein „mehrteiliges“ Überdruckventil, sondern über ein eigenständiges Rückströmventil und ein eigenständiges Überdruckventil, wobei letzteres auch nicht in der Rückströmleitung, sondern radial hierzu angebracht sei, und, weil es nach dem Öffnen sofort wieder schließe, auch keine Hysteresewirkung entfalte.
- Ein (automatisches) Steuern könne entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht als bloßes Ein- und Ausschalten des Motors angesehen werden, worauf insbesondere der im Anspruch selbst angegebene Mikroprozessor einen eindeutigen Hinweis gebe. Auch aus der weiteren Vorgabe, wonach die Stromaufnahme und der Stromabfall erfasst werden müssten, sowie aus diversen Stellen der Klagepatentschrift ergebe sich, dass das Klagepatent die Erfassung eines Stromverlaufs über einen längeren Zeitraum – den gesamten Arbeitsprozess oder zumindest einen Teil der Presszeit – erfordere. Unter dem Steuern verstehe der Fachmann somit nicht nur das Ein- und Ausschalten des Motors, sondern die zeitliche Überwachung der jeweiligen Kraft beim Bearbeitungsvorgang. Der Annahme auch des Sachverständigen, wonach das bloße Bewirken eines Ein- und Ausschaltens bereits eine Steuerung bedeute, stünden zudem die Ausführungen des Bundesgerichtshofs unter Rn. 66 entgegen, wonach ein einfacher Schaltkontakt keinen Mikroprozessor mit seinen Erfassungs-, Speicher- und Vergleichsmöglichkeiten darstelle. Eine in diesem Sinne verstandene Steuerung sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht vorgesehen. Es werde lediglich überprüft, ob die Spannung einen vorgegebenen Wert überschreite. Sobald dieser Wert erreicht sei, werde der Pumpenmotor abgeschaltet. Im Unterschied zur erfindungsgemäßen Lehre spielten der Verlauf der Spannung und auch des Stroms über die Zeit keine Rolle.
- Der wesentliche Kern des Klagepatentanspruchs 1 bestehe darin, dass Voraussetzung zum automatischen Abschalten des Pumpenmotors sei, dass zuvor das Überdruckventil geöffnet habe. Der Anspruch fordere somit ausdrücklich einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Abschalten des Pumpenmotors. Auch der Bundesgerichtshof habe in seinem Urteil hervorgehoben, dass ein Kausalzusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Abschalten des Motorstroms nach Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes bestehe. Denn er führe aus, dass die Abschaltung nur dann erfolgen dürfe, wenn der erfasste Strom von einem Wert oberhalb des definierten Schwellwertes auf einen darunter liegenden Wert absinke, was allerdings nur dann möglich sei, wenn zuvor das Überdruckventil geöffnet worden sei. Auch in dem Anspruchswortlaut, der ein Erfassen des Stromabfalls nach dem Öffnen des Überdruckventils fordere, komme dieser Zusammenhang zum Ausdruck, schließlich werde ohne Öffnen des Überdruckventils kein Stromabfall erfolgen. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei ein solcher kausaler Zusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Abschalten des Pumpenmotors nicht vorhanden und werde durch den Vortrag der Klägerin auch nicht belegt. Der Pumpenmotor schalte – unabhängig vom Zustand des Überdruckventils – dann ab, wenn ein vordefinierter, von ihr, der Beklagten, im Versuch empirisch bestimmter und in der Software der angegriffenen Ausführungsform hinterlegter Grenzwert der Akkuspannung erreicht werde. Völlig unabhängig hiervon öffne das federbelastete Überdruckventil, sobald der Hydraulikdruck im Arbeitsraum am Ende eines Pressvorgangs einen bestimmten, mechanisch voreingestellten Wert des Federdrucks erreiche. Dass kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Abschalten des Pumpenmotors bestehe, werde auch durch die anhand von durchgeführten Messungen erstellten Diagramme (vorgelegt als Anlagen BK 5 = Diagramme 1, 2, 3, BK 6 = Diagramm 4) belegt.
- Soweit der Sachverständige in seinem Gutachten von einer anspruchsgemäß erforderlichen kausalen Verbindung zwischen dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes und dem Unterbrechen des Motorstroms ausgehe, komme es darauf bei dieser Merkmalsgruppe überhaupt nicht an und eine solche Kausalität sei auch nicht Gegenstand dieser Anspruchsmerkmale.
- Aus dem von der Klägerin in der Berufungsinstanz als Anlage BB 1 neu vorgelegten Prüfbericht der C Gesellschaft mbH, bei der es sich im Übrigen um eine Gesellschaft aus der Unternehmensgruppe der Klägerin handele, gehe für sie, die Beklagte, nicht überprüfbar hervor, ob das untersuchte Pressgerät eine Ausführungsform sei, die von der Klägerin als patentverletzend angesehen werde. Dies werde vorsorglich mit Nichtwissen bestritten. Überdies sei der Mikroprozessor nur auf einem der Bilder beschriftet, weshalb bestritten werde, dass die Abbildungen auf den Seiten 4 unten und 5 zusammengehörten. Außerdem belegten die im Prüfbericht beschriebenen Untersuchungen lediglich, dass das angegriffene Pressgerät bei ordnungsgemäßem Pressverlauf am Ende des Pressvorgangs abschalte, was nicht strittig gewesen sei. Soweit mit dem Prüfbericht offenbar nachgewiesen werden solle, dass bei der angegriffenen Ausführungsform nicht die Akkuspannung, sondern der Motorstrom gemessen werde, sei auf den bisherigen Vortrag zu verweisen, wonach bei der angegriffenen Ausführungsform die Akkuspannung herangezogen werde, um den Motor nach Beendigung des Pressvorgangs abzuschalten, und zwar in dem Augenblick, in dem die Akkuspannung wieder auf den Stand zum Start des Pressvorgangs abgefallen sei. Mit dem entscheidenden Punkt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform der Kausalzusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem nachfolgenden Abschalten des Pumpenmotors bei Unterschreiten eines vorgegebenen Stromwertes nicht gegeben sei, befasse sich der Prüfbericht nicht.
- Es sei nicht nachvollziehbar und begründe einen Verstoß gegen die Pflicht zur Ausschöpfung der angebotenen Beweise sowie gegen ihre, der Beklagten, prozessualen Rechte, dass der Sachverständige keine eigenen Messungen durchgeführt habe.
- Die Beklagte beantragt,
- das Urteil des Landgerichts Düsseldorf abzuändern und die Klage abzuweisen.
- Die Klägerin beantragt,
- die Berufung zurückzuweisen mit den Maßgaben, dass
- I. festgestellt werden soll,
- dass der Klageantrag,
- die Beklagte zu verurteilen,
- es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
- ein Handwerkzeug, das einen Antriebszylinder mit einem einseitig wirkenden Arbeitskolben aufweist, der bei Druckentlastung von einer Rückstellfeder in seine Ausgangsstellung zurückgeschoben wird, sowie für den Antrieb des Antriebszylinders eine aus einem Tank gespeiste Pumpe und für den Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank eine Rückströmleitung aufweist, in der ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung angeordnet ist, wobei die Pumpe durch einen elektrischen Pumpenmotor angetrieben wird, in dessen Versorgungsleitung ein Leistungsschalter angeordnet ist,
- welches dazu geeignet ist, ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen auszuführen,
- wenn das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Pumpenmotor derart stromabhängig durch einen Mikroprozessor angesteuert wird, dass die Stromaufnahme des Pumpenmotors und der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils vom Mikroprozessor erfasst werden und dass der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter unterbrochen wird,
- Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an solche zu liefern,
- ohne
- – im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Patents EP 1 230 XXA für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, verwendet werden darf;
- – im Falle der Lieferung den Abnehmern unter Auferlegung einer an die Patentinhaberin zu zahlenden angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung die schriftliche Verpflichtung aufzuerlegen, das Handwerkzeug nicht ohne Zustimmung der Patentinhaberin für ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen, zu verwenden, das die vorstehend aufgelisteten Merkmale aufweist,
- in der Hauptsache erledigt ist;
- II. der Auskunftstenor wie folgt gefasst wird:
- Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 10.09.2019 bis zum 10.01.2022 die zu I. bezeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Angabea) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der vorstehend in l. beschriebenen Erzeugnisse,
- b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
- c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
- II.a. festgestellt werden soll, dass der weitergehende Auskunftsantrag für den Zeitraum seit dem 21.11.2009 in der Hauptsache erledigt ist;
- III. der Rechnungslegungstenor wie folgt gefasst wird:
- Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 10.09.2019 bis zum 10.01.2022 die unter l. genannten Verletzungshandlungen begangen hat, und zwar unter Angabea) der Herstellungsmengen und -zeiten,
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,
-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, - c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
- d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- III.a. festgestellt werden soll, dass der weitergehende Rechnungslegungsantrag für den Zeitraum seit dem 21.11.2009 in der Hauptsache erledigt ist;
- IV. festgestellt werden soll, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die in Ziffer I. bezeichneten, in der Zeit vom 21.11.2009 bis 10.01.2022 begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.
- Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend, soweit das Landgericht der Klage stattgegeben hat, und tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten entgegen, wobei sie geltend macht:
- Bei der angegriffenen Ausführungsform bilde das von der Beklagten als „Überdruckventil“ bezeichnete Ventil die Vorsteuerstufe und das „Rückströmventil“ die Hauptsteuerstufe eines anspruchsgemäßen vorgesteuerten Überdruckventils mit Hysteresewirkung. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Urteil zu dem Begriff des Überdruckventils keine konstruktiven Vorgaben gemacht. Entscheidend sei danach lediglich, dass das Überdruckventil mehrstufig sei und eine Hysteresewirkung entfalte.
- Der Begriff „Steuern“ werde allein durch die im Patentanspruch angegebenen Verfahrensschritte definiert. Unerheblich sei demgegenüber, ob und in welchem Umfang über den gesamten Arbeitsbereich des Handwerkszeugs die Stromaufnahme des Pumpenmotors überwacht werde. Ein einschränkendes Verständnis lasse sich auch dem Urteil des Bundesgerichtshofs nicht entnehmen, der zu dem Begriff der automatischen Steuerung schlicht nicht Stellung genommen habe.
- Soweit die Beklagte erstmals in der Berufungsinstanz vortrage, dass das Öffnen des Überdruckventils keine Voraussetzung für das automatische Abschalten des Pumpenmotors sei, sei dieser Vortrag verspätet. Darüber hinaus sei der Vortrag unschlüssig, da eine Funktionsweise, wie die Beklagte sie beschreibe, technisch nicht zuverlässig funktioniere. Die als Anlage BK 5 vorgelegten Spannungs-/Druck-Diagramme seien vollständig ungeeignet, um den Verletzungsvorwurf zu entkräften. Schon angesichts der vorgenommenen Änderungen der Grenzwerte in der Software, welche zu den Ergebnissen gemäß den Diagrammen 2 und 3 geführt hätten, seien diese insgesamt ohne Bedeutung für die Frage des Verletzungsvorwurfs. Im Gegenteil belege das Verhalten der veränderten Pressmaschinen (Diagramme 2 und 3), dass nur mit dem in der angegriffenen Ausführungsform eingestellten Grenzwert das gewünschte Ergebnis, nämlich das Erkennen der Kausalkette „Öffnen des Überdruckventils beim Arbeitsenddruck – Entlasten der Druckseite der Hydraulikpumpe – Absinken des vom Pumpenmotor aufgenommenen Stroms – Absinken der Verlustspannung am Innenwiderstand des Akkumulators – Ansteigen der Klemmenspannung am Akkumulator“ möglich sei. Die modifizierten Pressmaschinen scheiterten an dieser Aufgabe und würden genau deshalb nicht unter den Verfahrensanspruch fallen.
- Mit ihrem Vortrag auf Seite 3 des Schriftsatzes vom 28.04.2020, wonach selbstverständlich der Grenzwert für die Spannung zum Abschalten des Pumpenmotors in der Software so abgelegt sei, dass der Pumpenmotor nach Beendigung des Pressvorgangs abgeschaltet werde, habe die Beklagte prima facie zugestanden, dass die angegriffene Ausführungsform dazu eingerichtet sei, beim Ausführen eines regelmäßigen produktiven Pressvorgangs die Stromzufuhr zum Pumpenmotor zu unterbrechen, wenn die vom Mikroprozessor erfasste Klemmenspannung des Akkumulators einen vorgegebenen Grenzwert in aufsteigender Richtung erreicht habe. Ferner sei damit zugestanden, dass der Beendigung eines regelmäßigen produktiven Pressvorgangs das Öffnen des Überdruckventils vorausgehe.
- Die Klägerin hat sich, wie vor dem Landgericht, in der Berufungsinstanz zunächst darauf berufen, dass nach dem Vortrag der Beklagten bei der angegriffenen Ausführungsform die Akkuspannung erfasst werde und jedenfalls dies die Anspruchsverwirklichung begründe. Erstmals mit Schriftsatz vom 05.07.2021 (Bl. 745 ff. GA) – nach Erstellung des ersten schriftlichen Gutachtens des Sachverständigen – hat die Klägerin vorgetragen, eine nochmalige Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform (Bericht vorgelegt als Anlage BB 1) habe starke Anhaltspunkte zugunsten der vormaligen Annahme ergeben, dass die zum Erkennen des Verhaltens des Überdruckventils genutzte Spannung am Drain-Source-Widerstand des Power-MOSFET abgegriffen werde.
- Weiter trägt die Klägerin erstmals in der Berufungsinstanz vor, sie habe mit dem bei ihr vorhandenen Exemplar der angegriffenen Ausführungsform eine Versuchsreihe mit 20 Versuchen durchgeführt (Ergebnisse dargestellt auf S. 9 ff. des Schriftsatzes vom 05.07.2021, Bl. 753 ff. GA). Anhand der Ergebnisse dieser Versuche könne ausgeschlossen werden, dass ein im Stromverlauf zeitlich vor dem Öffnen des Überdruckventils vorhandenes Ereignis die automatische Unterbrechung des Stroms hervorgerufen habe. Die Behauptung der Beklagten, der Pumpenmotor der angegriffenen Ausführungsform schalte unabhängig von dem Öffnen des Überdruckventils ab, und es werde bei dessen Einstellung weder ein Strom- noch ein Spannungswert ermittelt, sei damit widerlegt. Sie, die Klägerin, habe überdies nie behauptet, die angegriffene Maschine unterbreche in jeglicher Betriebssituation beim Öffnen des Überdruckventils den Strom zum Pumpenmotor. Vielmehr sei ihr Vorbringen so zu verstehen, dass die angegriffene Maschine immer den Strom zum laufenden Pumpenmotor unterbreche, wenn während dessen Betriebs das Überdruckventil bei Erreichen des Abschaltdrucks selbsttätig öffne. Diese Behauptung habe die Beklagte bislang nicht substanziiert bestritten. Es sei ferner rechtlich nicht erforderlich, dass die angegriffene Maschine in jedem Betriebsablauf das vom Patent geschützte Verfahren notwendig ausführe, sondern es reiche aus, wenn die Maschine hierzu eingerichtet und bestimmt sei.
- Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachten nebst Ergänzungsgutachten des Herrn Patentanwalt D und den Sachverständigen in der Sitzung vom 02.05.2024 mündlich angehört. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen Gutachten des Sachverständigen vom 06.04.2021 (Bl. 655 ff. GA, nachfolgend: GutA) und vom 23.03.2023 (Bl. 972 ff. GA, nachfolgend: Ergänzungs-GutA) sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 02.05.2024 (Bl. 1154 ff. GA, nachfolgend: Protokoll) Bezug genommen.
- Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
- II.
- Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat in der Sache jedoch nur zu einem geringen Teil Erfolg.
- A.
- Die einseitige Teil-Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Das Gericht hat für den Fall einer einseitigen Erledigungserklärung eines Klägers, in der eine nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässige Beschränkung und Änderung des Klageantrags zu erkennen ist (vgl. BGH, NJW 1994, 2363, 2364 – Greifbare Gesetzwidrigkeit II; GRUR 2002, 287, 288 – Widerruf der Erledigungserklärung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 67/17, GRUR-RS 2022, 16207 Rn. 42 – Blasenkatheter-Set II; Urt. v. 03.11.2022 – I-2 U 51/22, GRUR-RS 2022, 34770 Rn. 30 – Feststellungsinteresse; OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller-Althammer, ZPO, 35. Aufl., § 91a Rn. 34 m.w.N) und die auch noch in der Berufungsinstanz statthaft ist (OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller-Althammer, a.a.O., § 91a ZPO Rn. 36–37), darüber zu entscheiden, ob der Rechtsstreit in der Hauptsache – tatsächlich – erledigt ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 67/17, GRUR-RS 2022, 16207 Rn. 42 – Blasenkatheter-Set II; OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller-Althammer, a.a.O., § 91a ZPO Rn. 34, 44 und 45 m.w.N). Das bedeutet, dass nunmehr zu prüfen ist, ob die Klage bis zu dem geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und, wenn das der Fall ist, ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, ist die Hauptsacheerledigung festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2004, 349 – Einkaufsgutschein; GRUR 2010, 57, 58 – Scannertarif; GRUR 2012, 651, 652 – regierung-oberfranken.de, GRUR 2014, 385 – H 15; GRUR 2016, 1316 Rn. 10 – Notarielle Unterlassungserklärung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 09.06.2022 – I-15 U 67/17, GRUR-RS 2022, 16207 Rn. 42 – Blasenkatheter-Set II).
- B.
- Zu Recht hat das Landgericht in dem Angebot und der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen und die Beklagte zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zum Schadensersatz verurteilt. Keinen Bestand haben kann das landgerichtliche Urteil lediglich insoweit, als die Beklagte zur Erstattung von Abmahnkosten verurteilt wurde.
- 1.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, mit denen insbesondere Rohrverbindungen durch plastische Verformung der Rohrwerkstoffe hergestellt werden können. - Wie das Klagepatent in seiner Einleitung ausführt, müssen solche Vorrichtungen einen möglichst genauen Zeit- und Kräfteverlauf einhalten. Einerseits muss die Maximalkraft ausreichend hoch sein, um ein sicheres Arbeitsergebnis, z. B. eine dauerhaft dichte Rohrverbindung, zu erzielen. Andererseits darf die Maximalkraft weder die Festigkeit des Werkstücks noch die des Werkzeugs übersteigen. Zudem steigen die Anforderungen an Kontrollmöglichkeiten der Arbeitsvorgänge und der Funktion der Werkzeuge an (Abs. [0002]).
- Die aus der US-A-2 254 XXB (nachfolgend: US ‚XXB) oder der DE 195 35 XXC C1 vorbekannten (elektro-)hydraulischen Handwerkzeuge zum Herstellen von Rohrverbindungen verfügen, so das Klagepatent weiter, über einen Pressenkopf und einen Arbeitskolben, der nach jedem Pressvorgang durch eine Rückstellfeder in die Ausgangslage zurückgeführt wird (Abs. [0004] f.). Die hydraulische Anordnung der US-Schrift weist ein vorgesteuertes Überdruckventil mit einer Kegelspitze und einem nachgeschalteten Ventilteller auf, der nach dem Öffnen der Kegelspitze wirksam wird, wodurch ein Hystereseverhalten erzeugt wird (Abs. [0004]). Diese vorbekannten Handwerkzeuge sehen nach den Angaben des Klagepatents allerdings keine elektrische oder elektronische Steuerung des Hydrauliksystems vor.
- Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 295 02 XXD ist nach den Ausführungen der Klagepatentschrift ein Werkzeug zur Verpressung einer Rohrverbindung bekannt, bei dem der Elektromotor bei Erreichen eines vorgegebenen, indirekt durch Messung der Stromaufnahme ermittelten Pressdrucks abgeschaltet wird. Jedoch fehlt es an einer Druckbegrenzung durch ein hydraulisches Überdruckventil und an einer automatischen Verfolgung des Motorstroms unter Berücksichtigung vorgegebener Stromwerte (Abs. [0008]).
- Schließlich sind rein elektrisch angetriebene Werkzeuge für andere Einsatzzwecke bekannt, bei denen der Verlauf des Motorstroms durch einen Stromsensor überwacht oder die Abschaltung des Motors bei Erreichen eines voreingestellten Wertes der maximalen Stromaufnahme eingeleitet wird (Abs. [0006], [0009]).
- Vor diesem Hintergrund liegt dem Klagepatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Anordnung für ein elektro-hydraulisches Handwerkzeug bereitzustellen, bei dem der Pumpenmotor zur Einhaltung eines bestmöglichen Kraftverlaufs gesteuert wird (vgl. zum Ganzen BGH-Urteil Rn. 6 – 13; zur subjektiven Aufgabenstellung siehe auch Abs. [0010]).
- Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 ein
Verfahren mit folgenden Merkmalen vor: - 1. Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen.
- 2. Das Handwerkzeug
- 2.1 weist einen Antriebszylinder (1) mit einem einseitig wirkenden
Arbeitskolben (2) auf; - 2.1.1 der Arbeitskolben (2) wird bei Druckentlastung von einer Rückstellfeder (3) in seine Ausgangsstellung zurückgeschoben;
- 2.2 weist für den Antrieb des Antriebszylinders (1) eine aus einem Tank (7) gespeiste Pumpe (5) auf;
- 2.3 weist für den Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank (7) eine Rückströmleitung (8) auf.
- 3. In der Rückströmleitung (8) ist ein vorgesteuertes Überdruckventil (9) mit Hysteresewirkung angeordnet.
- 4. Die Pumpe (5) wird durch einen elektrischen Pumpenmotor (12) angetrieben.
- 5. In der Versorgungsleitung (13) des Pumpenmotors (12) ist ein Leistungsschalter (14) angeordnet.
- 6. Der Pumpenmotor (12) wird derart stromabhängig durch einen Mikroprozessor (15) angesteuert, dass
- 6.1 die Stromaufnahme des Pumpenmotors (12) und der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils (9) vom Mikroprozessor (15) erfasst werden und
- 6.2 der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter (14) unterbrochen wird.
- Der Patentanspruch beschreibt in seinen Merkmalen 1 bis 5 den gegenständlichen Aufbau eines elektro-hydraulischen Handwerkzeugs mit einer an sich bekannten, hydraulisch angetriebenen Kolben-Zylindereinheit, deren Hydraulikpumpe durch einen elektrischen Pumpenmotor angetrieben wird (vgl. BGH-Urteil Rn. 16; BPatG-Urteil
S. 7). Die Merkmalsgruppe 6 beschreibt sodann im Einzelnen die stromabhängige Ansteuerung des Pumpenmotors durch einen Mikroprozessor. - 2.
Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedürfen insbesondere die Merkmale 1 und 3 sowie die Merkmalsgruppe 6 der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung einer näheren Erläuterung. - a)
Beansprucht ist nach Merkmal 1 ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere beim Herstellen von Rohrverbindungen durch plastische Verformung von Rohrwerkstoffen. - Mit der einleitenden Zweckangabe in Merkmal 1 meint das Klagepatent ein Verfahren, bei dem die im Anspruch angegebenen Verfahrensschritte verwirklicht werden und insbesondere die in der Merkmalsgruppe 6 beschriebene stromabhängige Ansteuerung des Pumpenmotors stattfindet. Nachdem es dort, was noch im Einzelnen beschrieben werden wird, um die Unterbrechung des Motorstroms durch den Leistungsschalter – also ein Ausschalten – geht, lässt sich festhalten, dass das Klagepatent auch das bloße Bewirken eines Ein- und Ausschaltens des Motors als eine Steuerung in diesem Sinne ansieht. Darüber hinausgehende Vorgaben an die Komplexität der Steuerung lassen sich weder dem Anspruchswortlaut noch dem Klagepatent im Übrigen entnehmen (vgl. auch GutA S. 4, Bl. 659 GA).
- Etwas anderes folgt entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs, wonach ein einfacher Schaltkontakt keinen Mikroprozessor mit seinen Erfassungs-, Speicher- und Vergleichsmöglichkeiten darstelle (BGH-Urteil Rn. 66). Die Ausführungen des Bundesgerichtshofs befassen sich an dieser Stelle lediglich mit dem Verständnis des Begriffs Mikroprozessor, nicht hingegen mit demjenigen des (automatischen) Steuerns, weswegen sich diesbezüglich aus ihnen keinerlei Rückschlüsse ziehen lassen (vgl. auch Ergänzungs-GutA S. 2, Bl. 974 GA).
- b)
Gemäß Merkmal 3 ist in der Rückstromleitung ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung angeordnet. - aa)
Nach dem Abschluss eines Pressvorgangs ist es erforderlich, den Arbeitskolben in seine Ausgangsstellung zurückzuführen, um z. B. mit dem Arbeitskolben gekoppelte Pressbacken zu öffnen. Die Rückverlagerung des Arbeitskolbens erfolgt mechanisch durch eine Rückstellfeder (vgl. Merkmal 2.1.1). Hierfür ist eine Druckentlastung des Arbeitskolbens erforderlich, was den Rückfluss der auf diesen wirkenden Hydraulikflüssigkeit voraussetzt (vgl. Merkmale 2.1.1, 2.3). Für den Rückfluss der Hydraulikflüssigkeit zu dem Tank weist das Handwerkzeug eine Rückstromleitung auf (Merkmal 2.3), die Antriebszylinder und Tank miteinander verbindet. Die Rückflussmöglichkeit darf die Sicherheit der Pressverbindung nicht gefährden. Zu diesem Zweck ist in ihr ein vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung angeordnet (vgl. BGH-Urteil Rn. 17 ff.). - bb)
Ein Überdruckventil ist nach dem Verständnis des Fachmanns, eines Diplom-Ingenieurs (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen, insbesondere von Rohrpresswerkzeugen (vgl. BPatG-Urteil S. 6), dadurch gekennzeichnet, dass es öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird (vgl. BGH-Urteil Rn. 19). Vorzugsweise wird das Überdruckventil so eingestellt, dass es beim Maximaldruck öffnet, der nach einem durch das Aufeinandertreffen der Pressbacken bedingten steilen Druckanstieg am Ende des Pressvorgangs beim Erreichen der maximalen Presskraft erreicht wird (vgl. Abs. [0017], [0019], [0041]). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Pressvorgang ordnungsgemäß beendet und eine sichere Pressverbindung erzielt wird (vgl. Abs. [0017]). - cc)
Dem Begriff eines vorgesteuerten Überdruckventils unterfällt jedenfalls eine Ausgestaltung, bei welcher der Öffnungsvorgang des Hauptventils – also desjenigen Ventils, durch welches zum Abbau des Überdrucks die Hydraulikflüssigkeit fließt – durch die Hydraulik selbst mittels eines speziellen weiteren Ventils unterstützt wird (vgl. GutA
S. 6, Bl. 661 GA). Dies steht im Einklang mit der Annahme des Bundesgerichtshofs, wonach der Begriff der Vorsteuerung eine Mehrstufigkeit voraussetzt (BGH-Urteil Rn. 21). Das Bundespatentgericht spricht mit Blick auf die Entgegenhaltung D4 ebenfalls von einem durch „ein Steuerventil (32) (vor-)gesteuerte(n) Rückstromventil“ (BPatG-Urteil S. 12) und geht somit gleichfalls von einer solchen mehrstufigen Ventilanordnung aus. An die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommenen Auslegungserwägungen ist der Senat zwar nicht gebunden, sie stellen aber gewichtige sachkundige Stellungnahmen dar (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; GRUR 2010, 950 Rn. 14 – Walzenformgebungsmaschine), denen sich der Senat nach eigener Prüfung anschließt. Ob nur eine solche Ausgestaltung anspruchsgemäß ist, es also zwingend einer aus zwei Ventilen bestehenden Anordnung bedarf, oder ob die erforderliche Mehrstufigkeit auch auf anderem konstruktiven Weg erzielt werden kann, muss mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform nicht entschieden werden. - Soweit das Landgericht demgegenüber davon ausgegangen ist, der Fachmann verstehe den Begriff „vorgesteuert“ dahingehend, dass das Überdruckventil zu einem Zeitpunkt vor der Verwendung des Handwerkzeugs, etwa im Rahmen der Herstellung, zumindest einmal (vor-)eingestellt worden sei, um bei einem bestimmten Druck zu öffnen, trifft dies nicht zu. Patentanspruch 1 spricht nicht von einem „voreingestellten“, sondern von einem „vorgesteuerten“ Überdruckventil. Demnach kann auch die vom Landgericht herangezogene Beschreibungsstelle (Abs. [0018]), in der davon die Rede ist, dass die „Auslegung und Einstellung“ des Überdruckventils so sein muss, dass das Ventil nicht vor Erreichen der vorgegebenen Maximalpresskraft öffnet, dieses Verständnis nicht stützen. Auch dort ist von einer „Vorsteuerung“ nicht die Rede.
- dd)
Mit Hysteresewirkung meint das Klagepatent, dass das Ventil auch bei abnehmendem Druck durch die Hydraulikflüssigkeit offen gehalten wird (vgl. Abs. [0004]). Das Ventil bleibt also auch dann geöffnet, wenn der Systemdruck unter den Öffnungsdruck des Überdruckventils gefallen ist (vgl. BGH-Urteil Rn. 9; BPatG-Urteil S. 7). Ohne eine solche Hysteresewirkung würde sich das Überdruckventil bei dem Erreichen eines bestimmten Drucks öffnen und beim Unterschreiten des gleichen bestimmten Drucks wieder schließen (vgl. GutA S. 6, Bl. 661 GA). Infolge der Hysteresewirkung kann sich der Druck der Hydraulikflüssigkeit hingegen so lange abbauen bis die (niedrigere) Schließdruckschwelle des Überdruckventils erreicht ist (vgl. GutA S. 6, Bl. 661 GA), was erst dann der Fall sein kann, wenn die gesamte Hydraulikflüssigkeit wieder in den Tank zurück gefördert worden ist (vgl. Abs. [0039]). - ee)
Über die somit erforderliche Mehrstufigkeit und die sogleich noch näher zu erörternde Anordnung in der Rückstromleitung hinaus macht das Klagepatent zum konstruktiven Aufbau eines anspruchsgemäßen Überdruckventils keine konkreten Vorgaben (BGH-Urteil Rn. 20). Entscheidend ist, dass das Ventil in räumlich-körperlicher Hinsicht so ausgestaltet ist, dass es die ihm zugedachten Funktionen erfüllt, also insbesondere auf einen bestimmten vorgegebenen Druck anspricht und eine Hysteresewirkung aufweist (BGH-Urteil Rn. 21). - (1)
Der Auffassung der Beklagten, aus den Vorgaben in der Patentschrift lasse sich ableiten, dass es sich bei dem Überdruckventil um ein aus einer Kegelspitze und einem größeren Ventilteller bestehendes Bauteil handeln müsse, kann nicht gefolgt werden. - Zwar führt das Klagepatent in seiner Einleitung im Hinblick auf die US ‚XXB aus, dass bei dem aus dieser Druckschrift bekannten Gegenstand ein in einem Bypass angeordnetes vorgesteuertes Überdruckventil vorgesehen ist, das eine Kegelspitze und einen nachgeschalteten größeren Ventilteller besitzt, der nach dem Öffnen der Kegelspitze wirksam wird, wodurch das Ventil ein Hystereseverhalten erhält (Abs. [0004]). Eine solche aus dem Stand der Technik bekannte Ausgestaltung hat im Klagepatentanspruch jedoch keinen Niederschlag gefunden.
- Aus der von der Beklagten ferner in Bezug genommenen WO 99/19XXE, die der EP 0 944 XXF (Anlage BK 2) entsprechen soll, lässt sich nichts anderes herleiten. Diese Druckschrift ist schon nicht auslegungsrelevant, weil sie in der Klagepatentschrift nicht erwähnt wird.
- (2)
Wenn das Überdruckventil zum Zwecke der Vorsteuerung aus zwei Ventilen besteht, was, wie bereits ausgeführt, eine jedenfalls anspruchsgemäße Ausgestaltung darstellt, kann es sich dabei zwar unter Umständen um ein (sich aus zwei Ventilen zusammensetzendes) einziges Bauteil handeln (vgl. GutA S. 8, Bl. 443 GA). Zwingend ist dies jedoch nicht. - Dem Fachmann ist mit Blick auf eine derartige Anordnung klar, dass – sofern diese nicht durch ein einziges Bauteil gebildet wird – nur ein Ventil in der Rückstromleitung angeordnet sein muss, nämlich das durch das erste Ventil (Pilotventil/Vorsteuerventil) vorgesteuerte zweite Ventil (Hauptventil/Hauptsteuerventil), welches diese Leitung in seiner Schließstellung verschließt und verhindert, dass Hydraulikflüssigkeit über die Rückstromleitung in den Tank abgeleitet wird. Ebenso muss bei einer solchen Anordnung, bei der das erste Ventil (Pilotventil) nicht in der Rückstromleitung angeordnet ist, auch nur das zweite Ventil (Hauptventil) die geforderte Hysteresewirkung haben, aufgrund derer dieses Ventil selbst dann noch offen gehalten wird, wenn der Systemdruck unter den Öffnungsdruck des ersten Ventils gefallen ist. Hat das vorgeschaltete erste Ventil (Pilotventil) beim Erreichen eines bestimmten Drucks angesprochen, kann dieses erste Ventil hingegen sogleich wieder schließen, sofern dies nicht dazu führt, dass auch das zweite Ventil sogleich in seine Schließstellung überführt wird.
- ff)
Unter Berücksichtigung des so beschriebenen Aufbaus eines anspruchsgemäßen Überdruckventils versteht der Fachmann die Vorgabe, wonach das Ventil in der Rückstromleitung angeordnet ist, jedenfalls nicht dahingehend, dass alle Einzelkomponenten einer aus Pilot- und Hauptventil bestehenden Anordnung „innerhalb“ der Leitung angeordnet sein müssen. Ausreichend, aber auch erforderlich ist mit Blick auf den Wortlaut des Anspruchs ein räumlicher Bezug mindestens eines Teils der den Rückstrom der Hydraulikflüssigkeit steuernden Komponente zu dem Inneren der Rückstromleitung. In technisch-funktionaler Hinsicht muss zudem gewährleistet sein, dass gerade durch die Anordnung des Ventils in der Rückstromleitung dieses in der Lage ist, den Rückstrom der Hydraulikflüssigkeit zu kontrollieren, die Leitung also zu öffnen und zu schließen (vgl. auch GutA S. 5, Bl. 660 GA). Jedenfalls dann, wenn das den Rückstrom steuernde Hauptventil (vollständig) innerhalb der Leitung angeordnet ist, sind diese Voraussetzungen erfüllt. - c)
Die Merkmalsgruppe 6 beschreibt die stromabhängige Ansteuerung des Pumpenmotors durch einen Mikroprozessor näher. Die stromabhängige Ansteuerung erfolgt danach derart, dass (1.) der Mikroprozessor die Stromaufnahme des Pumpenmotors und den Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils erfasst (Merkmal 6.1) und dass (2.) der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes durch den Leistungsschalter unterbrochen wird (Merkmal 6.2). - aa)
Die Funktion der in der Merkmalsgruppe 6 im Einzelnen beschriebenen Unterbrechung des Motorstroms nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes ist es, dass sich der bereits beschriebene Rückstellvorgang in die Ausgangsstellung nach dem Abschluss eines Pressvorgangs schneller vollziehen kann als dies bei einem weiterhin arbeitenden Pumpenmotor der Fall wäre. Denn durch die Öffnung des Überdruckventils baut sich zwar der Druck in der Hydraulikflüssigkeit ab, der Pumpenmotor läuft aber zunächst weiter wie bisher und arbeitet auf diese Weise „gegen“ den Druckabbau durch das Überdruckventil (vgl. GutA S. 3, Bl. 658 GA). Indem der Motorstrom für die Hydraulikpumpe abgeschaltet wird, wird ohne zeitlichen Verzug jegliche Fördertätigkeit der Pumpe eingestellt, die einem Rückstellen des Arbeitskolbens bei geöffnetem Überdruckventil im Wege stehen bzw. dieses erschweren könnte (vgl. Abs. [0039]). Es handelt sich mit anderen Worten um eine zusätzliche Maßnahme, die den Rückstellvorgang beschleunigt und unterstützt. - bb)
Erfindungsgemäß wird nach Merkmal 6.1 zum Zwecke bzw. im Rahmen der Steuerung die Stromaufnahme des Pumpenmotors und der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils durch den Mikroprozessor erfasst. Diesbezüglich spricht das Klagepatent einleitend – in Abgrenzung zum Stand der Technik – auch von einer „automatischen Verfolgung des Motorstroms“ (vgl. Abs. [0007], [0008]) sowie einer Überwachung des Ansprechens des Überdruckventils durch Strommessung (vgl. Abs. [0009]). Die Erfindung beruht nämlich auf der Überlegung, dass der Motorstrom des Pumpenmotors ein ausreichend genaues bzw. proportionales Abbild des Druckverlaufs im Hydrauliksystem und damit des Kräfteverlaufs beim Arbeitsvorgang ist, und dass diese Eigenschaft nach Umsetzung des Motorstroms in elektrische bzw. elektronische Signale zur Steuerung des Arbeitsvorgangs durch einen Mikroprozessor genutzt werden kann (Abs. [0012]). Die Presskraft ist in etwa proportional zu der Stromaufnahme und die Stromaufnahme ist in etwa proportional zu dem hydraulischen Druck (Abs. [0022]). Die Erfassung des Motorstroms kann, wie es im Ausführungsbeispiel der Fall ist, mittels eines Stromsensors erfolgen (vgl. Abs. [0021]). Mangels einer entsprechenden Vorgabe im Anspruch ist dieser auf eine solche Ausgestaltung jedoch nicht beschränkt. - Merkmalsgemäß zu erfassen ist zum einen die Stromaufnahme des Pumpenmotors. Der von dem Pumpenmotor aufgenommene Strom definiert gemeinsam mit der an diesem anliegenden Spannung die von dem Motor elektrisch aufgenommene und dann (teilweise) wieder mechanisch abgegebene Leistung (GutA S. 9, Bl. 664 GA). Zum anderen ist der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils zu erfassen. Dieser Stromabfall beruht auf folgendem Zusammenhang: Sobald sich das Überdruckventil öffnet und die Hydraulikflüssigkeit durch die Rückstromleitung zurückfließt, reduziert sich die Belastung des Pumpenmotors. Es verringert sich der Widerstand bzw. die Last, gegen den bzw. die der Pumpenmotor arbeiten muss und damit auch die von dem Motor abgegebene mechanische wie auch die von ihm aufgenommene elektrische Leistung. Die Verringerung der Aufnahme von elektrischer Leistung schlägt sich regelmäßig in einer geringeren Stromaufnahme des Pumpenmotors – also einem „Stromabfall“ – nieder (vgl. GutA S. 9, Bl. 664 GA).
- cc)
Nach Merkmal 6.2 wird der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter unterbrochen. Registriert der Mikroprozessor also im Rahmen der automatischen Verfolgung des Motorstroms gemäß Merkmal 6.1, dass ein gespeicherter Grenzwert (istop) unterschritten wird, veranlasst er eine Unterbrechung des Motorstroms durch den Leistungsschalter. Dies entspricht einem Öffnen des Leistungsschalters und damit einem Auftrennen des Stromkreises, woraus ein Ausschalten des Pumpenmotors folgt (GutA S. 12, Bl. 667 GA). Damit wird eine weitere Förderung von Hydraulikflüssigkeit aus dem Tank in den Arbeitszylinder unterbunden. - Da durch den Mikroprozessor auch ein Absinken des Motorstroms nach dem Öffnen des Überdruckventils erfasst und der Motorstrom nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes unterbrochen werden soll, ist dem Fachmann klar, dass der betreffende Stromwert (istop) notwendigerweise kleiner ist als der Stromwert zum Zeitpunkt des Ansprechens des Überdruckventils. In einer Kurvendarstellung des Stromverlaufs, wie sie beispielhaft in Fig. 2 der Klagepatentschrift gezeigt ist, liegt der gespeicherte Stromwert (istop) damit stets (rechts) unterhalb des oberen Scheitelpunkts der Verlaufskurve. Bei dem in dieser Abbildung gezeigten Ausführungsbeispiel steigt die Stromaufnahme beim Pressvorgang bis zu dem Zeitpunkt t4 an, in welchem das Überdruckventil öffnet. Die Stromaufnahme imax zum Zeitpunkt t4 wird damit durch das Öffnen des Überdruckventils vorgegeben (Abs. [0035]). Infolge des Öffnens des Überdruckventils sinkt der Strom entsprechend dem Kurvenabschnitt K3 ab. Zum Zeitpunkt t5 unterschreitet der Motorstrom die im Datenspeicher gespeicherte Grenzstromstärke istop, woraufhin der Pumpenmotor durch die Elektronik abgeschaltet wird (Abs. [0036]). Der Zeitpunkt t4 entsteht damit durch das Ansprechen des Überdruckventils beim Maximaldruck, repräsentiert durch den oberen Grenzstromwert imax, und der Zeitpunkt t5 entsteht beim Unterschreiten des eingespeicherten Grenzstromwertes istop. In der Klagepatentbeschreibung wird in diesem Zusammenhang betont, dass der gespeicherte Grenzstromwert istop „notwendigerweise kleiner“ als der obere Grenzstromwert imax beim Ansprechen des Ventils ist (Abs. [0041]). In Übereinstimmung hiermit ist in der einleitenden Patentbeschreibung im Rahmen der Würdigung der JP 11198XXG und in Abgrenzung zum Klagepatent davon die Rede, dass diese Schrift weder das Überwachen des Ansprechens eines … Überdruckventils durch Strommessung noch die automatische Motorabschaltung nach Unterschreiten eines gespeicherten niedrigeren Stromwertes offenbart (Abs. [0009]).
- Hieraus folgt, dass nach der Lehre des Klagepatents eine weitere Verfolgung des Motorstroms nach Erreichen einer maximalen oberen Stromstärke beim Ansprechen des Überdruckventils erfolgt. Wird sodann im Rahmen dieser weiteren Verfolgung des Motorstroms festgestellt, dass der gespeicherte Grenzstromwert (istop) unterschritten wird, wird der Pumpenmotor abgeschaltet.
- Die Auswahl eines geeigneten Grenzstromwertes (istop) überlässt das Klagepatent dem Fachmann. Dieser Wert muss nur zwingend kleiner als der obere Grenzstromwert bzw. Höchststromwert (imax) beim Ansprechen des Überdruckventils sein. Außerdem wird der Fachmann den Stromwert istop so wählen, dass aus einem Absinken des Motorstroms hinreichend zuverlässig auf ein Öffnen des Überdruckventils nach erfolgreich abgeschlossenem Arbeitsvorgang geschlossen werden kann. Eine absolute Gewissheit ist nach der beanspruchten Lehre jedoch gerade nicht erforderlich (siehe dazu noch unter gg)).
- dd)
Dass auch der Stromverlauf über einen bestimmten Zeitraum hinweg – oder gar über die gesamte Betriebsdauer eines Arbeitstakts – verfolgt werden muss, lässt sich dem Anspruch nicht entnehmen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine solche zeitliche Ausdehnung, durch die für den Mikroprozessor anhand der erfassten Ist-Daten zum Stromverbrauch des Pumpenmotors das Absinken unter den gespeicherten Grenzwert erkannt werden kann (vgl. auch GutA S. 11, Bl. 666 GA; Ergänzungs-GutA S. 4, Bl. 976 GA). - ee)
Das Klagepatent gibt nicht vor, was es unter dem Erfassen der Stromaufnahme (und des Stromabfalls) versteht. - Der Anspruchswortlaut lässt prinzipiell zwei Deutungen zu: So kann mit einem Erfassen ein Akt der unmittelbaren Wahrnehmung gemeint sein, so dass Patentanspruch 1 dem Fachmann die Anweisung gibt, den Stromverbrauch des Pumpenmotors als physikalische Größe direkt und unmittelbar zu detektieren. Andererseits kann das Erfassen aber auch großzügiger dahingehend aufgefasst werden, dass jede Form der Feststellung des Stromverbrauchs genügt, also auch eine bloß mittelbare Erfassung, die sich – z. B. im Wege der Umrechnung – auf andere physikalische Werte als denjenigen der Stromaufnahme stützt. Eine technisch-funktionale Betrachtung spricht für das letztgenannte Verständnis. Die Erfindung des Klagepatents beruht, wie bereits ausgeführt, maßgeblich auf der Überlegung, dass der Stromverlauf des Pumpenmotors ein ausreichend genaues Abbild des Druckverlaufs im Hydrauliksystem ist, so dass aus einer (stark) abfallenden Stromaufnahme des Pumpenmotors zuverlässig auf eine Beendigung des Pressvorgangs geschlossen und darauf gestützt die Konsequenz gezogen werden kann, den Pumpenmotor abzuschalten. Für diesen technischen Zusammenhang kommt es indes allein auf den Stromverbrauch als solchen an, nicht aber darauf, auf welche Weise er detektiert wird. Auch im Übrigen lassen sich der Patentschrift keine Hinweise darauf entnehmen, dass das Klagepatent der Art und Weise, wie die Stromaufnahme erfasst wird, eine Bedeutung beimisst, die über das Ergebnis – das Erzielen eines ausreichend genauen Abbilds des Druckverlaufs während des Pressvorgangs – hinausgeht. Im Ergebnis ist daher jedwede und folglich auch eine nur mittelbare Erfassung des Strombedarfs objektiv geeignet und daher als erfindungsgemäß zu betrachten. Auch der Sachverständige hat in seinem Gutachten überzeugend ausgeführt, dass es für die Zielsetzung, ein Ausschalten des Pumpenmotors erst nach der Öffnung des Überdruckventils zu erreichen, auf die Art und Weise der Erfassung der Stromaufnahme oder des Stromabfalls nicht ankommt (vgl. GutA S. 10, Bl. 665 GA; Ergänzungs-GutA S. 4, Bl. 976 GA).
- Als mittelbare Erfassung der Stromaufnahme (und des Stromabfalls) in diesem Sinne kommt insbesondere die Ermittlung der Spannung in Betracht, sofern die jeweilige Art der Spannungsmessung für die Ermittlung der Stromaufnahme geeignet ist. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts war zwischen den Parteien in erster Instanz unstreitig, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens und unter Anwendung einer allgemein bekannten Formel von der Spannung auf den Stromwert und umgekehrt schließen kann (LG-Urteil S. 9, S. 26). Daraus folgt, wie das Landgericht zu Recht ausgeführt hat, dass ein bestimmter Spannungswert immer mit einem bestimmten Stromwert korreliert, und es sich daher bei der Spannung um eine prinzipiell geeignete Größe für die – mittelbare – Erfassung der Stromaufnahme handelt.
- Im Einklang hiermit hat der gerichtliche Sachverständige ausgeführt, dass der Strom bzw. die Stromaufnahme/Stromabnahme auch mittelbar („quasi-mittelbar“) aus einer erfassten Spannung ermittelt werden kann (GutA S. 10). Nach seinen Erläuterungen ist dieser Ansatz für die Strommessung üblich (GutA S. 10 f.), wobei hiernach sogar alle praktisch relevanten Ansätze zur Strommessung eine solche Mittelbarkeit vorsehen (GutA S. 11). Wie der Sachverständige nachvollziehbar und überzeugend ausgeführt hat, ist die Stromerfassung durch eine Spannungsmessung möglich und zulässig. Erforderlich ist nur, dass die entsprechende Spannungsmessung für die Ermittlung des jeweiligen Stroms geeignet (GutA S. 11).
- Einer solchen Sichtweise lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass das Klagepatent im Unteranspruch 4, aber auch an verschiedenen Beschreibungsstellen (u. a. Abs. [0014], [0024]) die Möglichkeit vorsieht, mithilfe eines Spannungssensors – zusätzlich zum Motorstrom – den Verlauf der Betriebsspannung der die Pumpe versorgenden Stromquelle zu messen. Der Sinn der so erwähnten Spannungsmessung ist nach dem Klagepatent nicht die Ansteuerung des Pumpenmotors, sondern beispielsweise die Kontrolle des Ladezustands des Akkumulators, welcher verhindert, dass das Handgerät trotz niedriger Spannung, die für einen ordnungsgemäßen weiteren Pressvorgang nicht mehr ausreichen würde, erneut in Betrieb genommen wird (Abs. [0024]). Gerade aufgrund dieser unterschiedlichen Zielrichtungen lässt sich nicht der Schluss ziehen, das Klagepatent differenziere zwischen der Messung von Strom und Spannung und fordere jeweils ausschließlich das eine oder das andere.
- ff)
Aus der Vorgabe in Merkmal 6.2, wonach der Motorstrom „nach Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes (istop) durch den Leistungsschalter unterbrochen wird“, entnimmt der Fachmann zunächst das Erfordernis eines temporalen Zusammenhangs zwischen dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes und der Unterbrechung des Motorstroms. Die Unterbrechung des Motorstroms muss dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes also zunächst in zeitlicher Hinsicht nachfolgen. - Darüber hinaus lässt sich dieser Vorgabe aber auch entnehmen, dass es sich um einen kausalen Zusammenhang handeln muss und die Unterbrechung des Motorstroms gerade in Abhängigkeit von und in Reaktion auf das Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes erfolgen muss. Betrachtet man die Merkmalsgruppe 6 im Zusammenhang, wird deutlich, dass die Erfassung der Stromaufnahme des Pumpenmotors und auch des Stromabfalls nach dem Öffnen des Überdruckventils sicherstellen, dass das Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes detektiert werden kann. Gerade diesen Zusammenhang bezeichnet der Anspruch als stromabhängige Ansteuerung des Pumpenmotors (vgl. Merkmal 6: „derart stromabhängig angesteuert …, dass …“). Könnte die Unterbrechung des Motorstroms auch unabhängig von dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes veranlasst werden, solange sie diesem Ereignis nur zeitlich nachfolgt, könnte die nach Merkmal 6.1 geforderte Erfassung ihren Zweck nicht mehr erfüllen und auch das vom Klagepatent als stromabhängige Ansteuerung verstandene Zusammenspiel entfiele.
- Von dem Erfordernis eines kausalen Zusammenhangs geht auch der Bundesgerichtshof aus, wenn er in Rn. 26 seines Urteils vom 07.12.2021 ausführt:
- „Nicht anspruchsgemäß ist ein Verfahren, bei dem der Motorstrom schon nach dem Erreichen eines bestimmten Schwellwertes abgeschaltet wird. Die Abschaltung darf vielmehr nur dann erfolgen, wenn der erfasste Strom von einem Wert oberhalb des definierten Schwellwerts auf einen darunter liegenden Wert absinkt.“
- gg)
Demgegenüber muss sich ein kausaler Zusammenhang zwischen dem tatsächlich erfolgten Öffnen des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms entgegen der Auffassung der Beklagten nicht feststellen lassen. Dem Wortlaut des Merkmals 6.1, wonach neben der Stromaufnahme des Pumpenmotors „der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils … erfasst“ wird, lässt sich die Notwendigkeit eines solchen Kausalzusammenhangs nicht entnehmen. Ein solches Erfordernis widerspräche darüber hinaus der technischen Funktion der Merkmalsgruppe 6 und dem Grundgedanken der Erfindung. Die im Klagepatent beanspruchte technische Lehre beruht gerade auf der grundlegenden Überlegung, dass durch die Messung des Stroms am Pumpenmotor der Druckverlauf im hydraulischen System abgebildet – nicht: detektiert – wird. Dazu heißt es grundlegend in Abs. [0012]: - „… Die Erfindung beruht auf der überlegung, daß der Motorstrom des Pumpenmotors ein ausreichend genaues bzw. proportionales Abbild des Druckverlaufs im Hydrauliksystem und damit des Kräfteverlaufs beim Arbeitsvorgang ist, und daß diese Eigenschaft nach Umsetzung des Motorstroms in elektrische bzw. elektronische Signale zur Steuerung und zur Kontrolle des Arbeitsvorganges durch einen Mikroprozessor mit Datenspeichern und Speicherplätzen für vorgebbare und ggf. veränderbare Sollwerte und Betriebsparameter verwendet werden kann. …“
- Es ist demnach gerade das Ziel der Erfindung, durch die Erfassung des Motorstroms – mittelbar – eine Information über das mit ausreichender Sicherheit erfolgte Öffnen des Überdruckventils zu erhalten, ohne dass das Öffnen des Überdruckventils selbst (etwa durch eine Verknüpfung der Unterbrechung des Motorstroms mit einer Druckmessung im hydraulischen System) erfasst werden müsste. Das Erfordernis, wonach der Stromabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils zu erfassen ist, spricht demnach die sich bei einem Pressvorgang typischerweise ergebende Stromaufnahmekurve an. Diese kann genutzt werden, um mit einer für die Zwecke der Erfindung ausreichenden Sicherheit auf das erfolgte Öffnen des Überdruckventils zu schließen. Eine absolute Gewissheit darüber, dass das Überdruckventil bei Erreichen des gespeicherten Stromwertes geöffnet hat, ist an dieser Stelle ebenso wenig erforderlich wie die Sicherheit, dass das Überdruckventil nicht auch öffnen könnte, ohne dass dieser Stromwert erreicht wird. Dies macht Abs. [0012] mit der Betonung eines ausreichend genauen bzw. proportionalen Abbilds des Druckverlaufs deutlich. Auch in Abs. [0010], der sich mit der subjektiven Aufgabenstellung des Klagepatents befasst, ist nur die Rede davon, der Pumpenmotor werde „zumindest im wesentlichen“ durch den Druckverlauf im Hydrauliksystem gesteuert.
- Konsequenterweise bezeichnet der Anspruch die Ansteuerung des Pumpenmotors in Merkmal 6 zudem als „stromabhängig“ und nicht etwa auch als „druckabhängig“. Diese Unterscheidung kommt auch in Abs. [0022] zum Ausdruck, in dem es zu einem Ausführungsbeispiel heißt:
- „Die elektronische Steuerung erfolgt nach zwei Prinzipien, nämlich a) stromabhängig und b) zeitabhängig. Der Stromsensor 16 erfasst die Stromaufnahme „i“ des Motors und dadurch die Preßkraft „K“. Die Preßkraft ist in etwa proportional der Stromaufnahme. Die Stromaufnahme ist in etwa proportional dem hydraulischen Druck „P“ …“.
- Diese Sichtweise vertritt auch der Sachverständige in seinen Gutachten, wenn er ausführt, der Einwand der Beklagten, wonach die Kausalität der Unterbrechung mit dem Öffnen des Überdruckventils nicht gegeben sei, gehe fehl, weil es wesentlich für die Erfindung sei, dass die Erfassung des Motorstroms … die Information zur Öffnung des Überdruckventils liefern solle (GutA S. 25, Bl. 680 GA). Es sei genau Sinn der Lehre des Klagepatents, allein anhand des erfassten Stromwertes die Öffnung des Überdruckventils zu erkennen oder vorherzusagen (GutA S. 27 f., Bl. 682 f. GA).
- Schließlich lässt sich den bereits erwähnten Ausführungen des Bundesgerichtshofs entgegen der Auffassung der Beklagten keine andere Sichtweise entnehmen. Der Bundesgerichtshof hebt in Rn. 25 seines Urteils vielmehr hervor, dass die die Ansteuerung des Pumpenmotors betreffenden Merkmale auf der Annahme beruhen, „dass der Motorstrom ein ausreichend genaues Abbild des Druckverlaufs im Hydrauliksystem und damit des Kräfteverlaufs beim Arbeitsvorgang bietet (Abs. 12, 22) und deshalb der nach dem Öffnen des Überdruckventils einsetzende Druckabfall zu einem entsprechenden Absinken des Motorstroms führt.“ Damit betont der Bundesgerichtshof eben jenen Zusammenhang, wonach das Geschehen im hydraulischen System (Druckabfall nach dem Öffnen des Überdruckventils) sich im Stromverlauf (Absinken des Motorstroms) niederschlägt. Dass sich ein kausaler Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen Öffnen des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms feststellen lassen müsste, folgt daraus gerade nicht. Auch in den weiteren, bereits zitierten Ausführungen befasst sich der Bundesgerichtshof nur mit dem Zusammenhang zwischen dem Absinken des erfassten Stroms von einem Wert oberhalb des Schwellwertes auf einen darunter liegenden Wert einerseits und dem Abschalten des Motorstroms andererseits (BGH-Urteil Rn. 26). Von dem Öffnen des Überdruckventils ist an dieser Stelle keine Rede. Das Argument der Beklagten, aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs, wonach die Abschaltung nur dann erfolgen dürfe, wenn der erfasste Strom von einem Wert oberhalb des definierten Schwellwertes auf einen darunter liegenden Wert absinke, lasse sich ein solcher Kausalzusammenhang entnehmen, weil eben dieses nur möglich sei, wenn zuvor das Überdruckventil geöffnet worden sei, greift nicht durch. Das Absinken des Motorstroms repräsentiert den Druckverlauf im hydraulischen System und lässt mit ausreichender Gewissheit auf das Öffnen des Überdruckventils schließen. Dass das Überdruckventil tatsächlich und in jedem Einzelfall geöffnet hat, muss – und soll – hingegen vor einer Unterbrechung des Motorstroms nicht feststehen.
- In Übereinstimmung hiermit geht auch der gerichtliche Sachverständige in seinem Ergänzungsgutachten – unter Berücksichtigung der Ausführungen des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsberufungsurteil – davon aus, dass der Patentanspruch keine „direkte“ Kausalität zwischen der Öffnung des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms verlangt (Ergänzungs-GutA S. 4). Nach seinen Ausführungen muss zwar zwischen der Unterbrechung des Motorstroms gemäß Merkmal 6.2 und der Erfassung des Stromabfalls gemäß Merkmal 6.1 ein kausales Verhältnis bestehen, weshalb es nicht ausreicht, dass ein Stromabfall erfasst wird und rein zeitlich danach der Motorstrom unterbrochen wird. Der erfasste Stromabfall muss vielmehr ursächlich für die Unterbrechung sein (Ergänzungs-GutA S. 4). Es entspricht daher nicht den Vorgaben des Klagepatents, wenn der Mikroprozessor bereits während eines ansteigenden Stromwerts die ggf. zeitverzögerte Unterbrechung des Motorstroms auslösen würde. Die Auslösung darf vielmehr erst erfolgen, wenn ein Absinken erfasst wird (Ergänzungs-GutA S. 4). Eine „direkte“ Kausalität zwischen der Öffnung des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms wird aber auch nach Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen nicht vorausgesetzt. Der Patentanspruch fordert „nur“ ein Ausschalten als Reaktion auf die Stromwertunterschreitung, wobei der Abfall des Motorstroms bzw. – genauer – die Stromwertunterschreitung nach der Lehre des Klagepatents eine Folge der Öffnung des Überdruckventils ist (vgl. Ergänzungs-GutA S. 4; vgl. ferner Protokoll, S. 4 Mitte).
- In seiner mündlichen Anhörung in der Sitzung vom 02.05.2024 hat der Sachverständige erklärt, dass er an dieser Sichtweise festhält (Protokoll S. 3 f.). Auch aus seinen weiteren Ausführungen ergibt sich kein anderes Verständnis. Soweit der Sachverständige von einer „mittelbaren Kausalkette“ zwischen dem Öffnen des Überdruckventils, dem Abfall des Stroms und der Unterbrechung des Motorstroms spricht, steht eine solche nach seinen Erläuterungen unter der Voraussetzung einer entsprechenden Einstellung des gespeicherten Stromwerts und besteht die Möglichkeit, diese durch Eingriffe zu verändern (vgl. Protokoll S. 8). In diesem Sinne verstanden beschreibt die „mittelbare Kausalkette“ nicht mehr als dass das Überdruckventil bei einer korrekten Einstellung des gespeicherten Grenzwerts geöffnet hat, bevor der Motorstrom unterbrochen wird. Dass ein tatsächliches Öffnen des Überdruckventils vor Unterbrechung des Motorstroms festgestellt werden und eine Unterbrechung des Motorstroms ohne vorheriges Öffnen des Überdruckventils – und umgekehrt – unabhängig von der Wahl des Grenzwerts ausgeschlossen sein müsste, ergibt sich hieraus jedoch nicht. Folgerichtig hat der Sachverständige die Frage der Beklagtenvertreter, ob eine Ausführungsform patentverletzend sein könne, bei der das Überdruckventil bei einer konkreten Durchführung geöffnet ist, der Motor aber noch läuft, bejaht (Protokoll S. 5). Der so beschriebene „Ist-Zustand“ schließt nach den Ausführungen des Sachverständigen eine Verletzung nicht aus (Protokoll S. 5), woraus sich ebenfalls ergibt, dass es auf einen Kausalzusammenhang zwischen dem tatsächlichen Öffnen des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms gerade nicht ankommt.
- 3.
Durch das Anbieten und Liefern der angegriffenen Ausführungsform an Abnehmer in Deutschland, die ihrerseits zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind, verletzt die Beklagte das Klagepatent mittelbar (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 10 PatG). - Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Inland anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind gegeben.
- a)
Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um ein Mittel, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. - Ob das Mittel in diesem Sinne geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstands, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679 Rn. 29 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773 Rn. 18 – Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2007, 773 Rn. 18 – Rohrschweißverfahren). Das trifft auf Vorrichtungen zu, mit denen ein patentgeschütztes Verfahren praktiziert werden kann (vgl. BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 14 – Rohrschweißverfahren; GRUR 2015, 467 Rn. 58 – Audiosignalcodierung). So liegt es hier. Mit der angegriffenen Ausführungsform kann das im Klagepatentanspruch 1 beanspruchte Verfahren wortsinngemäß verwirklicht werden.
- aa)
Dass die angegriffene Ausführungsform zur wortsinngemäßen Verwirklichung der Merkmalsgruppe 2 sowie der Merkmale 4 und 5 geeignet ist, steht zwischen den Parteien auch im Berufungsrechtszug zu Recht nicht in Streit, weshalb sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen. - bb)
Mit der angegriffenen Ausführungsform kann auch ein Verfahren zum automatischen Steuern von elektro-hydraulischen Handwerkzeugen im Sinne des Merkmals 1 durchgeführt werden. Nach obiger Auslegung ist hierfür ausreichend, dass der Mikroprozessor der angegriffenen Ausführungsform – dessen Vorhandensein die Beklagte nicht in Abrede stellt – im Sinne der Merkmalsgruppe 6 stromabhängig angesteuert werden kann. Dies ist, wie unter dd) näher ausgeführt werden wird, der Fall. Eine darüber hinausgehende, sich insbesondere nicht in einem Ein- und Ausschalten des Pumpenmotors erschöpfende Komplexität der Steuerung ist nach der obigen Darstellung nicht erforderlich. - cc)
Die angegriffene Ausführungsform verfügt über ein in der Rückstromleitung angeordnetes, vorgesteuertes Überdruckventil mit Hysteresewirkung im Sinne des Merkmals 3. - Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts, die der Senat seiner Entscheidung nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zugrunde zu legen hat, verfügt die angegriffene Ausführungsform über ein „mehrteiliges Überdruckventil“ mit einer Vorsteuerstufe und einer Hauptsteuerstufe, wobei jedenfalls die Hauptsteuerstufe in der Rückstromleitung angeordnet ist. Wegen der weiteren Einzelheiten des Aufbaus wird auf S. 22 f. des landgerichtlichen Urteils Bezug genommen.
- Davon ausgehend lässt sich die Verwirklichung des Merkmals 3 feststellen. Das vorgesteuerte Überdruckventil mit Hysteresewirkung in diesem Sinne wird bei der angegriffenen Ausführungsform durch eine aus zwei Ventilen bestehende Anordnung gebildet, nämlich aus dem von der Beklagten als „Überdruckventil“ bezeichneten Ventil, welches dem Pilotventil im Sinne obiger Auslegung bzw. der Vorsteuerstufe entspricht, und dem von der Beklagten als „Rückstromventil“ bezeichneten Ventil, welches dem Hauptventil bzw. der Hauptsteuerstufe entspricht (vgl. auch GutA S. 17 f., Bl. 672 f. GA).
- Nach der oben dargetanen Auslegung ist die Tatsache, dass das Ventil nicht als Kegelspitze mit nachgeschaltetem Ventilteller ausgebildet ist, genauso unbeachtlich wie der Umstand, dass es sich um eine aus zwei separaten Bauteilen (Ventilen) bestehende Ventilanordnung handelt, von der sich nur ein Teil – das Hauptventil („Rückstromventil“ in der Terminologie der Beklagten) – innerhalb der Rückstromleitung befindet. Die Ventilanordnung spricht auf einen vorbestimmten Druck an und öffnet bei Erreichen dieses Drucks auf hydraulischem Weg. Da das Hauptventil sich bei abnehmendem Druck nicht wieder schließt, verfügt das anspruchsgemäße Überdruckventil auch über die erforderliche Hysteresewirkung. Schließlich handelt es sich angesichts des Vorhandenseins eines Pilotventils und der daraus folgenden Mehrstufigkeit auch um ein vorgesteuertes Ventil.
- dd)
Des Weiteren wird der Pumpenmotor der angegriffenen Ausführungsform auch nach den Vorgaben der Merkmalsgruppe 6 durch einen Mikroprozessor stromabhängig angesteuert. - (1)
In tatsächlicher Hinsicht legt der Senat zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform Folgendes zugrunde: - (a)
Zwischen den Parteien ist zunächst unstreitig, dass im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform eine Spannungsmessung stattfindet, um in Abhängigkeit hiervon den Motorstrom zu unterbrechen, und dass diese Spannungsmessung in einer Weise erfolgt, die es ermöglicht, davon ausgehend den (vom Pumpenmotor aufgenommenen) Strom zu ermitteln. - Streitig ist, welche Spannung genau erfasst wird bzw. an welcher Stelle die Spannungsmessung erfolgt. Die Beklagte beruft sich, ebenso wie bereits in erster Instanz (LG-Urteil S. 25 f.), in der Berufungsinstanz darauf, im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform werde die Akkuspannung herangezogen, um den Motor nach Beendigung des Pressvorgangs abzuschalten. Die Klägerin hat in erster Instanz vorgetragen, dass die angegriffene Ausführungsform die Motorspannung und den Motorstrom überwache; soweit jedoch, wie die Beklagte behaupte, nur die Motorspannung detektiert und überwacht werde, spiele dies für die Verwirklichung der Lehre des Klagepatents keine Rolle (LG-Urteil S. 9). Im Laufe des Berufungsverfahrens hat die Klägerin vorgetragen, dass die Spannung am Drain-Source-Widerstand des Power-MOSFET gemessen werde. Nachdem das Landgericht keine eigenen Feststellungen zum Ort der Spannungsmessung getroffen, sondern den Vortrag der Beklagten als jedenfalls verletzend zugrunde gelegt hat (vgl. LG-Urteil S. 25 f.), war die Klägerin nicht durch die §§ 529, 531 ZPO daran gehindert, (erstmals) selbst zum Ort der Spannungsmessung vorzutragen.
- (b)
Es ist der Beurteilung der Verletzungsfrage ebenfalls als unstreitig zugrunde zu legen, dass im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform nach Überschreiten eines gespeicherten Spannungswertes – durch den auf das Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes geschlossen werden kann – der Motorstrom durch den Leistungsschalter unterbrochen wird und insofern ein Kausalzusammenhang besteht. - Die Klägerin hat sich unter Vorlage von eigenen Messergebnissen in ausreichender Form auf eine entsprechende Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform berufen (vgl. nur Schriftsätze der Klägerin vom 09.04.2020 S. 5 ff., Bl. 429 ff. GA; vom 05.07.2021, S. 8 ff., Bl. 752 ff. GA; siehe dazu auch GutA S. 21 f., Bl. 676 f. GA; Ergänzungs-GutA S. 12 f., Bl. 984 f. GA).
- Die Beklagte ist dem nicht entgegengetreten, weshalb das entsprechende Vorbringen der Klägerin als zugestanden anzusehen ist (§ 138 Abs. 3 ZPO). Bereits in erster Instanz hat die Beklagte nach den Feststellungen des Landgerichts selbst vorgebracht, bei der angegriffenen Ausführungsform werde die (Akku-)Spannung erfasst „und die erfassten Daten genutzt, um die Presse bei Erreichen einer bestimmten Spannung auszuschalten“ (LG-Urteil S. 26). Aus dem Vorbringen der Beklagten in der Berufungsinstanz ergibt sich nichts anderes.
- (aa)
Die Beklagte hat schriftsätzlich deutlich gemacht, dass sie einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes (mittelbar erfasst durch das Überschreiten eines Spannungswertes) und dem Unterbrechen des Motorstroms nicht in Frage stellt. So hat sie, noch nachdem der Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt hat, er stelle auf der Grundlage des Vorbringens der Beklagten einen solchen Zusammenhang fest, ausgeführt, hierauf komme es bei dieser Merkmalsgruppe überhaupt nicht an (Schriftsatz vom 02.07.2021, dort S. 6, Bl. 736 GA, S. 11, Bl. 741 GA). Im Schriftsatz vom 12.04.2022 (dort S. 8 f., Bl. 881 f. GA) führt die Beklagte unter anderem aus: - „… Dieses einfache Schaltverhalten ergibt sich daraus, dass bei der angegriffenen Ausführungsform lediglich das Überschreiten sowie das Unterschreiten eines in der Software fest eingestellten Schwellwertes überwacht wird. …
- Bei der angegriffenen Ausführungsform erfolgt das Abschalten des Motorstromes bei Erreichen eines bestimmten Schwellwertes, der in der Software vorgegeben ist. Die Software ist – wie bereits vorgetragen – so eingerichtet, dass der Verlauf der Stromstärke nicht erfasst wird. Sobald der vorgegebene Sollwert erreicht ist, wird der Pumpenmotor abgeschaltet, und zwar unabhängig davon, ob das Überdruckventil geöffnet hat. …“
- Nach Auffassung der Beklagten entscheidend ist danach nicht der kausale Zusammenhang zwischen dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes und dem Unterbrechen des Motorstroms, sondern allein derjenige zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Unterbrechen des Motorstroms. Diesen – und nur diesen – stellt sie in tatsächlicher Hinsicht in Abrede.
- (bb)
Soweit sich im Vortrag der Beklagten, wie der Sachverständige in seinem Ergänzungsgutachten im Einzelnen dargestellt hat, im Laufe des Berufungsverfahrens Widersprüchen bei der Darstellung der Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform ergeben haben, kommt es darauf schon aus diesem Grund nicht mehr an. Die von dem Sachverständigen herausgearbeiteten Widersprüche betreffen die Einzelheiten der Unterbrechung des Motorstroms in Abhängigkeit von dem Unterschreiten des gespeicherten Stromwertes bei der angegriffenen Ausführungsform. Nachdem die Beklagte eine solche Funktionsweise, wie dargestellt, nicht in Abrede stellt, ist es unerheblich, ob sich auf der Grundlage jeder einzelnen der sich widersprechenden Darstellungen eine Benutzung des Klagepatents feststellen ließe. - Gleichwohl ist, wenn man das Vorbringen der Beklagten im Detail betrachtet, die Verletzung des Klagepatents ungeachtet des wechselnden Vortrags feststellbar. Wie auch der Sachverständige herausgearbeitet hat, könnte nur eine einzige „Version“ im Vorbringen der Beklagten aus der Verletzung herausführen, nämlich diejenige, wonach bei der angegriffenen Ausführungsform die Akkuspannung herangezogen werde, um den Motor nach Beendigung des Pressvorgangs abzuschalten, „und zwar in dem Augenblick, in dem die Akkuspannung auf den Stand zum Start des Pressvorganges wieder abgefallen ist“ (Schriftsatz der Beklagten vom 27.12.2019, S. 2 f., Bl. 804 f. GA). Dieser Vortrag steht allerdings im Widerspruch zum gesamten übrigen Vorbringen der Beklagten betreffend die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform und auch zum Vortrag an späterer Stelle in eben diesem Schriftsatz, in dem es (zu den von der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 05.07.2021 beschriebenen 20 Versuchen) heißt (S. 3, Bl. 805 GA):
- „… Selbstverständlich muss die angegriffene Ausführungsform im Einsatz so arbeiten, dass sie am Ende des Pressvorganges den Motorstrom abschaltet. Ebenso selbstverständlich ist, dass der Abschaltvorgang bei einer Vielzahl von Pressvorgängen schon aus Qualitätsgründen zumindest annähernd gleich ablaufen muss. Es ist daher auch nicht überraschend, dass kurz nach dem Öffnen des Überdruckventils der Strom zum Pumpenmotor automatisch unterbrochen wird und der zeitliche Abstand zwischen dem Öffnen des Überdruckventiles und dem Abschalten des Pumpenmotors nur geringfügig variiert.“
- (Hervorhebungen hinzugefügt)
- Der Vortrag der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 27.12.2019 (dort S. 2 f., Bl. 804 f. GA) steht überdies im Widerspruch zu der auch von der Beklagten zugrunde gelegten Tatsache, dass die (Akku-)Spannung nicht auf den Stand zum Start des Pressvorgangs abfallen, sondern allenfalls ansteigen kann, und dass die Beklagte an anderer Stelle selbst vorträgt, in der angegriffenen Ausführungsform sei ein fester Grenzwert – und nicht ein notwendigerweise dynamischer Wert wie derjenige zu Beginn des jeweiligen Pressvorgangs – gespeichert, nämlich 20,8 V. Diese Umstände erlauben in ihrer Gesamtheit den Schluss, dass es sich bei dem anderslautenden Vortrag um ein Versehen handelt oder sich die Beklagte darauf zumindest nicht mehr beruft.
- Nachdem der Sachverständige in seinem Ergänzungsgutachten die Widersprüchlichkeiten im Vortrag der Beklagten herausgearbeitet hat, hat die Beklagte überdies in ihrem Schriftsatz vom 29.06.2023 (Bl. 1058 ff. GA) nochmals deutlich gemacht, dass es ihr nicht um ein Bestreiten der Unterbrechung des Motorstroms in Abhängigkeit von einem gespeicherten Grenzwert gehe, sondern ausschließlich um den fehlenden Kausalzusammenhang zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms, und dass es deshalb auf die Ausführungen des Sachverständigen in diesem Zusammenhang überhaupt nicht ankomme. Zusammenfassend heißt es auf Seite 5 des Schriftsatzes (Bl. 1062 GA):
- „Der wesentliche Unterschied zwischen dem Patentgegenstand und der angegriffenen Ausführungsform besteht darin, dass in der Software der angegriffenen Ausführungsform der zum Abschalten des Motorstroms erforderliche Schwellwert vorgegeben ist. Sobald dieser Schwellwert erreicht ist, wird der Motor abgeschaltet, und zwar unabhängig davon, ob das Überdruckventil geöffnet ist oder nicht. Dieser Sachverhalt ist anhand der Diagramme 2 und 3 der Anlage BK 5 anhand von Messprotokollen dargelegt und nachgewiesen worden.“
- (cc)
Darüber hinaus ergibt sich die Verwirklichung der Merkmalsgruppe 6 auch aus den von der Beklagten selbst vorgenommenen Messungen, die in den Diagrammen 1 bis 3 der Anlage BK 5 und dem Diagramm 4 der Anlage BK 6 ihren Niederschlag gefunden haben und auf die sie sich auch weiterhin beruft. - (i)
Das Diagramm 1 der Beklagten belegt, dass die angegriffene Ausführungsform zur Verwirklichung des beanspruchten Verfahrens geeignet ist. - Nach dem Vortrag der Beklagten gibt das nachstehend eingeblendete Diagramm 1 der Anlage BK 5 das Verhalten der angegriffenen Ausführungsform wieder und ist insbesondere mit demjenigen gespeicherten Spannungswert (20,8 V) erstellt worden, welcher auch in der angegriffenen Ausführungsform gespeichert ist:
- Aus diesem Diagramm lässt sich, wie auch der Sachverständige in seinem Gutachten ausführlich und nachvollziehbar dargestellt hat, erkennen, dass der Motorstrom in Abhängigkeit von dem Überschreiten des gespeicherten Spannungswertes (entspricht dem Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes) unterbrochen wird (vgl. GutA S. 23 ff.). Der mit dem unteren roten Pfeil gekennzeichnete Punkt der Druckkurve (gelb) markiert den Augenblick, in dem das Überdruckventil öffnet, was durch den Abfall des Drucks deutlich erkennbar ist. In diesem Moment sinkt der Motorstrom stark ab, was einem Anstieg der Spannung entspricht, wie in der Spannungskurve (grün) erkennbar ist. Die eigentliche Unterbrechung des Leistungsschalters erfolgt mit einem Zeitversatz zur Öffnung des Überdruckventils. Die Ausgangsspannung (grün) erreicht wieder ihren Maximalwert und das Rauschen des Spannungswertes verschwindet fast vollständig. Zum Zeitpunkt dieser Unterbrechung wurde der gespeicherte Spannungswert erkennbar überschritten (und damit der indirekt durch die Speicherung der Spannung gespeicherte Stromwert unterschritten).
- (ii)
Soweit die Beklagte vorgetragen hat, aus Diagramm 1 lasse sich entnehmen, dass das Öffnen des Überdruckventils und das Abschalten des Pumpenmotors zeitgleich erfolgten (Schriftsatz vom 02.07.2021, S. 8, Bl. 738 GA), hält sie diesen Vortrag nicht mehr aufrecht. Denn sie geht auf die Ausführungen des Sachverständigen, der in seinem Gutachten den zeitlichen Versatz zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Abschalten des Pumpenmotors im Einzelnen herausgearbeitet hat, nicht mehr ein. In späteren Schriftsätzen spricht sie sogar selbst von einem zeitlichen Versatz zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und dem Unterbrechen des Motorstroms. So heißt es an der bereits zitierten Stelle im Schriftsatz der Beklagten vom 19.10.2021, dort S. 3 f., Bl. 805 f. GA: - „… Es ist daher auch nicht überraschend, dass … der zeitliche Abstand zwischen dem Öffnen des Überdruckventiles und dem Abschalten des Pumpenmotors nur geringfügig variiert.“
- (Hervorhebungen hinzugefügt)
- Wollte man dies anders sehen, ist das Vorbringen bzw. Bestreiten der Beklagten jedenfalls unsubstanziiert.
- (iii)
Die Diagramme 2 und 3 (Diagramm 4 entspricht im Wesentlichen dem Diagramm 2) stehen der anhand von Diagramm 1 belegten objektiven Eignung der angegriffenen Ausführungsform zu der dargestellten Funktionsweise nicht entgegen. Die Beklagte führt dazu aus, dass in einem Fall der Grenzwert der Akkuspannung zu hoch und in dem anderen Fall zu niedrig eingestellt sei. Ist der Grenzwert der Akkuspannung zu hoch eingestellt, dann schaltet der Pumpenmotor nach dem Vorbringen der Beklagten bei Erreichen dieses zu hohen Grenzwertes ab, obwohl zu diesem Zeitpunkt das Überdruckventil noch geschlossen ist (Diagramm 2 bzw. Diagramm 4). Ist der Grenzwert für die Akkuspannung hingegen zu niedrig eingestellt, so wird der Pumpenmotor überhaupt nicht abgeschaltet, obwohl der Pressvorgang beendet ist und das Überdruckventil geöffnet hat (Diagramm 3). Die in den genannten Diagrammen dargestellten Messungen sind nach dem eigenen Vortrag der Beklagten also – anders als das Diagramm 1 – nicht mit demjenigen Wert durchgeführt worden, der in der angegriffenen Ausführungsform gespeichert ist. Sie zeigen nicht mehr auf, als dass es möglich ist, in der angegriffenen Ausführungsform einen Grenzwert zu hinterlegen, mit dem die Merkmale des Patentanspruchs 1 nicht verwirklicht werden (vgl. auch GutA S. 28, Bl. 683 GA). Wie bereits ausgeführt, obliegt dem Fachmann die Auswahl des gespeicherten Stromwertes istop. Dass dieser den Wert auch so wählen kann, dass das beanspruchte Verfahren nicht verwirklicht wird, steht einer objektiven Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Durchführung des beanspruchten Verfahrens nicht entgegen. - (2)
Davon ausgehend lässt sich die Verwirklichung der Merkmalsgruppe 6 feststellen. - Nach obiger Auslegung ist eine indirekte Messung der Stromaufnahme des Pumpenmotors für die Merkmalsverwirklichung ausreichend. Zur Ermittlung des Motorstroms geeignet ist die Spannungsmessung unabhängig davon, ob es sich um die Akkuspannung handelt oder ob die Spannung über dem MOSFET gemessen wird (vgl. auch Ergänzungs-GutA S. 6, Bl. 978 GA).
- Es lässt sich aufgrund des als unstreitig zu behandelnden Vorbringens auch der nach obiger Auslegung erforderliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unterschreiten eines gespeicherten Stromwertes – mittelbar durch das Überschreiten des tatsächlich gespeicherten Spannungswertes von 20,8 V – und dem Unterbrechen des Motorstroms sowie die Eignung der angegriffenen Ausführungsform zu einem der Merkmalsgruppe 6 entsprechenden Betrieb im Übrigen feststellen. Eine Erfassung der Strom- bzw. Spannungsaufnahme über den gesamten Arbeitstakt hinweg ist nicht erforderlich.
- Das Argument der Beklagten, es fehle an einer Kausalität zwischen dem Öffnen des Überdruckventils und der Unterbrechung des Motorstroms, führt nicht aus der Verletzung heraus. Ein solcher Kausalzusammenhang ist nach der oben dargetanen Auslegung gerade nicht erforderlich. Es ist deshalb unbeachtlich, dass die Beklagte mit den bereits erwähnten Diagrammen 2 und 3 aufzeigen will, dass das Öffnen des Überdruckventils im Betrieb der angegriffenen Ausführungsform nicht ursächlich für das Unterbrechen des Motorstroms ist.
- (3)
Nachdem sich unter Berücksichtigung des gefundenen Auslegungsergebnisses schon auf der Grundlage des unstreitigen Vorbringens der Parteien die objektive Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Verwirklichung der Merkmale des geschützten Verfahrens feststellen lässt und zudem die eigenen Messungen der Beklagten die entsprechende Eignung belegen, bedurfte es – entgegen der Auffassung der Beklagten – keiner eigenen Messungen des Sachverständigen. - b)
Die weiteren objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung liegen vor. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts (LG-Urteil S. 18 f., 26 f.), gegen die sich die Parteien in der Berufungsinstanz auch nicht gesondert wenden, kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen werden. - 4.
Aus der festgestellten Patentverletzung bzw. -benutzung ergeben sich die folgenden Rechtsfolgen: - a)
Dass die Beklagte der Klägerin aufgrund der mittelbaren Schutzrechtsverletzung zur Auskunftserteilung sowie, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, zum Schadensersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um dieser die Berechnung ihres Schadensersatzanspruchs zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, hat das Landgericht in dem angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Auch auf die diesbezüglichen Ausführungen (LG-Urteil S. 29 f.) kann Bezug genommen werden, wobei der Tenor dem zwischenzeitlichen Erlöschen des Klagepatents und der daraufhin erfolgten – einseitig gebliebenen – Erledigungserklärung der Klägerin Rechnung zu tragen hat. - Soweit im landgerichtlichen Tenor in Bezug auf die von dem Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch erfassten Verletzungshandlungen die angegriffene Ausführungsform konkret bezeichnet war („durch das Anbieten bzw. die Lieferung der B“), konnte die Klägerin den entsprechenden, eher ungewöhnlichen Zusatz in ihrem Antrag streichen, weil hiermit keine Erweiterung oder inhaltliche Änderung des Tenors verbunden ist. Der betreffende Zusatz diente erkennbar bloß der Bezeichnung der konkreten Verletzungsform und war als solcher überflüssig. Dass durch die Aufnahme der Bezeichnung der angegriffenen Ausführungsform in die Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge bzw. in die entsprechenden landgerichtlichen Urteilsaussprüche etwaige identische Ausführungsformen mit anderer Bezeichnung und/oder etwaige kerngleiche Ausführungsformen von der Auskunfts- bzw. Rechnungslegungspflicht ausgenommen werden sollten, ist weder der Klagebegründung der Klägerin noch dem angefochtenen Urteil zu entnehmen. Zur Vermeidung von Unklarheiten kann der in Rede stehende Zusatz deshalb entfallen.
- Dass die Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung in einer geordneten Aufstellung erfolgen muss, ist selbstverständlich und bedurfte daher keiner besonderen Erwähnung im Urteilstenor (OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.11.2021 – I-15 U 25/20, GRUR-RS 2021, 37635 Rn. 113 – Sanitäre Einsetzeinheit).
- Soweit in den Auskunfts- und Rechnungslegungsanträgen der Klägerin sowie in den hierauf beruhenden Urteilsaussprüchen des Landgerichts hinsichtlich der zu erteilenden Angaben jeweils der Zusatz „soweit zutreffend“ enthalten war, hat der Senat auch diesen Zusatz nicht in den neugefassten Urteilstenor aufgenommen, da dieser Anlass zu Missverständnissen geben könnte. In welchem Umfang die Beklagte zur Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung verpflichtet ist, ergibt sich aus dem Tenor. Die Beklagte hat der Klägerin die dort aufgelisteten Daten und Informationen mitzuteilen. Soweit einzelne Punkte auf sie nicht zutreffen, hat sie insoweit Fehlanzeige zu erstatten. Der Senat geht davon aus, dass eben dies auch mit dem in den Auskunfts- und Rechnungslegungsanträgen ursprünglich enthaltenen Zusatz zum Ausdruck gebracht werden sollte.
- b)
Der Klägerin stand auch ein Unterlassungsanspruch in dem vom Landgericht tenorierten Umfang aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG zu. Auch insoweit kann auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts verwiesen werden (LG-Urteil S. 29). Die insoweit zulässig und begründete Klage ist durch das Erlöschen des Klagepatents durch Zeitablauf unbegründet worden, weswegen insoweit die Erledigung in der Hauptsache festzustellen war. - c)
Entgegen der Auffassung des Landgerichts steht der Klägerin ein Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten hingegen weder aus §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB noch aus § 139 Abs. 2 PatG – den allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen – zu. - Ein Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten besteht nur, wenn die Abmahnung berechtigt war. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn der mit ihr geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht (BGH, GRUR 2017, 793 Rn. 16 – Mart-Stam-Stuhl; GRUR 2019, 1044 Rn. 12 – Der Novembermann). Für den Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten kommt es dabei auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Abmahnung an (BGH, GRUR 2010, 1120 Rn. 17 – Vollmachtsnachweis; GRUR 2011, 532 Rn. 14 – Millionen-Chance II; GRUR 2011, 617 Rn. 29 – Sedo; BGH, Urt. v. 28.09.2011 – I ZR 145/10, BeckRS 2011, 25516 Rn. 8 – Erstattung von Abmahnkosten). Entscheidend ist mithin, ob dem Abmahnenden im Augenblick der Abmahnung gegen den Abgemahnten der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zustand (BGH, GRUR 2011, 532 Rn. 14 – Millionen-Chance II).
- Daran gemessen hat die Klägerin keinen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten, weil es im Zeitpunkt der Abmahnung an deren Berechtigung gefehlt hat. Die Klägerin hat mit ihrer Abmahnung (Anlage B 8) ausweislich der von ihr vorformulierten strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (allein) einen auf das Unterlassen der Anwendung sowie des Angebots des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Klagepatents gerichteten Unterlassungsanspruch wegen dessen unmittelbarer Verletzung geltend gemacht. Dass ihr ein entsprechender Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte im Zeitpunkt der Abmahnung zustand, zeigt die Klägerin, die ihre darauf gerichtete Klage bereits in erster Instanz zurückgenommen hat, nicht schlüssig auf. Soweit sie auf eine von der Beklagten durchgeführte Funktionsprüfung der angegriffenen Ausführungsform verwiesen hat, wird das geschützte Verfahren jedenfalls durch die auf Erprobung einer zu seiner Ausführung dienenden Maschine auf ordnungsgemäßem Gang nicht im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 2 PatG angewendet (vgl. Benkard-Scharen, PatG, 12. Aufl., § 9 Rn. 49 a)). Weiteren Vortrag hat die Klägerin hierzu nicht geliefert. Einen auf eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gestützten Unterlassungsanspruch hat die Klägerin mit der Abmahnung jedenfalls nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Da es sich bei dem auf eine unmittelbare und dem auf eine mittelbare Verletzung gestützten Unterlassungsanspruch – auch im Sinne der Streitgegenstandslehre – um unterschiedliche Lebenssachverhalte handelt (vgl. BGH, GRUR 2005, 407 (409) – T-Geschiebe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.3.2019 – I-2 U 114/09, GRUR-RS 2019, 6081 Rn. 30 – Mehrpolige Steckverbindung; Urt. v. 21.07.2022 – I-2 U 12/20, GRUR-RS 2022, 19383 Rn. 113 f. – Drucksensoradapter), verbietet sich schließlich auch eine Sichtweise, wonach die auf eine unmittelbare Verletzung gestützte Abmahnung diejenige wegen einer mittelbaren Verletzung als eine Art Minus einschließt.
- 5.
Der Durchsetzbarkeit der Ansprüche der Klägerin steht die von der Beklagten in erster Instanz erhobene „Einrede der Verjährung/Verwirkung“ auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Verjährung der Ansprüche entgegen. Hierin mag zwar eine wirksame Erhebung der Einrede der Verjährung (§ 214 Abs. 1 BGB) liegen. Die Beklagte hat jedoch die Voraussetzungen einer Verjährung der Klageansprüche nicht dargelegt. - Die Beklagte hat insbesondere nicht aufzuzeigen vermocht, dass die Klägerin vor der im Jahr 2017 erfolgten Abmahnung der Beklagten Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Patentverletzung hatte und die allein in Betracht kommende regelmäßige Verjährungsfrist somit nach § 141 S. 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 BGB zu laufen begonnen hat. Insbesondere lässt sich aus dem bloßen Verweis auf den Kauf eines Testgeräts durch die Klägerin im Februar 2015 und die daraufhin im Oktober 2015 gestellte Berechtigungsanfrage nicht ableiten, dass die Klägerin zu diesem Zeitpunkt bereits positive Kenntnis von der Patentverletzung hatte. Im Gegenteil zeigt gerade der Umstand, dass die Klägerin sich zunächst nur zu einer Berechtigungsanfrage entschieden hat, dass sie sich einer Patentverletzung nicht sicher war. Von einer grob fahrlässigen Unkenntnis der Klägerin kann ohne entsprechenden Vortrag seitens der Beklagten, an dem es vorliegend fehlt, ebenfalls nicht ausgegangen werden. Es besteht auch keine grundsätzliche Obliegenheit eines Patentinhabers zur abschließenden Klärung einer möglichen Patentverletzung nach einem Testkauf, bei deren Missachtung ohne Darlegung der näheren Umstände von einer grob fahrlässigen Unkenntnis auszugehen wäre.
- Nachdem die regelmäßige Verjährungsfrist somit frühestens im Jahr 2017 zu laufen begonnen hat, kann diese nicht vor dem Ende des Jahres 2020 geendet haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Verjährung indes bereits durch die Erhebung der Klage einschließlich der hilfsweisen Geltendmachung der Ansprüche wegen mittelbarer Patentverletzung gehemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 253 Abs. 1 ZPO).
- 6.
Hinsichtlich der fehlenden Verwirkung kann wiederum zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts verwiesen werden (LG-Urteil S. 28). Die Beklagte beruft sich hierauf in der Berufungsinstanz auch nicht mehr. - C.
- Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.
- Eine Korrektur der Kostenentscheidung erster Instanz kam nicht in Betracht. Bei einer so genannten gemischten Kostenentscheidung bedarf es zur Anfechtung ihres „hauptsachelosen“ Teils einer (zulässigen) Anschlussberufung (Musielak/Voit-Ball, 21. Aufl., § 524 Rn. 9; BeckOK ZPO-Wulf, 52. Ed., § 524 Rn. 8; insoweit auch MüKo ZPO-Rimmelspacher, 6. Aufl., § 524 Rn. 18), an der es hier seit der Rücknahme der Anschlussberufung seitens der Klägerin fehlt.
- Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
- Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
- Bei der Festsetzung des Berufungsstreitwertes hat der Senat berücksichtigt, dass es der Beklagten als Berufungsklägerin um die Beseitigung ihrer Verurteilung wegen der mittelbaren Patentverletzung geht und die Klägerin als Patentinhaberin ihr Interesse an der Untersagung der mittelbaren Patentverletzung noch in der Berufungsinstanz auf 600.000,- Euro beziffert hat (Schriftsatz der Klägerin vom 13.09.2019, S. 8, Bl. 347 GA).