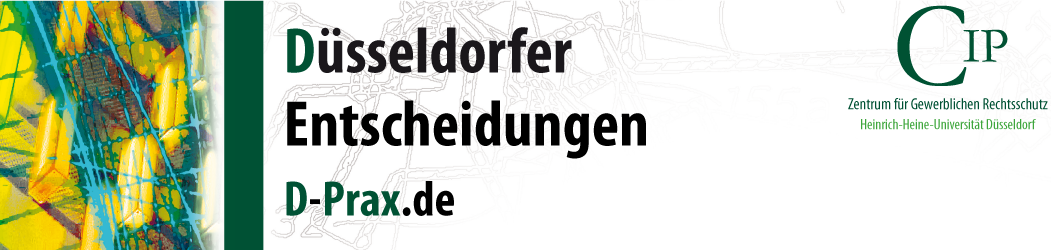Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3416
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 8. Oktober 2024, I-2 U 58/19
Vorinstanz: 4b O 39/17
- I. Die Berufung der Klägerin gegen das am 19.09.2019 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Tenor hinsichtlich der Kostenentscheidung im landgerichtlichen Urteil wie folgt geändert wird:
- Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz sowie die erstinstanzlichen Kosten der Streithilfe trägt die Klägerin.
- II. Die Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die zweitinstanzlichen Kosten der Streithilfe zu tragen.
- III. Dieses Urteil ist für die Beklagte und ihre Streithelferin wegen ihrer Kosten vorläufig vollstreckbar.
- Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten sowie ihrer Streithelferin wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund des Urteils jeweils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte und ihre Streithelferin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
- IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
- V. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.000.000,- EUR festgesetzt.
- Gründe:
- I.
- Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 021 XXX (nachfolgend: Klagepatent) betreffend ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz und dentalen Hilfsteilen. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte noch auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie auf Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz und zur Leistung einer angemessenen Entschädigung in Anspruch.
- Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 21.12.1999 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 19.01.1999 eingereicht und am 26.07.2000 im Patentblatt veröffentlicht. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 09.05.2007 im Patentblatt bekannt gemacht. Das Klagepatent ist mit Ablauf des 21.12.2019 durch Zeitablauf erloschen.
- Gegen die Erteilung des Klagepatents ist von dritter Seite Einspruch eingelegt worden. Die Streithelferin der Beklagten ist dem Einspruchsverfahren beigetreten. Mit Entscheidung vom 02.12.2011 (schriftliche Entscheidungsgründe vorgelegt als Anlage PP 16; nachfolgend: Entscheidung Einspruchsabteilung I) hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts das Klagepatent zunächst widerrufen. Auf die Beschwerde der Klägerin hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts diese Entscheidung am 05.06.2014 aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen (schriftliche Entscheidungsgründe vorgelegt als Anlage PP 17; nachfolgend: Entscheidung TBK I). Daraufhin hat die Einspruchsabteilung das Klagepatent durch Entscheidung vom 20.05.2016 in beschränkter Form aufrecht erhalten (schriftliche Entscheidungsgründe vorgelegt als Anlage PP 19a; nachfolgend: Entscheidung Einspruchsabteilung II). Gegen diese Entscheidung haben u.a. die Klägerin und die Streithelferin der Beklagten Beschwerde eingelegt. Die Beklagte ist dem Einspruchsbeschwerdeverfahren beigetreten. Durch Entscheidung vom 16.12.2019 (schriftliche Entscheidungsgründe vorgelegt als Anlage BE 1/Anlage K 21a; nachfolgend: Entscheidung TBK II) hat die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben und die Angelegenheit mit der Anordnung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen, das Klagepatent im eingeschränkten Umfang gemäß einem Hilfsantrag der Klägerin (Hilfsantrag c‘) aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss des Einspruchsverfahrens wurde eine neue Patentschrift (B2-Schrift) veröffentlicht.
- Der aufrechterhaltene Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet gemäß der B2-Schrift wie folgt:
- „Anwendung des Ds, bei dem aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise Formkörper aufgebaut werden, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, wobei die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren, zur Herstellung von Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken, oder Inlays, mit der Maßgabe,
- – dass das Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff von unterschiedlicher Korngröße zwischen 0 und 50 μm besteht.“
- Die in der Dentalbranche tätige Beklagte stellt Zahnersatz wie z.B. Kronen, Brücken und Inlays her. Dazu verwendet sie u.a. mehrere „H“-Anlagen. Herstellerin und Lieferantin dieser Anlagen ist die Streithelferin der Beklagten. In den von der Beklagten benutzten „H“-Anlagen kommen Pulverwerkstoffe zur Anwendung, die die Beklagte ebenfalls von ihrer Streithelferin bezieht. Dabei handelt es sich zum einen um den Pulverwerkstoff mit der Bezeichnung „remanium star CL“, eine CoCr (Kobalt-Chrom)-Pulverlegierung mit – nach den Angaben auf der Verpackung – einer Korngröße zwischen 10 und 30 μm, und zum anderen um den Pulverwerkstoff mit der Bezeichnung „rematitan CL“, eine Titan-Pulverlegierung.
- Bei dem von der Beklagten mit den „H“-Anlagen durchgeführten Herstellungsverfahren werden mittels Laser durch Energieeintrag die zur Herstellung des Zahnersatzes lageweise aufgebrachten Pulverwerkstoffe vollständig aufgeschmolzen, wobei im Laserfokus ein „Schmelzpool“ gebildet wird, der auch in die Oberfläche der darunter liegenden Schicht eindringt. Die aufgeschmolzenen Pulverkörner geben ihre Form vollständig auf, werden in einen schmelzflüssigen Zustand gebracht, gehen eine metallurgische Verbindung ein und bilden nach Abkühlen bzw. Erstarren eine einheitliche Schicht.
- Die Streithelferin der Beklagten ist aufgrund eines mit einem ausschließlichen Lizenznehmer geschlossenen Lizenzvertrags (Anlage PP 9) zur Nutzung des dem C-Instituts erteilten europäischen Patents 0 946 XXX (Anlage PP 8), das die Bezeichnung „XXX“ trägt und auf einer unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 196 49 XXX vom 02.12.1996 am 27.10.1997 eingereichten Anmeldung beruht, die am 06.10.1999 veröffentlicht wurde, berechtigt. Ebenso ist sie zur Nutzung des deutschen Prioritäts-Patents 196 49 XXX (Anlage PP 10) berechtigt, dessen Erteilung am 12.02.1998 veröffentlicht wurde (nachfolgend in Bezug auf beide vorbezeichneten Patente auch: C-Patent).
- Die Klägerin sieht in Herstellung und Vertrieb von Kronen, Brücken oder Inlays, die von der Beklagten mittels der vorbezeichneten Anlagen und Pulver hergestellt werden (angegriffene Ausführungsform), eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents.
- Mit einer im Jahr 2017 beim Landgericht Mannheim eingereichten Klage hat sie auch die Streithelferin der Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents in Anspruch genommen. Diese Klage hat das Landgericht Mannheim durch Urteil vom 14.11.2017 (Az.: 2 O 36/17, Anlage PP 6) abgewiesen. Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Berufung zum Oberlandesgericht Karlsruhe (Az.: 6 U 151/17) eingelegt, über die bislang noch nicht entschieden worden ist.
- Die Klägerin hat im vorliegenden Rechtsstreit vor dem Landgericht geltend gemacht:
- Die Beklagte mache von der Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents unmittelbar und wortsinngemäß Gebrauch. Der Begriff „Laser-Sintern“ sei vom Fachmann zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents dahingehend verstanden worden, dass er sowohl das Anschmelzen als auch das vollständige Auf- bzw. Durchschmelzen eines Pulvers durch die Energie eines Laserstrahls umfasse. Dies ergebe sich u.a. aus den von ihr als Anlagen K 11 bis K 14 vorgelegten Literaturstellen aus den Jahren 1996 bis 2000. So sei auch der Begriff „Laser-Sintern“ im Klagepatent zu interpretieren. Umfasst sei damit auch das vollständige Auf- bzw. Durchschmelzen der Pulverkörner. Die gegenteilige Auffassung verkenne insbesondere, dass das Sintern gerade auch das vollständige Aufschmelzen der kleineren Pulverkörner beinhalte. Jedenfalls werde von der Lehre des Klagepatents mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln Gebrauch gemacht.
- Die Beklagte und ihre Streithelferin haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gebeten. Sie haben geltend gemacht:
- Die Beklagte verletze das Klagepatent weder wortsinngemäß noch äquivalent. Mit den „H“-Anlagen werde kein D im Sinne des Klagepatents, sondern ein Laserschmelzverfahren gemäß dem C-Patent durchgeführt. Die Fertigungsautomaten arbeiteten nach eben diesem Patent, das gerade kein Laser-Sintern im Sinne des Klagepatents beinhalte. „Sintern“ zeichne sich allgemein und auch im Falle des „Laser-Sinterns“ dadurch aus, das ein vollständiges Durchschmelzen gerade vermieden werde. Das Laserschmelzverfahren nach dem C-Patent habe demgegenüber erstmals ein vollständiges Aufschmelzen ermöglicht. Eine kommerzielle Laser-Schmelzanlage zum Laserschmelzen fluss- und bindemittelfreier metallischer Pulverwerkstoffe habe allerdings am Prioritätstag des Klagepatents noch nicht existiert; eine solche Anlage, die das Verfahren des C-Patents angewandt habe, sei von der Streithelferin erst im Jahre 2001 vorgestellt worden. Die Klagepatentschrift vermittele dem Fachmann die Lehre, dass sich die Erfindung nach dem Klagepatent ausschließlich auf einen Laser-Sintervorgang beziehe, bei dem die Pulverbestandteile nur oberflächlich angeschmolzen würden. Ein Laserschmelzverfahren, bei dem die Pulverbestandteile vollständig auf- bzw. durchgeschmolzen würden, sei dagegen nicht Gegenstand des Klagepatents und falle nicht in dessen Schutzbereich.
- Durch Urteil vom 19.09.2019 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
- Der Begriff des Laser-Sinterns umfasse nur die Behandlung des sinterfähigen Pulvers dahingehend, dass die Pulverkörner oberflächig angeschmolzen und so die Körner zu Schichten und die Schichten miteinander verbunden würden. Er umfasse nicht auch das Durchschmelzen der gesamten Pulverkörner, was hier als Laserschmelzverfahren bezeichnet werde. Das Klagepatent liefere in Absatz [0004] eine Beschreibung dessen, was unter Laser-Sintern zu verstehen sei. Danach würden durch die Energiezufuhr die jeweils betroffenen Pulverbestandteile „oberflächig angeschmolzen“ und gingen dadurch miteinander eine feste Bindung ein. Das Klagepatent bringe damit zum Ausdruck, dass es bei der Verwendung des Begriffs „Sintern“ dem allgemein-technischen Sprachgebrauch folge, wonach Sintern nur ein „oberflächliches Anschmelzen“ sei. Soweit die Klägerin geltend mache, der Begriff „Pulverbestandteile“ beziehe sich nicht auf die einzelnen Pulverkörner, sondern auf die gesamte Pulverschicht, stehe dieses Verständnis im Widerspruch zum geforderten „oberflächigen“ Anschmelzen und finde auch sonst keinen Anhalt in der Klagepatentschrift. Die Richtigkeit dieses Verständnisses werde durch die Angaben in den Absätzen [0005], [0008] und [0007] bestätigt: Zu Hohlräumen oder geringer Dichte könnten vollständig aufgeschmolzene Körner nicht führen. Die Gefahr einer Entmischung folge aus dem Aufschmelzen als solchem. Eine gewisse Rauigkeit der Sinteroberfläche ergebe sich daraus, dass die Körner nicht vollständig aufgeschmolzen würden. Die vorgelegten Bilder zeigten, dass sich die Oberfläche im Laserschmelzverfahren erstellter Körper von der Oberfläche im D erstellter Körper substantiell unterscheide; der gesinterte Körper sei wesentlich rauer. Soweit die Beklagte geltend mache, dass einzelne, vor allem kleinere Partikel vollkommen aufgeschmolzen würden, rechtfertige dies keine andere Auslegung. Wenn planmäßig keine vollständige Schmelze erreicht werden solle und solange die charakteristischen Eigenschaften wie die Körnigkeit des Produkts (z.B. raue Oberfläche) erhalten blieben, handele es sich gleichwohl um ein Sintern. Ob der Begriff des „Laser-Sinterns“ zum Prioritätszeitpunkt im technischen Sprachgebrauch auch für Prozesse verwendet worden sei, die hier als „Laserschmelzverfahren“ bezeichnet würden, könne dahinstehen. Denn das von der Klägerin vorgetragene Verständnis sei keineswegs darauf festgelegt gewesen, dass solche Verfahren stets auch zum Laser-Sintern zu zählen seien. Aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen lasse sich entsprechendes nicht herleiten. Im Übrigen lege sich das Klagepatent, das sein eigenes Lexikon sei, auf eine Verwendung des Begriffs „Laser-Sintern“ fest, der dem hergebrachten technischen Verständnis des Wortes „Sintern“ entspreche.
- Hiervon ausgehend scheide eine wortsinngemäße Patentverletzung aus. Das von der Beklagten durchgeführte Verfahren sei kein D im Sinne des Klagepatents, weil bei diesem die Körner vollständig aufgeschmolzen würden. Eine äquivalente Patentverletzung liege ebenfalls nicht vor. Es fehle bereits an der erforderlichen Gleichwirkung. Die spezifischen Vorteile des patentgemäßen Ds beruhten gerade auf dem Umstand, dass ein vollständiges Durchschmelzen des Pulvers unterbleibe. Folge seien die raue Oberfläche und das Unterbleiben einer Entmischung der Legierung. Darüber hinaus fehle es aber auch an der Gleichwertigkeit. Da es sich bei dem Klagepatentanspruch um einen Verwendungsanspruch handele, mit dem lediglich eine neue Verwendung eines bereits bekannten Verfahrens geschützt werde, sei es notwendigerweise ausgeschlossen, ein anderes Verfahren für dieselbe Verwendung als der erfindungsgemäßen Lösung gleichwertig anzusehen.
- In der Berufungsinstanz haben die Parteien mit Blick auf das Erlöschen des Klagepatents durch Zeitablauf den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
- Im Übrigen verfolgt die Klägerin mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung ihr erstinstanzlich erfolglos gebliebenes Begehren weiter. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags macht sie geltend:
- Das Landgericht habe die zentrale Beschreibungsstelle sowie gegenteilige Hinweise der Patentbeschreibung missverstanden und zudem all jene Hinweise missachtet, die den Fachmann vor dem Hintergrund seines herkömmlichen Verständnisses des Begriffs „Laser-Sintern“ zu einem anderen Verständnis führten. Die Beschreibungspassage in Absatz [0004] gebe dem Fachmann keinerlei Anlass, anzunehmen, dass er versuchen solle, den Prozess des Laser-Sinterns in einer bestimmten Weise einschränkend zu steuern, so dass Pulverkörner (jeweils einzeln) nur oberflächlich angeschmolzen, nicht jedoch vollständig durchgeschmolzen würden. Die das klagepatentgemäße Herstellungsverfahren charakterisierende Eigenschaft des D liege darin, dass im Zuge der schichtweisen Herstellung durch den Laser jeweils nur eine oberflächige Anschmelzung derjenigen Pulverbestandteile erfolge, die durch die gespeicherten räumlichen Daten des gewünschten Formkörpers diesen Formkörper in der jeweiligen Schicht (also an der Oberfläche des jeweiligen Laserdurchlaufs) ausbilden sollten. Wenn vom oberflächigen Anschmelzen der „Pulverbestandteile“ die Rede sei, seien dies nicht die „Pulverkörner“, sondern die Schichten, um die es in dem betreffenden Absatz der Patentbeschreibung gehe. Was die Vorteilsangaben in Absatz [0005] anbelange, habe die dichte Packung der Körner den Vorteil, dass nach Anwendung der Laser-Sinterung nahezu keine Hohlräume verblieben. Dieser Vorteil unterscheide jedoch nicht zwingend zwischen „oberflächigem Anschmelzen“ einerseits und „Durchschmelzen“ andererseits. Denn auch beim vollständigen Durchschmelzen blieben Hohlräume bestehen. Durch den angesprochenen Vorteil unterscheide sich das klagepatentgemäße Verfahren vielmehr grundlegend von den herkömmlichen, insbesondere in Absatz [0001] adressierten Verfahren, von denen sich das Klagepatent absetzen wolle. In Bezug auf Absatz [0008] der Patentbeschreibung sei das Landgericht einem vergleichbaren Irrtum aufgesessen. Das Klagepatent hebe dort die Vorteile gegenüber herkömmlichen Gussverfahren hervor; bei letzteren bestehe die Gefahr der Entmischung. Der betreffende Vorteil kennzeichne hingegen nicht spezifisch ein Verfahren, bei dem die Körner nur oberflächlich angeschmolzen würden, sondern jegliches D im weiten Sinne. Dadurch, dass bei diesen die flüssige Phase nur während ganz kurzer Zeit bestehe, sei hier nämlich die Gefahr einer Entmischung von vornherein gebannt. Hinsichtlich der in Absatz [0007] angesprochenen Rauigkeit stelle das Klagepatent lediglich auf die Sinteroberfläche ab, stelle aber keinen Zusammenhang mit einer vermeintlich oberflächigen Anschmelzung her. Auch werde dort lediglich betont, dass eine besonders gute Eignung „für eine Verblendung“ erreicht werde. Ein Vergleich zwischen einem oberflächigen Anschmelzen und einem vollständigen Durchschmelzen werde nicht angestellt. Sowohl bei einem vollständigen Durchschmelzen als auch bei einem oberflächigen Anschmelzen werde eine für ein Verblenden besonders gut geeignete gewisse Rauigkeit erreicht. Die Klagepatentbeschreibung wolle die Erfindung mithin insbesondere gegenüber den herkömmlichen Gussverfahren abgrenzen, bei denen eine Schmelze (flüssige Phase) über einen ausreichend langen Zeitraum hin aufrechterhalten werde und bei denen deshalb einerseits die Gefahr der Entmischung bestehe, andererseits aber die ursprüngliche „Packungsdichte“ einerlei gewesen sei und bei denen sich eine für die Verblendung ungeeignete Oberfläche ergeben habe. Damit komme es letztlich maßgeblich auf das zum Prioritätszeitpunkt übliche Wortverständnis des Fachmanns an. Dieses habe sie, die Klägerin, anhand der in erster Instanz vorgelegten Unterlagen erläutert. Der Begriff „Laser-Sintern“ umfasse hiernach auch das Durchschmelzen. Diese Patentauslegung werde durch den aufrechterhaltenen Patentanspruch 3 bestätigt, der einen Formkörper betreffe, der schichtweise mittels eines „Rapid-Prototyping-Verfahrens“ aufgebaut sei. Daraus ergebe sich, dass das patentgemäße D im Kern nichts anderes sei als das zum Prioritätsdatum bekannte Rapid-Prototyping-Verfahren.
- Soweit die Beklagte und ihre Streithelferin in der Berufungsinstanz die Auffassung verträten, dass anspruchsgemäß ein bestimmter (bimodaler, trimodaler oder kontinuierlicher) Korngrößenverlauf für eine besonders hohe Schüttdichte vorgegeben sei, seien derartige Korngrößenverläufe schon nicht mit vertretbarem Aufwand herstellbar. Eine Auslegung des Klagepatents auf der Grundlage von theoretischen Betrachtungen im Hinblick auf das zu verwendende Pulver, wie sie die Beklagte und ihre Streithelferin anstellten, komme nicht in Betracht. Sie, die Klägerin, habe bei einem namhaften Hersteller für Pulver zur Verwendung in der pulvermetallurgischen Fertigung wie dem Laser-Sintern nach einer Lieferung von Pulver mit dem von der Beklagtenseite argumentativ angeführten Korngrößenverlauf (jeweils näher bestimmte Gaußsche, bimodale, trimodale und kontinuierliche Korngrößenverteilung) angefragt und als Antwort erhalten, dass lediglich das Pulver mit der Gaußschen Korngrößenverteilung angeboten werden könne. Üblicherweise sei zum Prioritätszeitpunkt ein Pulver verwendet worden, das durch eine Unter- und eine Obergrenze bei gaußförmiger Verteilung der Korngrößen in dem dadurch definierten Bereich charakterisiert worden sei. Ein solches Pulver habe zum Prioritätszeitpunkt für viele biokompatible Materialien durch entsprechende Parameterwahl bei der Pulververdüsung unmittelbar erhalten werden können. Im Übrigen sei das Vorhandensein von Pulvern unterschiedlicher Korngröße nicht nur beim oberflächlichen Anschmelzen, sondern auch bei einem vollständigen Durchschmelzen der Körner von Vorteil. Bei einem vollständigen Durchschmelzen werde hierdurch vermieden, dass eine Pulverschicht beim Aufschmelzen der Pulverkörner in größerem Ausmaß in Folge der Beseitigung von Hohlräumen in sich zusammensacke und darum schrumpfe, wodurch sich Schichtunebenheiten bildeten, welche sowohl die Abmessung und Passgenauigkeit des Formkörpers als auch dessen dichte Sinterung behindern würde.
- Bei der Annahme, Einkomponentenpulver seien am Prioritätszeitpunkt nur Gegenstand der Forschung gewesen, dürften die Materialien Gold und Kunststoff nicht außer Betracht bleiben. Sowohl Gold als auch Kunststoff stellten Materialien dar, die dem Fachmann als geradezu klassische Werkstoffe für Kronen, Brücken oder Inlays weit vor dem Prioritätstag bereits bekannt gewesen seien. Das Klagepatent verweise in Absatz [0001] auf Edelmetall und für den dies lesenden Dentalfachmann sei völlig klar, dass hiermit die Verwendung von Gold mit angesprochen und sogar hauptsächlich gemeint sei. Ebenfalls sei es bereits weit vor dem Prioritätstag nicht nur bekannt, sondern durchaus üblich gewesen, Kronen, Brücken und Inlays aus Kunststoff herzustellen, um damit beispielsweise eine provisorische Versorgung herzustellen.
- Die Klägerin legt in der Berufungsinstanz eine gutachterliche Stellungnahme von Dr.-Ing. G (Anlage K 34) vor und trägt hierzu unter anderem vor: Der patentgemäße Schmelzmechanismus könne bereits aus technischen Zwängen heraus keine oberflächige Anschmelzung der Pulverkörner sein. Bei Ausrichtung der Laserenergie gemäß der Mindestanforderung, wonach alle – auch die großen – Pulverkörner überhaupt (an)geschmolzen werden sollten, würden mehr als 90 % der Pulverkörner vollständig durchschmelzen. Ein nur oberflächiges Anschmelzen der Pulverkörner insgesamt sei nicht möglich. Wenn man die Laserleistung hingegen so reduziere, dass die Körner mit mittlerer Korngröße oberflächlich angeschmolzen würden, resultiere hieraus dennoch, dass nahezu die Hälfte aller Pulverkörner vollständig durchgeschmolzen, die größeren Pulverkörner hingegen gar nicht mehr angeschmolzen würden, sondern lediglich lose oder allenfalls diffusionsverbunden im Verband verblieben. Diesem Verständnis stehe also nicht nur die technische Nichtmachbarkeit gegenüber, sondern auch, dass der Fachmann sich dem Patent mit der Erwartung nähere, dass er als Ergebnis brauchbaren Zahnersatz erhalte und nicht einen losen und von Poren durchsetzten Schichtverbund. Die Einwände der Beklagten und ihrer Streithelferin gegen das von ihr vorlegte Privatgutachten griffen nicht durch. Die Gaußsche Verteilungskurve der Pulverkorngrößen sei keineswegs eine willkürliche Annahme, sondern das normale Resultat eines technischen Pulverherstellungsprozesses, der sog. Gasverdüsung. Zum Zeitrang des Klagepatents seien derartige Pulver verfügbar gewesen und für das Laser-Sintern eingesetzt worden.
- Der vom Klagepatent angesprochene Fachmann sei ein Dentaltechniker mit Laser-Sinterkenntnissen oder ein Team aus einem solchen Dentaltechniker und einem Laser-Sinterfachmann. Ein Dentaltechniker wisse, dass der als Ergebnis des patentgemäßen „Laser-Sinterns“ zu erhaltene Formkörper mindestens eine Dichte von 99 % aufweisen müsse, um als Zahnersatz nutzbar zu sein. Der Laser-Sinter-Fachmann wisse demgegenüber, dass er diese Dichte nicht erreichen könne, indem er ein bimodales, trimodales oder kontinuierliches Pulver einsetze und bei dem Laser-Sintern dieses Pulvers nur die Oberfläche der Körner anschmelze. Er wisse auch, dass die Dichte von 99 % im D nur erreicht werde, wenn die Körner vollständig durchgeschmolzen würden.
- Erstmals mit der Berufungsreplik macht die Klägerin weiterhin geltend: Die Erwägungen im landgerichtlichen Urteil zur Äquivalenz knüpften in vollständiger Übereinstimmung an die zur Auslegung des streitigen Anspruchsmerkmals herangezogenen Textstellen der Beschreibung an. Jedoch könnten, wie dargelegt, weder die Wirkung und Vorteile hinsichtlich der Dichte noch der gewissen Rauigkeit oder der Gefahr der Entmischung in tatsächlicher Weise einen technischen Unterschied zwischen einem Verfahren, bei dem jedes Pulverkorn oberflächig angeschmolzen werde und einem Verfahren, bei dem mehr oder weniger alle Pulverkörner vollständig aufgeschmolzen würden, begründen, wenn hiermit eine Krone, eine Brücke oder ein Inlay hergestellt werde. Diese Wirkungen und Vorteile könnten daher weder eine fehlende Gleichwirkung noch eine fehlende Gleichwertigkeit begründen.
- Die Klägerin beantragt,
- das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19.09.2019 wie folgt abzuändern:
- I. Die Beklagte wird verurteilt,
- 1. der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 30.09.2005 bis zum 20.12.2019
- Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken oder Inlays, angeboten, hergestellt oder in Verkehr gebracht hat,
- wenn diese unter Verwendung des Lasersinterverfahrens aus einem sinterfähigen Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff von unterschiedlicher Korngröße zwischen 0 und 50 µm hergestellt sind, bei dem
- aus dem sinterfähigen Pulver schichtweise ein Formkörper aufgebaut wird,
- indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Schmelzen führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, und
- die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren,
- und zwar unter Angabe
-
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,
-zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, unter Einschluss insbesondere der Angabe des erzielten Umsatzes, -
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Inhalten,
Leistungsentgelten sowie unter Einschluss der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, - c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Kosten und des erzielten Gewinns,
- wobei die Beklagte die Richtigkeit der Angaben nach lit. a) durch Übermittlung entsprechender Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine nachzuweisen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen,
- und wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,
- und wobei die Beklagte die Angaben vorstehend zu d) erst für die Zeit seit dem 10.06.2007 zu machen hat;
- 2. die in ihrem unmittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl einem von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
- 3. die unter Ziffer I. 1. beschriebenen, frühestens seit dem 09.05.2007 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich („Urteil des … vom …“) festgestellten, patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie Kosten der Rückgabe wie für Verpackung, Transport oder Lagerung zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
- II. Es wird festgestellt,
- 1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 30.09.2005 bis 09.06.2007 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
- 2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten und zwischen dem 10.06.2007 und dem 20.12.2019 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- Die Beklagte und ihre Streithelferin beantragen,
- die Berufung zurückzuweisen.
- Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil als zutreffend und treten dem Berufungsvorbringen der Klägerin im Einzelnen entgegen, wobei sie – im Wesentlichen inhaltsgleich – geltend machen:
- Vom Schutzumfang des Klagepatents sei nur ein D umfasst, bei dem die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächlich angeschmolzen würden und dadurch eine feste Verbindung eingingen. Ein Phasenübergang (fest-flüssig-fest) der Pulverbestandteile erfolge dabei nicht. Nicht erfasst sei dagegen ein Laserschmelzverfahren, bei dem die Pulverbestandteile vollständig auf- bzw. durchgeschmolzen würden, so dass ein Phasenübergang der Pulverbestandteile erfolge. Das Landgericht sei von einem richtigen allgemein-technischen Sprachgebrauch des Begriffs „Sintern“ ausgegangen. Ein Sinterverfahren sei danach dadurch gekennzeichnet, dass jedenfalls die Hauptkomponenten nur auf eine Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur erhitzt würden, also nicht vollständig auf- oder durchschmölzen. Aus Absatz [0004] der Klagepatentschrift ergebe sich, dass das Klagepatent diesem allgemein-technischen Sprachgebrauch folge. Die Verwendung des Begriffs „D“ stelle lediglich klar, dass der vermeintlichen Erfindung eine Auswahl eines bestimmten Verfahrens, nämlich des selektiven Ds, aus der Vielzahl an D-Verfahren zugrunde liege. Der Begriff „Pulverbestandteile“ könne nicht mit „Pulverschicht“ gleichgesetzt werden. Absatz [0004] der Klagepatentschrift befasse sich erkennbar mit dem Entstehen einer Schicht aus dem oberflächlichen Anschmelzen der jeweils betroffenen Pulverbestandteile in Form der Pulverkörner, nicht aber mit dem Verhältnis verschiedener Schichten zueinander. Die Formulierung „oberflächige Anschmelzung“ beziehe sich demnach allein auf die innerhalb einer Pulverschicht und nicht auf die zwischen zwei übereinanderliegenden Pulverschichten erfolgende Verbindung der Pulverbestandteile in Form der einzelnen Körner miteinander. In Absatz [0005] werde nur ein klassisches Sinterverfahren angesprochen, bei dem die Pulverkörner in ihrer Lage und Struktur grundsätzlich erhalten blieben. Bei vollständigem Aufschmelzen der Körner, wie es in der von der Klägerin in Bezug genommenen Literaturstelle beschrieben sei, bildeten sich hingegen große Schmelzkugeln aus. Zwischen diesen bildeten sich dann Hohlräume aus, welche nichts mehr mit dem von dem Korngrößenverlauf des Ausgangspulvers abhängigen Zwischenräumen zwischen den losen Pulverkörnern zu tun hätten. Ein solches Verfahren werde daher in der Patentbeschreibung nicht angesprochen. Erst recht gelte dies für das Laserschmelzverfahren nach dem C-Patent. Bei diesem würden nämlich die Pulverbestandteile mehrfach vollständig durchgeschmolzen, wodurch eine einheitliche Schmelze entstehe, bei der sich die Hohlräume zwischen den Schmelzkugeln gerade nicht mehr fänden. Die in Absatz [0007] erwähnte Rauigkeit der Sinteroberfläche sei eine zwingende Folge des nur oberflächlichen Anschmelzens. Das Klagepatent stelle auf eine Rauigkeit ab, die gerade dadurch erzielt werde, dass die Pulverkörner nicht vollständig aufgeschmolzen würden und ihre Struktur verlören, sondern lediglich oberflächlich angeschmolzen würden, so dass sich aus ihrer noch intakten runden bzw. rundlichen Struktur die Rauigkeit der Sinteroberfläche ergebe. Das von der Beklagten angewandte Laserschmelzverfahren führe im Übrigen zu einer relativ glatten und porenfreien Oberfläche, die sich deutlich von der porösen und rauen Sinteroberfläche bei Anwendung des Ds unterscheide. Ein angeblich von dem Begriffsverständnis des Klagepatents abweichendes Fachverständnis – welches zum Prioritätszeitpunkt auch nicht bestanden habe – sei nicht relevant. Aus dem aufrechterhaltenen Patentanspruch 3 könne die Klägerin für ihre Auslegung nichts herleiten. Dieser Anspruch sei ebenso wie der Anspruch 1 dahingehend auszulegen, dass er nur ein D umfasse, bei dem die Pulverbestandteile oberflächlich angeschmolzen würden, nicht aber ein Laserschmelzverfahren mit vollständigem Durchschmelzen der Pulverbestandteile.
- Die von dem Klagepatent geforderte „unterschiedliche“ Korngröße liege nur dann vor, wenn der anspruchsgemäße Korngrößenbereich zwischen 0 und 50 µm ausgeschöpft werde und ein kontinuierlicher Korngrößenverlauf und eine möglichst weite Korngrößenverteilung gewährleistet seien. Nur so könne die patentgemäße Funktion, durch die Verringerung von Hohlräumen eine besonders dichte Schüttdichte und damit Festigkeit des herzustellenden Produkts zu gewährleisten, erfüllt werden. Es sei zum Prioritätszeitpunkt technisch ohne Weiteres möglich gewesen, eine Pulverfraktion mit unterschiedlichen Korngrößen herzustellen. Insbesondere sei es in der Pulverherstellung üblich gewesen und immer noch üblich, durch Siebvorgänge die Bandbreite an Korngrößen zu reduzieren. Die Anfrage der Klägerin bei einem Pulverhersteller, wonach dieser nur ein Angebot für ein Standardpulver habe unterbreiten wollen, sei schon wegen der Detailvorgaben in der Anfrage ohne jeden Beweiswert. Hingegen hätten alle vier von der Streithelferin der Beklagten angefragten Pulverhersteller sofort mitgeteilt, dass sie entsprechende bimodale, trimodale oder multimodale Pulvermischungen eines biokompatiblen Pulvers mit erhöhter Schüttdichte und einem Korngrößenverlauf zwischen 0 und 50 µm herstellen könnten und zum Teil schon in der Vergangenheit für Kunden hergestellt hätten. Die Angebote seien allenfalls mit moderaten Zusatzkosten verbunden gewesen, die sich bei entsprechend hohen Abnahmemengen und langfristigen Lieferbeziehungen relativieren dürften und immer noch deutlich niedriger lägen als bei den material- und kostenintensiven Verfahren aus dem Stand der Technik. Soweit die Klägerin eine unterschiedliche Korngröße auch beim Laserschmelzverfahren mit dem Argument für maßgeblich halte, Lufteinschlüsse stellten auch dort ein relevantes Problem dar, treffe dies nicht zu. Durch das Überführen der Pulverbestandteile in eine Schmelze und das damit verbundene vollständige Auflösen der Kornstruktur entstehe bei der Erstarrung ein Formkörper mit einer Dichte von nahezu 100 %, der im Gegensatz zu lasergesinterten Formkörpern keine nennenswerten, aus der vorhandenen Kornstruktur resultierenden Hohlräume mehr enthalte. Daher werde bei einem Laserschmelzverfahren auch gerade keine Kornstruktur mit weitem Korngrößenverlauf und deutlich unterschiedlichen Korngrößen verwendet, sondern ein enger Korngrößenverlauf mit möglichst gleichen Korngrößen.
- Die Richtigkeit der Annahmen in dem von der Klägerin eingereichten Privatgutachten (Anlage K 34) werde bestritten. Diese ließen insbesondere die Unterschiede der Energieeinwirkung des Laserstrahls auf kleinere und größere Pulverkörner außer Betracht. Es könne deshalb entgegen der Darstellung des Privatgutachters der Klägerin nicht davon ausgegangen werden, dass bei einem Energieeintrag, der zu einem oberflächlichen Anschmelzen der Pulverkörner mit einem Durchmesser von 50 µm mit einer Eindringtiefe von 5 µm führe, alle kleineren Pulverkörner vollständig durchschmölzen. Überdies ließen die rein theoretischen Berechnungen des Privatgutachters diverse für das An- bzw. Aufschmelzverhalten wichtige Parameter außer Acht, beispielsweise das materialspezifische Absorptions- und Reflektionsverhalten, die Oberflächeneigenschaften bzw. Rauigkeit und die Alterung des Pulvermaterials, die Art der Laserstrahlung, die notwendige Einstellung der Schutzgasatmosphäre usw. Ferner sei für die von dem Privatgutachter betrachtete Pulvercharge willkürlich eine Gaußsche Korngrößenverteilung zwischen 0 und 50 µm angenommen worden und würden die genauen Materialeigenschaften der Charge nicht näher definiert.
- Die ins Blaue hinein aufgestellten und durch nichts belegten Behauptungen der Klägerin, als Zahnersatz eigneten sich nur Formkörper mit einer Dichte von mindestens 99 % und mit einem oberflächigen Anschmelzen der Körner ließe sich maximal ein Formkörper mit einer Dichte von 70 % erzielen, der als Krone, Brücke oder Inlay nicht geeignet sei, würden mit Nichtwissen bestritten. Das Klagepatent nenne keine spezifischen erforderlichen Dichten (und auch sonst keine mechanischen Eigenschaften) für die patentgemäßen Formkörper und solche ergäben sich entgegen der Behauptung der Klägerin auch nicht aus dem allgemeinen Fachwissen. Bei zutreffender Betrachtung lasse sich überdies mit einem trimodalen Pulver Zahnersatz mit einer Dichte von 100 %, mit einem (besonders leicht und günstig herstellbaren) bimodalen Pulver Zahnersatz mit einer Dichte von ca. 94 % herstellen. Auch bestehe die Möglichkeit einer weiteren Steigerung der Dichte durch die Nachbearbeitung der gefertigten Werkstücke durch Infiltrieren, um oberflächliche Poren zu schließen. Auch lasse das Klagepatent in Absatz [0007] eine Nachbearbeitung z.B. in Form von Verblendungen ausdrücklich zu.
- Die Klägerin müsse sich zudem an ihrer Argumentation im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt festhalten lassen, wonach die DE 196 49 XXX XX (D35) ein vollständiges Aufschmelzen des metallischen Werkstoffpulvers lehre, das Klagepatent dagegen ein Sinterverfahren, bei dem die jeweiligen Pulverbestandteile mit einer zum lokalen Sintern führenden Energie lediglich oberflächig angeschmolzen würden und wonach das Klagepatent mit dieser Auslegung ausführbar, also insbesondere zur Herstellung von Kronen, Brücken und Inlays geeignet sei.
- Auch eine Verletzung mit äquivalenten Mitteln sei nicht gegeben, hilfsweise greife der bereits in erster Instanz erhobene Formstein-Einwand durch.
- Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens nebst Ergänzungsgutachten des Herrn Prof. Dr.-Ing. Peter Hoffmann und den Sachverständigen in den Sitzungen vom 08.12.2022 und 05.09.2024 mündlich angehört. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die schriftlichen Gutachten des Sachverständigen vom 06.12.2021 (Bl. 981 ff. GA, nachfolgend: GutA) und vom 23.11.2023 (Bl. 1649 ff. GA, nachfolgend: Ergänzungs-GutA) sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 08.12.2022 (Bl. 1287 ff, nachfolgend: Protokoll I) nebst Anlage (Bl. 1290 ff., nachfolgend: Anlage zu Protokoll I) sowie vom 05.09.2024 (Bl. 2007 ff. GA, nachfolgend: Protokoll II) Bezug genommen.
- Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.
- II.
- Die Berufung der Klägerin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht eine Verletzung des Klagepatents verneint und die Klage aus diesem Grund abgewiesen. Da die Beklagte mit der Herstellung von Zahnersatz in den von ihr betriebenen „H“-Anlagen von der technischen Lehre des Klagepatents in der im Einspruchs(beschwerde)verfahren aufrechterhaltenen Fassung keinen Gebrauch macht, stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Schadensersatz sowie Entschädigung aus Art. 64 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 2, 140a Abs. 1 und 3 PatG, § 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB, Art. II § 1 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG – den allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen – nicht zu.
-
1.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken oder Inlays. - Die Klagepatentschrift führt in ihrer Einleitung aus, dass Zahnersatz, wie Kronen, Brücken oder Inlays, regelmäßig aus komplexen Formkörpern besteht, die meist einerseits die räumliche Konfiguration erhalten gebliebener Zahnteile (Zahnstümpfe), verloren gegangener ganzer Zähne oder Teile des Kiefers und andererseits die räumliche Situation gegenüber benachbarten und/oder antagonistischen Zähnen individuell berücksichtigen müssen. Nach dem Stand der Technik werde derartiger Zahnersatz in aufwendigen Verfahren hergestellt. Wohl am weitesten verbreitet sei die Fertigung der benötigten Formkörper – zumeist aus Edelmetall- oder Nichtedelmetall-Legierungen sowie Rein-Metallen – in einem mehrstufigen Abform- und Gießverfahren. Bekannt geworden sei jedoch auch das datengesteuerte Fräsen solcher Formkörper aus dem vollen Material, was zwangsläufig erheblichen Abfall zur Folge habe, der aufwendig wiederaufgearbeitet werden müsse bzw. hohe Kosten verursache (Abs. [0002], die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift [B 2-Schrift]).
- Die Klagepatentschrift führt weiter aus, dass aus der FR 2 754 XXX (im Klagepatent irrtümlich als FR 22 754 XXX bezeichnet, Anlage K 6) ein Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantats bekannt sei, bei dem ein Abdruck des Knochenhohlraums eines extrahierten Zahns genommen werde, dieser Abdruck digital erfasst und hierauf folgend aus den digital erfassten Daten schichtweise ein Polymer mittels eines stereolithographischen Verfahrens ausgehärtet werde, das Zirkoniumoxidpartikel enthalte. Der ausgehärtete Kunststoffrohling werde nachfolgend in einem Wärmebehandlungsverfahren ausgebrannt, so dass ein Keramikpartikelgerüst verbleibe und dieses in einem weiteren Wärmenachbehandlungsverfahren gesintert werde, um das Zahnwurzelimplantat auszuhärten (Abs. [0002]). An diesem Stand der Technik kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass bei diesem Verfahren eine aufwendige Fertigungstechnik eingesetzt werde und zudem ein vollständiger Ausbrand des Kunststoffmaterials nicht erzielbar sei. Die mit diesem Verfahren erzielbaren Produkte wiesen eine Restporosität auf, die den Einsatz im hochbelastbaren Zahnaufbereich nicht zuließen, da die Festigkeit der porösen Keramik hierzu nicht ausreichend sei (Abs. [0002]).
- Die Klagepatentschrift geht schließlich auf die US 4,863,XXX (Anlage K 7) ein. Sie führt aus, dass aus dieser Druckschrift ein „selektives Lasersinterverfahren“ bekannt sei, bei dem ein Pulver, welches Plastik, Metall, Keramik oder Polymersubstanz umfasse, mit einem Laser ausgehärtet werde (Abs. [0003]). An diesem Verfahren kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass keine ausreichend dichten und somit hinreichend belastbaren Produkte herstellbar seien und zudem für die Erzielung der im Zahnimplantatbereich erforderlichen engen Toleranzen und Festigkeiten umfangreiche mechanische Nachbearbeitungen und thermische Nachbehandlungen erforderlich seien (Abs. [0003]).
- Vor diesem Hintergrund hat es sich das Klagepatent zur Aufgabe gemacht, einen vorteilhafteren Weg zur Herstellung von Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken oder Inlays, aufzuzeigen (Abs. [0004]).
- Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 in der hier geltend gemachten, im Einspruchs(beschwerde)verfahren aufrechterhaltenen Fassung die Anwendung eines Verfahrens mit folgenden Merkmalen vor:
- 1. Anwendung des Ds,
- 1.1 bei dem aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise Formkörper aufgebaut werden,
- 1.2 indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird.
- 2. Die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht unterliegt der Steuerung durch Daten, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren.
- 3. Das D wird mit der Maßgabe angewendet, dass das Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff besteht.
- 3.1 Der biokompatible Werkstoff weist eine unterschiedliche Korngröße zwischen 0 und 50 µm auf.
- 4. Das D wird zur Herstellung von Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken oder Inlays angewendet.
- Hinsichtlich der vorgeschlagenen Lösung heißt es in der allgemeinen Patentbeschreibung u.a. (Abs. [0004]):
- „… Sie [die Erfindung] bedient sich dazu eines anderweitig, nämlich zur Herstellung von komplexen Werkzeugen oder Bauteilen unter der Bezeichnung „D“ bekannt gewordenen Verfahrens, bei dem die Formkörper aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise aufgebaut werden, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, wobei die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren. Durch die Energiezufuhr werden die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächig angeschmolzen und gehen miteinander eine feste Bindung ein. Aufgrund der engen Fokussierung des Laserstrahls lässt sich – bei hoher Dichte – die Energiezufuhr sehr genau konfigurieren und demgemäß durch die gespeicherten räumlichen Daten des gewünschten Formkörpers entsprechend steuern.“
-
2.
Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedarf der Klärung, was das Klagepatent unter einem „D“ versteht (Merkmale 1, 3 und 4). Es stellt sich dabei insbesondere die Frage, ob der Begriff auch das vollständige Durchschmelzen aller Pulverkörner (nachfolgend auch: „Laser-Schmelzverfahren“) umfasst oder ob jedenfalls die größeren, strukturgebenden Pulverbestandteile nur oberflächlich anschmelzen dürfen (nachfolgend auch: „D im engeren Sinne“) (dazu unter a)). Darüber hinaus ist die mit dem Begriff des Ds im Zusammenhang stehende und zwischen den Parteien ebenfalls streitige Frage zu klären, welche Anforderungen an die Größenstruktur der Pulverkörner sich aus der in Merkmal 3.1 genannten „unterschiedlichen Korngröße“ zwischen 0 und 50 µm ergeben (dazu unter b)). Schließlich bedarf es einer näheren Betrachtung, ob sich aus der Vorgabe in Merkmal 4, wonach das D zur Herstellung von Zahnersatz, nämlich Kronen, Brücken oder Inlays angewendet wird, konkrete Anforderungen an die Dichte eines mit dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellenden Produkts ergeben (dazu unter c)). -
a)
Das im Anspruch mehrfach genannte „D“ beschreibt der Anspruch selbst dahingehend, dass aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise Formkörper aufgebaut werden (Merkmal 1.1), indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird (Merkmal 1.2). - Der schichtweise Aufbau eines Formkörpers aus einem Pulver kennzeichnet – im Unterschied zu dem aus dem Stand der Technik bekannten Abform- und Gießverfahren und dem Fräsen aus dem vollen Material (vgl. Abs. [0001]) – sowohl das D im engeren Sinne mit einem oberflächlichen Anschmelzen jedenfalls der größeren Pulverkörner als auch das Laser-Schmelzverfahren mit einem vollständigen Durchschmelzen aller Pulverkörner. Beiden genannten Verfahren ist zudem gemein, dass das Pulver der Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird. Einen Anknüpfungspunkt für die Abgrenzung beider Verfahren voneinander geben allerdings die Begriffe des lokalen „Sinterns“ (Merkmal 1.2) sowie – im Zusammenhang damit – des „sinterfähigen Pulvers“ (Merkmal 1.1).
-
aa)
Nachdem der Anspruch mit den Merkmalen 1.1 und 1.2 den in Merkmal 1 genannten Begriff des „Laser-Sinterns“ näher beschreibt, wird der Fachmann – ein an einer Fachhochschule oder Universität ausgebildeter Verfahrenstechniker, der mehrere Jahre berufliche Erfahrungen in der Durchführung des Ds gesammelt hat und der entweder selbst Kenntnisse über die an Zahnersatz zu stellenden Anforderungen besitzt oder sich diese extern durch die Hinzuziehung eines Zahntechnikers verschafft (vgl. auch GutA, S. 4 [Frage A.1], Anlage zum Protokoll I, S. 1 [Frage 1]) – die vorzitierte Beschreibungsstelle in Absatz [0004] heranziehen, in der das Klagepatent erläutert, was es mit „Laser-Sintern“ meint. -
(1)
Nach dieser allgemeinen Beschreibungsstelle sollen die jeweils betroffenen Pulverbestandteile „oberflächig angeschmolzen“ werden und dadurch – durch das oberflächige Anschmelzen – eine feste Bindung miteinander eingehen. Der Durchschnittsfachmann entnimmt dem, dass die Pulverkörner der jeweiligen Pulverschicht nicht vollständig aufgeschmolzen, sondern lediglich oberflächig (gleichbedeutend mit: oberflächlich) angeschmolzen werden sollen. Die Angabe „oberflächig angeschmolzen“ wird er hierbei dahin verstehen, dass die Pulverkörner mithilfe eines Laserstrahls oberflächlich angeschmolzen werden, wodurch sie miteinander eine feste Bindung eingehen, so dass nach dem Laser-Sintern in der jeweiligen Pulverschicht weiterhin Körner bzw. Pulverpartikel vorliegen. Neben der Verbindung der Pulverkörner gewährleistet das Anschmelzen der Pulverkörner auch die Herstellung einer Verbindung zur Oberfläche des Werkstücks (vgl. Anlage zum Protokoll I, S. 8 [Frage 15]). -
(2)
Nicht ausgeschlossen ist dabei, dass – je nach Art des verwendeten sinterfähigen Pulvers – die größeren Körner nur oberflächlich angeschmolzen werden, während kleinere Körner vollständig durchschmelzen. Ein Durchschmelzen kleiner Körner ist nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen grundsätzlich Folge des Sinterns (GutA, S. 12 [Frage 4. b) bb)], siehe ferner LG Mannheim, Anlage PP 6, S. 21), für die Zwecke der Erfindung aber unschädlich (Anlage zum Protokoll I, S. 8 [Frage 15]). Bei dem in Absatz [0004] genannten oberflächigen Anschmelzen kommt es demnach in erster Linie auf die größeren Körner an und darauf, dass diese nicht durchschmelzen und dadurch als Strukturgeber wirken können (vgl. GutA, S. 12 [Frage 4. d)]). Ein vollständiges Durchschmelzen sämtlicher Körner sieht der Fachmann hingegen nicht mehr als oberflächiges Anschmelzen im Sinne von Absatz [0004] und damit nicht als Laser-Sintern im Sinne des Klagepatents an. -
(3)
Soweit die Klägerin demgegenüber geltend macht, dass in Absatz [0004] der Klagepatentbeschreibung, wenn dort vom oberflächigen Anschmelzen der „jeweils betroffenen Pulverbestandteile“ die Rede ist, nicht die Pulverkörner, sondern die Schichten gemeint sind, kann dem nicht gefolgt werden. Mit „Pulverbestandteile“ können nur die Pulverkörner gemeint sein, aus denen das Pulver besteht, wobei nach dem Kontext klar ist, dass es sich bei den „jeweils betroffenen Pulverbestandteilen“ um die Pulverkörner der jeweiligen Pulverschicht handelt, die nach und nach einer zum lokalen Sintern führenden Energie des Laserstrahls ausgesetzt wird. - Die Klagepatentschrift führt in dem in Rede stehenden Absatz [0004] zunächst aus, dass bei dem Verfahren, dessen sich die Erfindung bedient, die Formkörper aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise aufgebaut werden, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, wobei die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren. Auf diese Weise entsteht jeweils eine einzelne Schicht. Wenn es in der Klagepatentbeschreibung im Anschluss hieran heißt, dass durch die Energiezufuhr „die betroffenen Pulverbestandteile“ oberflächig angeschmolzen werden und miteinander eine feste Bindung eingehen, wird das Entstehen einer einzelnen Schicht durch das oberflächige Anschmelzen der jeweils betroffenen Pulverbestandteile in Form der Pulverkörner dieser Pulverschicht beschrieben. Bei den „betroffenen Pulverbestandteilen“ handelt es sich demgemäß um die Pulverkörner derjenigen Pulverschicht, über welche nach und nach der Laserstrahl zum Zwecke des lokalen Sinterns geführt wird. Da die Pulverkörner dieser Pulverschicht der zum lokalen Sintern führenden Energie des Laserstrahls ausgesetzt sind, sind sie von der Energie des Laserstrahls „betroffen“.
- Die in Rede stehende Beschreibungsstelle befasst sich hingegen nicht mit dem Verhältnis der einzelnen Schichten zueinander. Dass es dem Klagepatent in der in Rede stehenden Beschreibungsstelle um das Anschmelzen einer oberen Schicht an eine zuvor behandelte untere Schicht geht, lässt sich dieser nicht ansatzweise entnehmen. Dagegen spricht schon, dass die Klagepatentschrift – wie ausgeführt – im vorangehenden Satz der Beschreibung die „Schicht“ bzw. „Pulverschicht“ anspricht, wohingegen in dem Folgesatz die „jeweils betroffenen Pulverbestandteile“ und nicht die „jeweils betroffenen Schichten“ angesprochen werden (vgl. auch LG Mannheim, Anlage PP 6, S. 20). Es gibt auch keine andere Beschreibungspassage in der Klagepatentschrift, aus der sich herleiten ließe, dass mit den „jeweils betroffenen Pulverbestandteilen“ etwas anderes gemeint sein könnte als die Pulverkörner der jeweiligen Pulverschicht, welche nach und nach der zum lokalen Sintern führenden Energie des Laserstrahls ausgesetzt wird. Die Klagepatentschrift benutzt den Begriff „Pulverbestandteile“ nur an einer einzigen Stelle, nämlich in ihrem Absatz [0004] in der Spalte 2 Zeilen 6/7 (vgl. auch LG Mannheim, Anlage PP 6, S. 20).
- Zutreffend ist, dass die Klagepatentschrift in Bezug auf das einzelne Pulverkorn bzw. dessen Eigenschaften von „Pulverkorn“ spricht. So heißt es in Absatz [0008], Spalte 2 Zeile 51 und in Unteranspruch 2, dass das Pulver aus einer Legierung bei im Wesentlichen gleichen Anteilen der Legierungsbestandteile in jedem „Pulverkorn“ besteht. Ferner ist in Patentanspruch 1 sowie in dem bereits angesprochenen Absatz [0005] der Patentbeschreibung von der „Korngröße“ die Rede, womit die Größe eines einzelnen Pulverkorns gemeint ist. Daraus lässt sich jedoch kein Unterschied zwischen „Pulverbestandteilen“ und „Pulverkörnern“ herleiten. Das gilt schon deshalb, weil in dem in Rede stehenden Absatz [0004] der Patentbeschreibung – im Gegensatz zu den vorerwähnten Beschreibungsstellen und Ansprüchen – nicht das einzelne Pulverkorn angesprochen wird. Es geht dort vielmehr um mehrere (mindestens zwei) Pulverkörner, die durch die Energiezufuhr eine feste Bindung miteinander eingehen sollen. Diesbezüglich spricht das Klagepatent an dieser Stelle von „Pulverbestandteilen“ (Plural). Zwar hätte insoweit auch das Wort „Pulverkörner“ als der Plural des Wortes „Pulverkorn“ benutzt werden können. Bei dem Begriff „Pulverbestandteile“ handelt es sich jedoch offensichtlich um nichts anderes als die Pulverkörner. Denn anspruchsgemäß besteht das Pulver aus einem biokompatiblen Werkstoff von unterschiedlicher Korngröße zwischen 0 und 50 µm, also aus biokompatiblen Pulverkörnern mit einer unterschiedlichen Größe zwischen 0 und 50 µm.
- Mit Recht hat das Landgericht Mannheim in der bereits genannten Entscheidung vom 14.11.2017 (Anlage PP 6, S. 20) darauf hingewiesen, dass sich auch die Verwendung des Begriffs „oberflächig“ unter Zugrundelegung des Verständnisses der Klägerin nicht sinnvoll erklären lässt, weil bei diesem dem Begriff „Pulverbestandteil“ als vermeintlich betroffener Schicht bereits die Anordnung an der „Oberfläche“ des Aufbaus immanent wäre. Darüber hinaus würde unter Zugrundelegung des Verständnisses der Klägerin das Anschmelzen gerade nicht an der „Oberfläche“ stattfinden, sondern am unteren Ende der gerade bearbeiteten Schicht, also an ihrer „Unterseite“ bzw. an ihrem „Boden“. Auch kann nicht das Anschmelzen der gerade bearbeiteten Pulverschicht an die Oberfläche der zuvor bearbeiteten Schicht gemeint sein, weil diese Schicht infolge ihrer Bedeckung mit der auf sie aufgebrachten Pulverschicht keine Oberfläche mehr hat. Einen technisch sinnvollen Gehalt hat die in Rede stehende Beschreibungspassage nur, wenn sich die Angabe „oberflächig“ darauf bezieht, dass die Pulverbestandteile (in Form der Pulverkörner) der aktuell mittels des Laserstrahls bearbeiteten Pulverschicht nur teilweise (nämlich an ihrer Oberfläche) angeschmolzen werden (so zutreffend LG Mannheim, Anlage PP 6, S. 20).
- Nach der genannten Beschreibungsstelle werden die jeweils betroffenen Pulverbestandteile im Übrigen nur (oberflächig) „angeschmolzen“. Soweit das Klagepatent auch ein vollständiges Auf- bzw. Durchschmelzen der Pulverkörner hätte gestatten wollen, hätte es in seiner Beschreibung angegeben, dass die jeweils betroffenen Pulverbestandteile „an- oder aufgeschmolzen“ werden oder eine vergleichbare Formulierung gewählt (vgl. auch LG Mannheim, Anlage PP 6, S. 20).
-
(4)
Soweit der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten die Auffassung vertritt, in Absatz [0004] könne mit dem Begriff „oberflächig“ bei einer isolierten Betrachtung sowohl die Oberfläche des Werkstücks (erste Interpretationsmöglichkeit) als auch die Oberfläche der Pulverbestandteile (zweite Interpretationsmöglichkeit) (GutA, S. 10 [Frage 4. b)]) gemeint sein, folgt der Senat aus den soeben dargestellten Erwägungen der zweiten Interpretationsmöglichkeit, zu der im weiteren Verlauf seines Gutachtens auch der Sachverständige gelangt. - Der Senat teilt allerdings nicht die Auffassung des Sachverständigen, bei einer reinen Betrachtung des Wortlauts des Anspruchs sei auch die erste Interpretationsmöglichkeit – gemeint sei die Oberfläche des Werkstücks – grundsätzlich möglich. Dagegen spricht bereits, dass in Absatz [0004] – wie bereits ausgeführt – davon die Rede ist, dass „die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächig angeschmolzen“ werden, während von dem Werkstück im Anspruch keine Rede ist. Der Sachverständige geht indes selbst davon aus, dass mit den „Pulverbestandteilen“ nur die „Pulverkörner“ gemeint sein können und nicht die bereits gesinterte Schicht angesprochen ist. Er argumentiert nachvollziehbar, dass es sich bei der genannten Schicht um einen Festkörper handelt und nicht mehr um „Pulverbestandteile“ (GutA, S. 11 [Frage 4. b) aa)]).
- Vor diesem Hintergrund scheint der Sachverständige mit seinen Ausführungen eine – patentrechtlich nicht veranlasste – isolierte Betrachtung des Begriffs „oberflächig“ bzw. „Oberfläche“ vorgenommen und dabei den Bezugspunkt („die jeweils betroffenen Pulverbestandteile“) außer Acht gelassen zu haben. Die Aussagekraft der weiteren Ausführungen des Sachverständigen vermag dieser Umstand jedoch nicht in Frage zu stellen, nachdem sich seine Herangehensweise im unmittelbaren Anschluss erklärt und er in seine weiteren Erläuterungen zutreffend den Kontext der zunächst isoliert betrachteten Begriffe einbezieht. Die Auslegung des Patentanspruchs obliegt als rechtliche Beurteilung ohnehin allein dem Senat (vgl. BGH, GRUR 2007, 410 Rn. 18 – Kettenradanordnung; GRUR 2008, 779 Rn. 30 – Mehrgangnabe; GRUR 2021, 574 Rn. 32 – Kranarm; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 76 – Rohrbearbeitungsvorrichtung).
- Im Übrigen geht auch der Sachverständige davon aus, dass Gegenstand der Erfindung ein Verfahren ist, dass durch ein oberflächliches Anschmelzen von Pulverkörnern gekennzeichnet ist (Ergänzungs-GutA, S. 19 [Frage I.16.2]), bei dem die großen Pulverkörner (Strukturgeber) anschmelzen oder benetzt werden, während die kleinen Pulverkörner (Binder) entweder oberflächlich oder vollständig aufschmelzen (Ergänzungs-GutA, S. 20 [Frage I.17.1]). Nach seiner Einschätzung werden bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Pulverkörner der jeweiligen Pulverschicht („nur“) unvollständig aufgeschmolzen (GutA, S. 10). Ein „direktes Lasersintern“, bei dem alle Pulverbestandteile vollständig aufgeschmolzen werden, fällt auch nach seiner Auffassung nicht unter den Begriff „D“ im Sinne des Klagepatents (GutA, S. 10). Zu diesem Ergebnis gelangt er nur nicht allein oder primär aufgrund der Beschreibungsstelle in Absatz [0004], sondern ausgehend von dem Merkmal 3.1 (unterschiedliche Korngrößen zwischen 0 und 50 µm) und dem Absatz [0005] der Patentbeschreibung (Gewährleistung einer besonders dichten Sinterung und geringer Bildung von Hohlräumen durch den Korngrößenverlauf; vgl. GutA, S. 10 ff.).
-
bb)
In dem dargestellten Verständnis sieht sich der Durchschnittsfachmann ferner durch die Vorteilsangaben in Absatz [0005] der Patentbeschreibung bestätigt. -
(1)
Dort heißt es u.a., dass der Korngrößenverlauf (unterschiedliche Korngröße zwischen 0 und 50 µm) eine besonders dichte Sinterung mit dem Vorteil hoher Druckbelastbarkeit des Formkörpers und geringer Bildung von Hohlräumen gewährleistet. Diese Beschreibungsstelle bezieht sich nicht nur auf das Ausgangsprodukt, sondern auch auf das Endprodukt, weil die Vorteile des Korngrößenverlaufs (besonders dichte Sinterung mit dem Vorteil hoher Druckbelastbarkeit des Formkörpers; geringe Bildung von Hohlräumen) gerade für den unter Anwendung des Ds hergestellten Formkörper beschrieben werden. Zwar gibt es in dem Formkörper keinen echten „Korngrößenverlauf“ mehr, weil die Pulverkörper in diesem nicht mehr isoliert vorliegen, sondern aufgrund des oberflächigen Anschmelzens nunmehr miteinander verbunden sind. Die Lage der Körner und der Hohlräume zwischen ihnen bleiben aber, wenn die Pulverkörner lediglich angeschmolzen und nicht vollständig aufgeschmolzen werden, prinzipiell erhalten. Zur Erzielung einer dichten Sinterung und der Ausbildung von nur geringen Hohlräumen in dem Formkörper schlägt das Klagepatent vor, ein Pulver aus einem (biokompatiblen) Werkstoff von unterschiedlicher Korngröße zwischen 0 und 50 µm zu verwenden. Die Mischung von Körnern unterschiedlicher Korngrößen in dem angegebenen Korngrößenbereich führt dazu, dass die zwischen größeren Pulverkörnern bestehenden Lücken von kleineren Pulverkörnern gefüllt werden können. Hierbei bleibt es prinzipiell auch, nachdem die jeweilige Pulverschicht der zum lokalen Sintern führenden Energie des Laserstrahls ausgesetzt war. Die hohe Druckbelastbarkeit des Formkörpers und die geringe Ausbildung von Hohlräumen führt der angesprochene Durchschnittsfachmann vor diesem Hintergrund darauf zurück, dass die Kornstruktur in dem Endprodukt infolge des lediglich oberflächigen Anschmelzens der Pulverkörner grundsätzlich erhalten bleibt. Während die Mischung unterschiedlicher Korngrößen bei dem vom Klagepatent angesprochenen oberflächigen Anschmelzen zumindest der größeren Pulverkörner somit zur Erzielung der in Absatz [0005] beschriebenen Vorteile beiträgt, ist es bei einem vollständigen Durchschmelzen sämtlicher Pulverkörner vorzugswürdig, wenn die Pulverkörner keine unterschiedliche Korngröße aufweisen, sondern – im Idealfall – gleich groß sind (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 34 [Frage 8.a)], vgl. auch GutA, S. 10 [Frage 4.a]). -
(2)
Soweit die Klägerin geltend macht, die Beschreibungsstelle in Absatz [0005] lasse sich auch auf das Laser-Schmelzverfahren lesen, weil auch bei diesem die Vermeidung von Hohlräumen bereits im Pulverbett durch die Verwendung von unterschiedlichen Korngrößen für das spätere Endprodukt von Vorteil sei, greift dies nicht durch. -
(a)
Die Klägerin hat sich in diesem Zusammenhang zunächst auf das Bild 7-2 aus dem Fachbuch „D“ von E gemäß Anlage K 13 (vgl. auch Anlage K 11, S. 881 Bild 1) berufen. Die von der Klägerin in Bezug genommene schematische Darstellung eines Schmelzverfahrens beim Laser-Sintern wird dort wie folgt erläutert (Anlage K 13, S. 248 f.; ähnlich Anlage K 11, S. 881): - „Werden die Körner nur angeschmolzen, kann keine Verdichtung stattfinden und die Dichte des Bauteils kann nicht höher werden als die Schüttdichte des Pulvers. Beim vollständigen Aufschmelzen des Pulvers tritt jedoch das Problem auf, dass die Schmelze aufgrund der Oberflächenspannung kugelförmige Strukturen bildet. Diese Strukturen sind in der Regel größer als die Pulverkörner, da im Bereich des LASER-Strahl-Brennflecks mehrere Pulverkörner aufgeschmolzen werden und sich zu einer Schmelzkugel verbinden (Bild 7-2). Die Größe der Kugelstrukturen hängt vom aufgeschmolzenen Pulvervolumen im Brennfleck des LASER-Strahls ab. Mit zunehmender LASER-Leistung und bei größerer Pulverlagendicke wird eine größere Pulvermenge aufgeschmolzen, wodurch die sich bildenden Schmelzkugeln größer werden. …
- Da die Dichte der Schmelze höher ist als die Dichte der Pulverschichten, bleibt um die Schmelzkugel herum ein Freiraum. Die Schmelzkugel kann sich aufgrund der Kugelgeometrie nur an einigen Punkten mit der festen Kontur verbinden. Dadurch entsteht eine poröse Struktur der gesinterten Proben.“
- In dieser Literaturstelle wird zunächst beschrieben, dass bei einem Laser-Sintern, bei dem die Pulverkörner nur angeschmolzen werden, die Dichte des Bauteils der Schüttdichte des Pulvers folgt. Sie folgt also dem Korngrößenverlauf, wie dies auch im Klagepatent beschrieben ist.
- Dem wird in der Anlage K 13 ein „D“ (Laser-Schmelzverfahren) gegenübergestellt, bei dem die Pulverkörner vollständig aufgeschmolzen werden. Bei diesem Verfahren bestand nach den Erläuterungen in dem von der Klägerin in Bezug genommenen Fachbuch zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents (jedenfalls bei einem Einkomponenten-Metallpulver) das Problem, dass sich kugelförmige Strukturen bilden, welche in der Regel größer sind als die Pulverkörner. Die Größe dieser Schmelzkugeln hängt nicht von dem in der Klagepatentbeschreibung angesprochenen Korngrößenverlauf des Pulvers ab, sondern von dem aufgeschmolzenen Pulvervolumen und der Laser-Leistung. Auch haben die sich zwischen den einzelnen Schmelzkugeln ausbildenden Frei- bzw. Hohlräume nichts mehr mit dem von dem Korngrößenverlauf des Pulvers abhängigen Zwischenräumen zwischen den losen Pulverkörnern zu tun. Zudem führt das in der Anlage K 13 als eine Variante des Laser-Sinterns beschriebene (Laser-Schmelz-)Verfahren, bei dem die Pulverkörner vollständig aufgeschmolzen werden, gerade zu deutlichen Frei- bzw. Hohlräumen zwischen den Schmelzkugeln, so dass die Bemerkung des Klagepatents, dass sich das erfindungsgemäße Verfahren durch die geringe Bildung von Hohlräumen auszeichnet, für dieses Laser-Schmelzverfahren gerade nicht zutrifft. Diesbezüglich mögen in der K 13 zwar bestimmte Strategien für die Prozessführung diskutiert werden, diese werden aber in der Klagepatentschrift nicht angesprochen.
-
(b)
Inwieweit auch bei dem von der Beklagten angewandten Laser-Schmelzverfahren nach dem C-Patent, bei dem die Pulverbestandteile mehrfach vollständig durchgeschmolzen werden, wodurch eine einheitliche Schmelze entsteht, in dem Formkörper Gasblasen verbleiben, kann dahinstehen. Die Erteilung des deutschen Patents 196 49 XXX ist zwar bereits am 12.02.1998 und damit vor dem Prioritätstag des Klagepatents (19.01.1999) veröffentlicht worden, so dass es sich bei diesem um Stand der Technik handelt. Die DE 196 49 XXX wird in der Klagepatentbeschreibung jedoch nicht erwähnt und es ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass es sich bei dieser zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents um einen dem Fachmann allgemein bekannten Stand der Technik gehandelt hat. Zwar ist die DE 196 49 XXX in der Fassung ihrer XX-Schrift nunmehr auf dem Deckblatt der nach Abschluss des Einspruchs(beschwerde)verfahrens veröffentlichten neuen Patentschrift (B2-Schrift) genannt. Daraus kann die Klägerin im vorliegenden Zusammenhang jedoch nichts herleiten. - Auslegungsrelevant sind in erster Linie diejenigen Schriften, die in der Patentbeschreibung gewürdigt sind. Kein zulässiges Auslegungsmaterial stellt demgegenüber ein in der Patentschrift nicht erwähnter Stand der Technik dar, mag er auch vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag des Patents der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sein (BGH, GRUR 1991, 811, 813 f. – Falzmaschine). Ihn heranzuziehen ist nur dann zulässig, wenn der Nachweis geführt werden kann, dass dieser Stand der Technik zum allgemeinen Fachwissen auf dem betreffenden Gebiet gezählt hat (BGH, GRUR 1978, 235, 236/237 – Stromwandler; Senat, Urt. v. 10.12.2009 – I-2 U 51/08, BeckRS 2010, 12415; Urt. v. 17.12.2009 – I-2 U 118/08, BeckRS 2010, 15660; Urt. v. 26.11.2020 – I-2 U 65/19, GRUR-RS 2020, 37856 Rn. 56 – Trägerplatte; OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.09.2021 – I-15 U 29/20, GRUR-RS 2021, 38072 Rn. 59 – Intrakardiale Pumpvorrichtung; Urt. v. 18.01.2024 – I-15 U 101/19, GRUR-RS 2024, 7832 Rn. 91 – Kraftfahrzeugschloss). Ob bei der Anspruchsauslegung auch Stand der Technik berücksichtigt werden kann, der in der Patentbeschreibung nicht behandelt, der aber auf dem Deckblatt genannt wird, ist streitig. Nach einer in der Literatur vertretenen Auffassung bilden lediglich auf dem Deckblatt der Patentschrift genannte Dokumente kein zulässiges Auslegungsmaterial (Timmann in: Haedicke/Timmann PatR-HdB, 2. Aufl., § 3 Rn. 117 ff; Ann, PatR, 8. Aufl., § 32 Rn. 67; Tilmann, GRUR 2004, 1008, 101; GRUR 2005, 904, 906). Nach einer weiteren, ebenfalls in der Literatur vertretenen Auffassung sind Druckschriften, die in der Patentschrift nur auf dem Deckblatt genannt sind, nur ausnahmsweise für die Auslegung heranzuziehen. Solcher Stand der Technik soll hiernach nur zu berücksichtigen sein, wenn die betreffende Druckschrift zum allgemeinen Fachwissen gehört oder wenn sich im Einzelfall feststellen lässt, dass sich ein Fachmann zur Erfassung der Lehre des Patentanspruchs durch Lektüre der Vorveröffentlichung entsprechend kundig gemacht hätte (Benkard PatG/Scharen, 12. Aufl., § 14 Rn. 61). Nach einer anderen Auffassung sind hingegen prinzipiell alle diejenigen Dokumente aus dem Stand der Technik verständnis- und auslegungsrelevant, die im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden sind. Dazu gehören hiernach vordringlich diejenigen Schriften, die im Beschreibungstext sachlich gewürdigt sind, aber auch solche Dokumente, die sich nur auf dem Deckblatt finden (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. A Rn. 81; Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 14 PatG, Rn. 52). Der Senat hat ebenfalls bereits angenommen, dass zwar in erster Linie diejenigen Schriften relevant sind, die in der Patentbeschreibung gewürdigt sind, daneben aber auch solcher Stand der Technik heranzuziehen sein kann, der lediglich auf dem Deckblatt der Patentschrift als im Prüfungsverfahren berücksichtigte Entgegenhaltung verzeichnet ist (vgl. Senat, Urt. v. 10.12.2009 – I-2 U 51/08, BeckRS 2010, 12415; Urt. v. 17.12.2009 – I-2 U 118/08, BeckRS 2010, 15660; Urt. v. 01.02.2018 – I-2 U 33/15, GRUR-RS 2018, 11286 Rn. 85 – Polysiliziumschicht; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 52 – Kinderreisesitz; vgl. auch OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.01.2024 – I-15 U 101/19, GRUR-RS 2024, 7832 Rn. 91 – Kraftfahrzeugschloss). An dieser Rechtsprechung hält der Senat fest, wobei freilich zu berücksichtigen ist, dass die aus einer nur auf dem Deckblatt angeführten Druckschrift zu ziehenden Auslegungsschlüsse im Einzelfall äußerst gering sein können.
- So verhält es sich auch hier. Der Nennung der DE 196 49 XXX auf dem Deckblatt der geänderten Klagepatentschrift (B2-Schrift) entnimmt der Fachmann, dass diese Druckschrift hinsichtlich des geänderten Patentanspruchs 1 des Klagepatents als nicht patenthindernd eingestuft worden ist, wobei sich aus einem Vergleich der B1-Schrift und der B2-Schrift ergibt, dass diese Entgegenhaltung erst im Einspruchsverfahren berücksichtigt worden ist. Der Fachmann wird den im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 deshalb nicht so interpretieren, dass sein Inhalt durch die DE 196 49 XXX neuheitsschädlich offenbart wäre. Er wird allein aufgrund der Nennung der DE 196 49 XXX auf dem Deckblatt der geänderten Klagepatentschrift aber auch nicht annehmen, dass diese Druckschrift bereits ein D im Sinne des Klagepatents offenbart. Zieht der Fachmann die DE 196 49 XXX heran, so entnimmt er dieser nur, dass diese ein Verfahren zu Herstellung eines Formkörpers, insbesondere eines Produkts oder Bauteils, beschreibt, bei dem ein Laserstrahl auf Schmelztemperatur erhitzt wird und ein metallisches Werkstoffpulver an der Auftreffstelle des Laserstrahls über seine gesamte Schichtdicke vollständig aufgeschmolzen wird. Die DE 196 49 XXX geht in ihrer Einleitung zwar auf Sinterverfahren ein (DE 196 49 XXX XX, Sp. 1 Z. 63 ff.) und erläutert in diesem Zusammenhang in Bezug auf ein bekanntes Sinterverfahren, bei dem Metallstrukturen durch schichtweises lokales Sintern bzw. Verschmelzen von vordeponierten Metallpulverschichten mit fokussierter Laserstrahlung aufgebaut werden (DE 196 49 XXX XX, Sp. 2 Z.10-22), dass insoweit derzeit zwei Verfahrensweisen verfolgt werden, nämlich zum einen das direkte Sintern und zum anderen das indirekte Sintern (DE 196 49 XXX XX, Sp. 2 Z. 33 ff.). Die DE 196 49 XXX bezeichnet das von ihr selbst vorgeschlagene Verfahren, bei dem die Pulverbestandteile vollständig aufgeschmolzen werden, aber selbst weder als „Sinterverfahren“ noch als „D“. Die Klagepatentschrift würdigt die DE 196 49 XXX in ihrer Beschreibung nicht, sondern führt diese lediglich auf ihrem Deckblatt an. Sie gibt demgemäß nicht an, dass die DE 196 49 XXX bereits ein „D“ offenbart.
-
(c)
Schließlich führt es nicht zu einer anderen Sichtweise, wenn die Klägerin geltend macht, dass auch bei einem vollständigen Durchschmelzen der Körner das Vorhandensein von Körnern in unterschiedlicher Korngröße vorteilhaft sei, da hierdurch vermieden werde, dass eine Pulverschicht beim Aufschmelzen der Körner in größerem Ausmaß in Folge der Beseitigung von Hohlräumen in sich zusammensacke und dann schrumpfe, wodurch sich Schichtunebenheiten bildeten, welche sowohl die Abmessung und Passgenauigkeit des Formkörpers als auch dessen dichte Sinterung behinderten. - Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen sich der Senat anschließt, ist die Abnahme der Schichthöhe bei einem vollständigen Durchschmelzen der Körner kein Nachteil, weil diese bekannt und reproduzierbar ist und aus diesen Gründen beim schichtweisen Aufbau des Kornkörpers berücksichtigt werden kann (Protokoll II, S. 7). Es verbleibt deshalb auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Klägerin dabei, dass es der Fachmann bei einem vollständigen Durchschmelzen aller Pulverkörner als ungünstig ansieht, wenn sich die Partikelgrößen – und damit die für ein Durchschmelzen erforderliche Energie des Laserstrahls –zu stark voneinander unterscheiden (vgl. Protokoll II, S. 7). Darüber hinaus handelt es sich bei dem von der Klägerin geschilderten Szenario nicht um einen vom Klagepatent adressierten Nachteil, der mit der Vorgabe einer unterschiedlichen Korngröße überwunden werden soll. Das Klagepatent befasst sich nicht mit der vollständigen Beseitigung von Hohlräumen, wie es bei Anwendung des Laser-Schmelzverfahrens mit einem monomodalen Pulver erfolgt (vgl. dazu Protokoll II, S. 7). Im Gegenteil geht das Klagepatent davon aus, dass Hohlräume im Endprodukt verbleiben können, wenn es in Absatz [0005] von dem Vorteil „geringer Bildung von Hohlräumen“ spricht.
-
cc)
Auch durch die Vorteilsangaben in Absatz [0007] der Patentbeschreibung sieht sich der Fachmann in seinem Verständnis bestärkt, wonach das D im Sinne des Klagepatents ein nur oberflächliches Anschmelzen zumindest der größeren Pulverkörner beschreibt. -
(1)
In Absatz [0007] heißt es, dass sich die Sinteroberfläche besonders gut für das häufig gewünschte Verblenden mittels keramischer oder anderer Werkstoffe, wie dies beispielsweise bei Kronen oder Brücken der Fall ist, eignet. Die Sinteroberfläche des erfindungsgemäß hergestellten Formkörpers zeichnet sich danach durch eine gewisse Rauigkeit aus. Diese Rauheit der Sinteroberfläche führt der Durchschnittsfachmann im Hinblick auf die Angaben in den vorherigen Absätzen der Klagepatentbeschreibung eben darauf zurück, dass in dem Endprodukt infolge des lediglich oberflächlichen Anschmelzens der Pulverkörner weiterhin eine Kornstruktur vorhanden ist, die zu der angesprochenen Rauigkeit der Sinteroberfläche führt. Die Struktur der gesinterten Pulverschicht wird damit weiterhin durch die verbliebene Kornstruktur bestimmt. -
(2)
Dieser Sichtweise steht nicht entgegen, dass nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen auch bei einem vollständigen Aufschmelzen der Pulverkörner eine gewisse Rauigkeit erreicht wird, wobei die Oberflächenstruktur einer durch das Laser-Schmelzverfahren hergestellten Schicht im Wesentlichen durch die einzelnen nebeneinander liegenden Spuren und die eingeschmolzenen Spritzer-Partikel gebildet wird (GutA, S. 13 [Frage 4. e)]). Das Klagepatent spricht in Absatz [0007] gerade in Bezug auf die „Sinteroberfläche“ von deren gewisser Rauigkeit und stellt damit den Bezug zwischen dem D und der sich daraus ergebenden Rauheit her. Eine durch Spuren und Spritzer-Partikel gebildete Rauheit, mag diese auch ähnlich vorteilhaft sein, spricht das Klagepatent an dieser Stelle nicht an. -
dd)
Die Würdigung der FR 2 754 XXX (Anlage K 6) in Absatz [0002] der Klagepatentschrift bestätigt ebenfalls die vorstehend dargetane Auslegung. - Das Klagepatent verwendet den Begriff des „Sinterns“ in Bezug auf diese Entgegenhaltung im Sinne eines herkömmlichen Sinterns, bei dem die Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur bleibt (siehe zu dem Begriff des Sinterns noch unten unter ii) (1)). Das Klagepatent beschreibt das daraus bekannte Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantats wie folgt:
- „Aus FR 22 754 XXX ist ein Verfahren zum Herstellen eines Zahnimplantats bekannt, bei dem ein Abdruck eines Knochenhohlraums eines extrahierten Zahnes genommen wird und hierauf folgend aus den digital erfassten Daten schichtweise ein Polymer mittels eines stereolithographischen Verfahrens ausgehärtet wird, das Zirkonoxidpartikel enthält. Der ausgehärtete Kunststoffrohling wird nachfolgend in einem Wärmebehandlungsverfahren ausgebrannt, so dass ein Keramikpartikelgerüst verbleibt und dieses in einem weiteren Wärmenachbehandlungsverfahren gesintert, um das Zahnwurzelimplantat auszuhärten. …“
- Der Begriff „Sintern“ wird an dieser Stelle somit für die Aushärtung des bereits in den vorangegangenen Schritten ausgehärteten und ausgebrannten Rohlings benutzt. Für den angesprochenen Fachmann ist klar, dass ein vollständiges Durchschmelzen aller Partikel des Rohlings nicht stattfindet (vgl. Protokoll II, S. 3).
-
ee)
Die Würdigung der US 4,863,XXX (Anlage K 7) in Absatz [0003] steht der vorgenommenen Auslegung jedenfalls nicht entgegen. - Das dort als „selektives Lasersinterverfahren“ geschilderte Verfahren wird in Absatz [0003] der Klagepatentschrift wie folgt geschildert:
- „Aus US 4,863,XXX ist ein selektives Lasersinterverfahren bekannt, bei dem ein Pulver, welches Plastik, Metall, Keramik oder Polymersubstanz umfasst, mit einem Laser ausgehärtet wird. …“
- Dieser Würdigung ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass das in dieser Schrift offenbarte selektive D nicht nur ein Sintern im eigentlichen (engeren) Sinne, sondern auch ein Auf- bzw. Durchschmelzen umfasst. Ein solches Verständnis hat auch der gerichtliche Sachverständige Absatz [0003] der Klagepatentschrift nicht entnommen (vgl. dazu Protokoll II, S. 3, S. 8).
-
ff)
Soweit es in Absatz [0004], Spalte 1 Zeile 54 bis Spalte 2 Zeile 6 heißt, dass sich die Erfindung eines unter der Bezeichnung „D“ bekannt gewordenen Verfahrens bedient, lässt sich hieraus nichts anderes herleiten. Bei dem Begriff „D“ (übersetzt: schneller Modellbau) handelt es sich um einen Über- bzw. Oberbegriff, unter dem verschiedene Verfahren zur schnellen Herstellung von Musterbauteilen ausgehend von den Konstruktionsdaten zusammengefasst sind. Die meisten Verfahren des D sind der additiven Fertigung bzw. dem 3D-Druck zuzurechnen, weil sie mit schichtweisem Materialauftrag und ohne Verwendung einer Form arbeiten. D bezeichnet die Art der Anwendung näher: Während Rapid Tooling die Herstellung von Werkzeugen und Rapid Manufacturing die Herstellung von Bauteilen und Fertigprodukten beschreibt, bezeichnet D die Erstellung von Prototypen und Modellen (vgl. Wikipedia Stichwort: „D“). Es gibt damit weder „das“ D-Verfahren noch sagt der Begriff etwas über das konkrete Herstellungsverfahren aus. Im vorliegenden Zusammenhang geht es, wie der Fachmann den Erläuterungen in Absatz [0004], Spalte 1 Zeile 53 bis Spalte 2 Zeile 5, entnimmt, um ein D-Verfahren, bei dem die Formkörper aus einem sinterfähigen Pulver schichtweise aufgebaut werden, indem sukzessive jede Schicht des Pulvers einer zum lokalen Sintern führenden Energie eines Laserstrahls ausgesetzt wird, wobei die Führung des Laserstrahls über die jeweilige Pulverschicht der Steuerung durch Daten unterliegt, welche die Konfiguration des Formkörpers in dieser Schicht repräsentieren (Abs. [0004], Sp. 1 Z. 54 bis Sp. 2 Z. 6). Diesbezüglich mag dem Fachmann ggf. bereits zum Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sein, dass bei einem solchen Verfahren die Pulverkörner mithilfe des Laserstrahls entweder örtlich leicht angeschmolzen oder aufgeschmolzen werden (vgl. Anlage K 14, S. 122). Wie sich aus Absatz [0004], Spalte 2 Zeilen 8 bis 9 der Klagepatentbeschreibung ergibt, hat das Klagepatent allerdings ein ganz bestimmtes D-Verfahren im Blick, nämlich ein solches, bei dem die Pulverkörner dadurch miteinander verbunden werden, dass sie mithilfe eines Laserstrahls oberflächlich angeschmolzen werden. Ausgangspunkt der Erfindung nach dem Klagepatent ist daher allein ein solches D-Verfahren. -
gg)
Unteranspruch 2 und die in Absatz [0008] geschilderte bevorzugte Ausführungsform, die ein aus einer Legierung bestehendes Pulver bei im Wesentlichen gleichen Anteilen der Legierungsbestandteile in jedem Pulverkorn beschreiben, stehen dem dargestellten Verständnis ebenfalls nicht entgegen. - Bei einer Legierung handelt es sich um ein festes Gemisch, welches aus zwei oder mehr chemischen Elementen besteht, wovon eines ein Metall ist (Ergänzungs-GutA, S. 19 [Frage I.16.1 a)], Protokoll II, S. 4). Der Wortlaut von Unteranspruch 2, wonach das Pulver „aus einer Legierung …besteht“ sowie die weitere Vorgabe, wonach das Pulver die im Wesentlichen gleichen Anteile der Legierungsbestandteile in jedem Pulverkorn aufweist, schließen aus, dass das Pulver neben der Legierung weitere Komponenten enthält. Es handelt sich damit zwingend um ein sog. Einkomponentenpulver (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 39 [Frage 12], Protokoll II, S. 4 f.). Wenn die Verwendung eines solchen Einkomponentenpulvers in der Klagepatentbeschreibung als besonders vorteilhaft beschrieben wird und zudem Gegenstand eines Unteranspruchs ist, wird sich der Fachmann die Frage stellen, ob dies dem dargestellten Verständnis, wonach mit Laser-Sintern das nur oberflächliche Anschmelzen der Pulverkörner angesprochen ist, entgegensteht. Denn anders als bei einem sog. Mehrkomponentenpulver kann bei einem Einkomponentenpulver nicht durch die Wahl von Komponenten mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen, insbesondere einer niedrig- und einer hochschmelzenden Komponente, Einfluss darauf genommen werden, dass nicht alle Körner gleichmäßig aufschmelzen.
- Es erschließt sich allerdings aus der Betrachtung der weiteren Ausführungen in Absatz [0008], dass nicht die Verwendung eines Einkomponentenpulvers an sich – der Begriff findet weder in dem genannten Absatz noch überhaupt im Klagepatent Erwähnung – hervorgehoben wird und dass es dem Klagepatent an dieser Stelle auch nicht auf die spezifische Eignung eines solchen Pulvers für den Prozess des Laser-Sinterns ankommt. Vielmehr setzt das Klagepatent voraus, dass ein aus einer Legierung bei im Wesentlichen gleichen Anteilen der Legierungsbestandteile in jedem Pulverkorn bestehendes Pulver für die Zwecke des Klagepatents – die Herstellung von Zahnersatz – besonders geeignet ist. Dies entnimmt der Fachmann etwa der Beschreibungsstelle in Absatz [0008], Spalte 2 Zeile 56 f., an der das Klagepatent von „bestimmten Legierungen, die für dentale Zwecke besonders vorteilhaft einsetzbar sind“ spricht. Wird eine solche für die Herstellung von Zahnersatz besonders geeignete Legierung verwendet, bestehen bei der Herstellung von Zahnersatz aus dieser Legierung durch Anwendung des Ds in Abgrenzung zu der im Stand der Technik bekannten Fertigung aus geschmolzenen Legierungen diejenigen Vorteile, die das Klagepatent in Absatz [0008] wie folgt schildert:
- „… Dies stellt einen großen Vorteil gegenüber der herkömmlichen Fertigung von dentalen Formkörpern aus geschmolzenen Legierungen dar, weil keine Gefahr der Entmischung der Legierungsbestandteile in der Schmelze und/oder dem gegossenen Formkörper besteht. Überdies erfordert die Herstellung von Halbzeugen aus bestimmten Legierungen, die für dentale Zwecke besonders vorteilhaft einsetzbar sind, komplizierte und aufwendige Verfahrensmaßnahmen, wie etwa den Saugguß, während das Pulverisieren solcher Legierungen wesentlich unaufwendiger ist. Während aber eine aus solchem Pulver hergestellte Schmelze (zur anschließenden Herstellung von Guß-Formkörpern) wiederum der Gefahr der Entmischung und somit Inhomogenität unterliegt, behält ein erfindungsgemäß gesinterter Formkörper seine gleichmäßige Verteilung der Legierungsbestandteile bei.“
- Das Klagepatent hebt hier also die Vorteile gegenüber im Stand der Technik bekannten konventionellen Gießverfahren hervor, bei welchen Entmischungserscheinungen in der Schmelze auftreten können. Vorteile der Verwendung von Einkomponentenpulvern gegenüber Mehrkomponentenpulvern werden demgegenüber nicht erörtert (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 19 [Frage I.16.1 c)]).
-
hh)
Aus entsprechenden Erwägungen steht auch die Würdigung eines Metallpulvers mit der spezifischen, in Absatz [0009] genannten Zusammensetzung, welches sich nach der Darstellung in der Klagepatentschrift für den Einsatz beim erfindungsgemäßen Verfahren bewährt hat, dem dargestellten Verständnis nicht entgegen. Bei dem Pulver der dort genannten Zusammensetzung handelt es sich nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen um ein Einkomponentenpulver, nämlich um eine unter dem Namen „Inconel 625“ bekannte Legierung (vgl. Protokoll II, S. 5). Auch in Bezug auf diese Legierung gilt, dass das Klagepatent diese als für den erfindungsgemäßen Zweck – die Herstellung von Kronen, Brücken oder Inlays – besonders geeignet ansieht. Wie soeben in Bezug auf Abs. [0008] und Unteranspruch 2 dargetan, lässt sich auch der Darstellung in Absatz [0009] hingegen nicht entnehmen, dass es gerade die Eigenschaften dieses Pulvers bei einem vollständigen Durchschmelzen bzw. oberflächlichen Anschmelzen der Pulverkörner sind, welche das Klagepatent als vorteilhaft hervorhebt. - Etwas anderes folgt auch nicht aus der Aussage des Sachverständigen, das in Absatz [0009] angesprochene Pulver werde sinnvollerweise im Laser-Schmelzverfahren verarbeitet (Protokoll II, S. 5). Zum einen bezieht sich diese Aussage ausdrücklich auf die heutige Sicht – und nicht auf den für das Verständnis des Klagepatents maßgeblichen Prioritätszeitpunkt (Protokoll II, S. 5). Zum anderen wäre in diesem Fall, so der Sachverständige, ein Pulver mit einer sehr engen Korngrößenverteilung gewählt worden, also ein monomodales Pulver innerhalb der technisch herstellbaren Grenzen (Protokoll II, S. 5). Hierin liegt aber gerade der Unterschied zur Lehre des Klagepatents, wonach ein Pulver mit unterschiedlicher Korngröße gewählt wird, um (u.a.) sicherzustellen, dass auch bei Einkomponentenpulvern, bei denen keine unterschiedlichen Schmelztemperaturen bestehen, ein nur oberflächliches Anschmelzen zumindest der größeren Körner erzielbar ist.
-
ii)
Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auf ein von der dargestellten Auslegung abweichendes Verständnis des Fachmanns am Prioritätstag. -
(1)
Soweit es den in Merkmal 1.2 zur näheren Beschreibung des Ds genannten und in Merkmal 1.1 mit dem Verweis auf ein „sinterfähiges“ Pulver aufgegriffenen Begriff des „Sinterns“ angeht (vgl. ferner Abs. [0008], der von einem erfindungsgemäß „gesinterten“ Formkörper spricht), folgt das Klagepatent mit der dargestellten Beschreibung des Laser-Sinterns in Absatz [0004], nach welcher durch die Energiezufuhr die jeweils betroffenen Pulverbestandteile oberflächig angeschmolzen werden, dem allgemein-technischen Sprachgebrauch dieses Begriffs. -
Bei dem Sintern handelt es sich um ein Fertigungsverfahren aus der Hauptgruppe „Stoffeigenschaften ändern“ der DIN 8XXX (GutA, S. 4 [Frage A.2]). Es ist nach dem allgemein-technischen Verständnis, wie es der gerichtliche Sachverständige in seinem Gutachten ausgeführt hat, dadurch gekennzeichnet, dass feinkörnige keramische
oder metallische Stoffe – oft unter erhöhtem Druck – erhitzt werden, wobei die Temperaturen unterhalb der Schmelztemperatur der Hauptkomponente bleiben, so dass die Gestalt des Werkstücks erhalten bleibt (GutA, S. 4 [Frage A.2]). Bei dem sog. Flüssigphasensintern wird – im Gegensatz zum Festphasensintern – das Material soweit erhitzt bis die Temperatur die Solidustemperatur einer der Komponenten des Materialsystems übersteigt (GutA, S. 4 [Frage A.2]). - Bestätigt wird dies durch den von der Klägerin in Bezug genommenen Wikipedia-Eintrag zum Begriff „Sintern“. Dort heißt es einleitend u.a.:
- „Sintern ist ein Verfahren zur Herstellung oder Veränderung von Werkstoffen. Dabei werden feinkörnige keramische oder metallische Stoffe – oft unter erhöhtem Druck – erhitzt, wobei die Temperaturen jedoch unterhalb der Schmelztemperatur der Hauptkomponenten bleiben, so dass die Gestalt (Form) des Werkstückes erhalten bleibt.“
- Ferner wird dort zum „Grundprinzip“ ausgeführt:
- „Beim Sintern werden zumeist körnige oder pulvrige Stoffe vermischt und dann durch Erwärmung miteinander verbunden oder verdichtet. Im Gegensatz zur reinen Schmelze werden hierbei jedoch keine oder zumindest nicht alle Ausgangsstoffe aufgeschmolzen. Die Ausgangsstoffe werden also, umgangssprachlich formuliert, „zusammengebacken“. …“
- Zwar kann ein aktueller Eintrag zum Begriff „Sintern“ aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia selbstverständlich nicht das diesen Begriff betreffende Verständnis des Durchschnittsfachmanns zum Prioritätszeitpunkt belegen. Dass der Begriff „Sintern“ in Alleinstellung allgemein die vorstehende Bedeutung hat und auch bereits in der Vergangenheit gehabt hat, stellt die Klägerin jedoch nicht in Abrede. Sie trägt vielmehr selbst vor, dass der Begriff „Sintern“ allein (ohne die neue Technologie des Laser-Sinterns) in der Vergangenheit anders verstanden worden ist, nämlich so, dass die Pulverkörner nur oberflächlich angeschmolzen werden sollen (Berufungsbegründung vom 24.01.2020, S. 18, Bl. 362 GA).
- Das Landgericht ist vor diesem Hintergrund mit Recht davon ausgegangen, dass das Klagepatent bei der Verwendung des Begriffs „Sintern“ dem allgemein-technischen Sprachgebrauch dieses Begriffs folgt, wonach Sintern im Ausgangspunkt etwas anderes ist als „Durchschmelzen“, und dass die Beschreibung des Sinterns in Absatz [0004] der Klagepatentschrift als oberflächiges Anschmelzen der jeweils betroffenen Pulverbestandteile das charakteristische Unterscheidungsmerkmal zu reinen Schmelzprozessen ist, weil beim „Sintern“, anders als bei einer reinen Schmelze, keine oder zumindest nicht alle Ausgangsstoffe aufgeschmolzen werden.
-
(2)
Im Unterschied zum Begriff „Sintern“ wurde zwar der Begriff „Laser-Sintern“ am Prioritätstag auch in einem weiteren Sinne, welcher das vollständige Durchschmelzen der Pulverkörner umfasst, verwendet. Dieser Umstand vermag jedoch das oben dargestellte Verständnis nicht in Frage zu stellen. -
(a)
Die von der Klägerin vorgelegten Unterlagen sprechen dafür, dass mit dem Begriff „Laser-Sintern“ am Prioritätstag auch ein Verfahren adressiert worden ist, bei dem die Pulverkörner vollständig durchschmelzen. - So heißt es in dem als Anlage K 11 vorgelegten Auszug aus dem Tagungsband „Eclat ´96“ aus dem Jahr 1996 in dem Kapitel „Mit Selektivem Laser Sintern zu metallischen Prototypen aus seriennahen Werkstoffen“ von F et. al. unter der Überschrift „Stand der Technik zum SLS metallischer Werkstoffe“, dass beim Selektiven Laser Sintern metallischer Pulver die Pulverkörner „ganz oder teilweise aufgeschmolzen“ werden, wobei in diesem Zusammenhang in der Fußnote 1 allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass, obwohl die Pulverkörner teilweise oder ganz aufschmelzen, weiterhin das Wort „Sintern“ verwendet wird (Anlage K 11, S. 880 unter 2.). Ferner wird in dieser Unterlage ausgeführt, dass es, um bei der Verwendung von Einkomponentenpulver Bauteile mit einer möglichst hohen Dichte herzustellen, notwendig ist, die Pulverkörner „vollständig aufzuschmelzen“ (Anlage K 11, S. 881 unter 3.).
- In dem bereits erwähnten, als Anlage K 13 vorgelegten Auszug aus dem Fachbuch „D“ von E aus dem Jahr 1996 wird unter der Überschrift „Direktversintern metallischer Werkstoffe“ u.a. ausgeführt, dass dann, wenn nur eine Komponente eingesetzt wird, das Pulver bei der Bearbeitung in der Regel „vollständig aufschmilzt“ (Anlage K 13, S. 246 unter 7.1). Des Weiteren wird dort erläutert, dass es, um bei der Verwendung von Einkomponentenpulver Bauteile mit einer möglichst hohen Dichte herzustellen, notwendig ist, die Pulverkörner „vollständig aufzuschmelzen“ (Anlage K 13, S. 248 unter 7.1.2). In diesem Zusammenhang wird in der Anlage K 13 ein Bild wiedergegeben, das in einer schematischen Darstellung das Schmelzverhalten eines Einkomponenten-Metallpulvers beim Laser-Sintern zeigt (Anlage K 13, S. 249 Bild 7-2).
- Eine entsprechende figürliche Darstellung findet sich auch in dem in dem Tagungsband des Laser Institute of America, Volume 85e, Laser Materials Processing D and Microfabrication, veröffentlichten Beitrag von F et al. mit dem Titel „Direct Generation of Metal Parts and Tools by Selective Laser Powder Remelting (SLPR)“ aus dem Jahr 1998 (Anlage K 12, S. 33 Fig. 3).
- Ferner heißt es in der nur kurze Zeit nach dem Prioritätstag des Klagepatents erschienenen 2. Auflage des Fachbuchs „D“ von E aus dem Jahr 2000 zum Laser-Sintern, dass bei diesem zu einem Pulverbett dicht nebeneinander gepackte und je nach Prozessen leicht verdichtete Körnchen von typischerweise 50 bis 100 µm Durchmesser mithilfe eines Laser-Strahls „örtlich leicht an- oder aufgeschmolzen“ werden (Anlage K 14, S. 122).
- Schließlich trägt das bereits erwähnte europäische Patent 0 946 XXX des C-Instituts, welches auf einer Anmeldung vom 27.10.1997 beruht, die Bezeichnung „XXX“.
-
(b)
Auch nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen wurde der Begriff des „Laser-Sinterns“ am Prioritätstag nicht einheitlich verwendet und konnte damit grundsätzlich sowohl das bloße Anschmelzen als auch das vollständige Durchschmelzen der Pulverkörner gemeint sein (vgl. GutA S. 5 f. [Frage A.2], Anlage zum Protokoll I, S. 3 [Frage 6]). In seinem Gutachten erwähnt der Sachverständige die zum Prioritätszeitpunkt bekannte Verfahrensweise des indirekten Laserstrahlsinterns (SLS-Verfahren), bei dem für die Herstellung eines Grünlings der thermoplastische Binder eines mit Thermoplasten ummantelten Stahlpulvers verwendet wird, wobei sich weitere Fertigungsschritte anschließen (GutA, S. 5 [Frage A.2]). Darüber hinaus spricht der Sachverständige die Verfahrensweise des direkten Laser-Sinterns (auch als Direct Metal Laser Sintering, kurz: DMLS bezeichnet) an, bei der reines Metallpulver verwendet wird (GutA, S. 5 [Frage A.2]). - Industrieller Stand der Technik am Prioritätstag war hierbei nach den Ausführungen des Sachverständigen die Verarbeitung von Mehrkomponentenpulvern mit einer niedrig- und einer hochschmelzenden Komponente, bei der die niedrigschmelzende Komponente (Binder) durch den Laserstrahl aufgeschmolzen wird und die hochschmelzende Komponente (Strukturgeber) umfließt (GutA, S. 5 [Frage A.2]). Für diese Verfahrensweise hatte sich aufgrund der prozesstechnischen Nähe zum Flüssigphasensintern die Bezeichnung „Laser-Sintern“ durchgesetzt (GutA, S. 5 [Frage A.2]).
- Die Verarbeitung von Einkomponentenpulvern war hingegen Gegenstand von Forschungen, die vorsahen, das Metallpulver vollständig aufzuschmelzen (GutA, S. 5 f. [Frage A.2]). Noch vor dem Prioritätszeitpunkt, im Jahr 1998, war für diese Verfahrensvariante die Bezeichnung „Selective Laser Powder Remelting“ (kurz: SLPR) in Abgrenzung zum SLS-Verfahren verwendet worden (GutA, S. 6 [Frage A.2] unter Verweis auf einen Beitrag von F et al. mit dem Titel „Direct Generation of Metal Parts and Tools by Selective Laser Powder Remelting (SLPR)“ aus dem Jahr 1998). Allerdings wurden, wie der Sachverständige in seinem Gutachten ausführt, die Begriffe nicht einheitlich verwendet und auch für die Verarbeitung von Einkomponentenpulvern mit vollständigem Aufschmelzen der Pulverkörner der Begriff Laser-Sintern verwendet. So verwendete der Autor des genannten Artikels, Dr. F, für seine im Dezember 1999 zu dieser Verfahrensentwicklung publizierte Dissertation den Titel „Direktes selektives Laser-Sintern einkomponentiger metallischer Werkstoffe“ (GutA, S. 6 [Frage A.2]).
-
(c)
Dass der Begriff des Laser-Sinterns am Prioritätstag auch für das vollständige Durchschmelzen der Pulverkörner mittels Laserstrahls verwendet wurde, führt indes nicht zu einem anderen Verständnis. - Zunächst sind die meisten der von der Klägerin und dem Sachverständigen erwähnten Dokumente nicht auslegungsrelevant, weil sie weder in der Patentbeschreibung des Klagepatents noch auf dessen Deckblatt erwähnt sind. Die Literaturstelle gemäß Anlage K 14 ist – wie bereits erwähnt – überdies nachveröffentlicht. Ebenso ist die von dem gerichtlichen Sachverständigen erwähnte Dissertation von F erst nach dem Prioritätstag des Klagepatents veröffentlicht worden. Die DE 196 49 XXX ist zwar auf dem Deckblatt der nach Abschluss des Einspruchsverfahrens veröffentlichten neuen Patentschrift (B2-Schrift) verzeichnet. Für die Auslegung bzw. das Verständnis des Begriffs „D“ lässt sich hieraus aus den bereits angeführten Gründen jedoch nichts herleiten.
-
jj)
Soweit die Klägerin argumentiert, das D sei bei dem dargestellten Verständnis eines nur oberflächlichen Anschmelzens der Pulverkörner für den Durchschnittsfachmann am Prioritätstag nicht mit einem vernünftigen finanziellen und technischen Aufwand praktisch umsetzbar gewesen, greift auch dieser Ansatz nicht durch. Es steht nach der Beweisaufnahme vielmehr zur Überzeugung des Senats fest, dass der Fachmann die ihm durch den Patentanspruch vermittelte Lehre eines nur oberflächlichen Anschmelzens zumindest der größeren Pulverkörner mit einem vernünftigen finanziellen und technischen Aufwand umsetzen konnte. Es war ihm insbesondere möglich, auf eine Pulvermischung zuzugreifen, mit der sich unter Anwendung des Ds bei bloßem Anschmelzen der Pulverpartikel als Zahnersatz geeignete Formkörper herstellen ließen. - Nach den Ausführungen des Sachverständigen waren am Prioritätstag des Klagepatents Pulvermischungen verfügbar, die zwar nicht dem theoretischen Ideal eines Korngrößenverlaufs mit maximaler Packungsdichte genügten, die aber mit einem vertretbaren finanziellen und sonstigen Aufwand herstellbar waren. Insbesondere war es danach schon zum Prioritätstag möglich, mittels Siebverfahren Pulvermischungen mit verschiedenen Kornfraktionen herzustellen und damit eine möglichst hohe Schüttdichte zu erzielen (Ergänzungs-GutA, S. 6 f. [Frage 2. c)], vgl. ferner Ergänzungs-GutA, S. 10 [Fragen I.2.2, I.4.1, I.4.2], S. 24 [Fragen II.4.2, II.4.3, S. 25 [Fragen II.5.3, II.5.4]). So benennt der Sachverständige eine sog. bimodale Mischung aus großen Körnern mit einem Durchmesser von 50 µm und kleineren Körnern mit einem Durchmesser kleiner oder gleich 10 µm als sehr guten, technisch leicht herstellbaren Kompromiss (Ergänzungs-GutA, S. 7 [Frage 2. c)]). Ganz allgemein war es dem Fachmann nach den Ausführungen des Sachverständigen auch möglich, den Korngrößenverlauf eines Mehrkomponentenpulvers über im Rahmen der Pulverherstellung und -verarbeitung übliche technische Prozesse, wie z.B. Sieben, Sichten oder Mischen, zu beeinflussen (Ergänzungs-GutA, S. 10 [Frage I.2.2]). Biokompatible Pulvermischungen wären am Prioritätstag ebenfalls herstellbar gewesen (Protokoll II, S. 6).
- Ob und ggf. mit welchem Aufwand es dem Fachmann am Prioritätstag auch möglich gewesen wäre, eine Pulvermischung mit einem sog. kontinuierlichen oder trimodalen Korngrößenverlauf zur Erzielung einer optimalen Packungsdichte schon im Pulverbett zu beschaffen, ist hingegen nicht entscheidend. Das Klagepatent fordert solches gerade nicht (dazu näher unten zu Merkmal 3.1). Vor diesem Hintergrund bedarf auch die von den Parteien diskutierte Frage, ob bei Körnern mit einer Größe im Bereich von 1 µm das die Handhabung solcher Körner erschwerende Problem der Agglomeration besteht, ob sich dieses ggf. durch Oberflächenbehandlung überwinden lässt und ob kleinste Körner auch im agglomerierten Zustand noch als Füller von Hohlräumen zwischen größeren Körnern in Pulvermischungen in Betracht kommen, keiner näheren Betrachtung.
-
kk)
Auf die von den Parteien eingehend diskutierte Frage, ob (auch) das Laser-Schmelzverfahren zum Prioritätszeitpunkt praktisch umsetzbar gewesen wäre, kommt es für das Verständnis des Klagepatents ebenfalls nicht an. - Nach den Ausführungen des Sachverständigen war, wie bereits erwähnt, dem Fachmann am Prioritätstag das Laser-Schmelzverfahren für die Verarbeitung von Einkomponentenpulvern (lediglich) aus der Forschung bekannt. Eine kommerzielle Verfügbarkeit entsprechender Laser-Schmelzmaschinen hat danach aber nicht bestanden (GutA, S. 6 [Frage A.2], Ergänzungs-GutA, S. 34 [Frage 8.a)], S. 39 f. [Frage 13.a)], vgl. ferner Anlage zum Protokoll I, S. 1 [Frage 2], Ergänzungs-GutA, S. 11 [Frage I.5.2]). Mit der zum damaligen Zeitpunkt kommerziell erhältlichen Systemtechnik wäre es nach den Erläuterungen des Gerichtsgutachters zu der bereits erwähnten, auch im Fachbuch von E beschriebenen Bildung von Schmelzkugeln und damit zu einer Porosität gekommen (Ergänzungs-GutA, S. 39 f. [Frage 13.a)], siehe auch Ergänzungs-GutA, S. 34 f. [Frage 8.b)]). Für die Verarbeitung hätte es spezieller Lasersystemtechnik bedurft, die eine Bearbeitung unter Schutzgasatmosphäre ermöglicht hätte (GutA, S. 6 [Frage A.2], siehe ferner Ergänzungs-GutA, S. 35 [Frage 8.b)]).
- Die Klägerin hält diesen Ausführungen eine Reihe von Argumenten entgegen und erwähnt unter anderem die Möglichkeit einer Verwendung von Einkomponentenpulvern aus Gold oder Kunststoff am Prioritätstag des Klagepatents. Selbst wenn aber dem Fachmann das vollständige Durchschmelzen von (insbesondere) Einkomponentenpulvern am Prioritätstag auch in der praktischen Umsetzung grundsätzlich möglich gewesen sein sollte, stellt dies die gefundene Auslegung nicht in Frage. Dass auch bei einem anderen Verständnis als demjenigen, von dem das Klagepatent ausgeht, die in diesem vermittelte technische Lehre zum Prioritätszeitpunkt praktisch umsetzbar gewesen wäre, zwingt nicht dazu, auch dieses abweichende Verfahren in den Schutzbereich des Patentanspruchs einzubeziehen.
-
ll)
Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die vorliegende Stellungnahme der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in Gestalt der Entscheidung vom 16.12.2019 (Entscheidung TBK II) berufen. Zwar könnten die Ausführungen der Technischen Beschwerdekammer in dieser Entscheidung zur DE 196 49 XXX (D35) darauf hindeuten, dass die Technische Beschwerdekammer ein vollständiges Aufschmelzen des Werkstoffpulvers, wie es von dem C Patent gelehrt wird, als vom Begriff des „Laser-Sintern“ bzw. „Ds“ im Sinne des Klagepatents umfasst ansieht. Denn sie hat bei ihrer Entscheidung nicht darauf angestellt, dass die D35 kein patentgemäßes D offenbart, sondern nur darauf, dass der Fachmann das aus dieser Schrift bekannte Verfahren nicht zur Herstellung von Kronen einsetzen würde (Entscheidung TBK II, S. 21 Rn. 5.2.2). Damit, was unter „Laser-Sintern“ im Sinne des Klagepatents zu verstehen ist, hat sich die Technische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 16.12.2019 jedoch nicht befasst. Die Ausführungen der Technische Beschwerdekammer in ihrer ersten Beschwerdeentscheidung vom 05.06.2014 (Entscheidung TBK I) sprechen zudem eher dafür, dass die Beschwerdekammer in dieser früheren Entscheidung noch davon ausgegangen ist, dass das Klagepatent ein Sinterverfahren zum Gegenstand hat, bei dem nur die Oberfläche der Pulverkörner angeschmolzen wird. Die Technische Beschwerdekammer hat sich in dieser Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit der Erfindung mit der Frage befasst, ob es bei einem Sinterverfahren, bei dem nur die Oberfläche der Pulverbestandteile angeschmolzen wird, Dichten in der Größenordnung von 99% erzielen lassen. Sie hat es in diesem Zusammenhang für erwiesen angesehen, dass es sehr wohl möglich sei, durch Lasersintern, bei dem nicht der („das“) vollständige Kern, sondern nur dessen äußerer Teil angeschmolzen werde, Bauteile mit einer 99-prozentigen Dichte herstellen lassen (Entscheidung TBK I, S 5/6 Rn. 2.2). Darauf, dass sich jedenfalls bei einem vollständigen Aufschmelzen der Pulverkörner Bauteile mit einer solchen Dichte fertigen lassen, hat die Technische Beschwerdekammer in dieser Entscheidung nicht abgestellt, und sie hat dort auch nicht anderweitig zum Ausdruck gebracht, dass (auch) ein vollständiges Aufschmelzen der Pulverkörner als ein patentgemäßes „Laser-Sintern“ anzusehen ist. -
mm)
Der von der Klägerin unter Verweis auf das in der Berufungsinstanz vorgelegte Privatgutachten des Dr.-Ing. G (Anlage K 34) geleistete Vortrag führt ebenfalls nicht zu einer anderen Beurteilung. Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang insbesondere geltend, dass das Klagepatent aus technischen Gründen keine oberflächliche Anschmelzung der Pulverkörner adressieren könne, weil es – kurz zusammengefasst – nicht möglich sei, die Laserenergie so einzustellen, dass nicht entweder (bei zu hoher Leistung) ein großer Anteil der Pulverkörner vollständig durchgeschmolzen werde oder dass die größeren Pulverkörner (bei zu geringer Leistung) nicht einmal mehr angeschmolzen würden. Bei Ausrichtung der Laserenergie gemäß der Mindestanforderung, wonach alle – auch die großen – Pulverkörner überhaupt (an)geschmolzen werden sollten, würden demnach mehr als 90 % der Pulverkörner vollständig durchschmelzen. Wenn man die Laserleistung hingegen so reduziere, dass die Körner mit mittlerer Korngröße oberflächlich angeschmolzen würden, resultiere hieraus dennoch, dass nahezu die Hälfte aller Pulverkörner vollständig durchgeschmolzen, die größeren Pulverkörner hingegen gar nicht mehr angeschmolzen würden, sondern lediglich lose oder allenfalls diffusionsverbunden im Verband verblieben. - Wie bereits ausgeführt, fordert das Klagepatent nicht das nur oberflächliche Anschmelzen aller Pulverkörner, sondern lässt das vollständige Durchschmelzen insbesondere kleinerer, als Binder fungierender Pulverkörner zu. Auch einen bestimmten Korngrößenverlauf gibt das Klagepatent nicht vor (dazu näher sogleich zu Merkmal 3.1). Vor diesem Hintergrund zeigen die von der Klägerin unter Verweis auf ihren Privatgutachter genannten Zahlen schon keinen grundlegenden Hinderungsgrund für den Fachmann auf, das Klagepatent in dem dargestellten Sinne zu lesen. Abgesehen davon weisen die Beklagte und ihre Streithelferin zu Recht darauf hin, dass die von dem Privatgutachter der Klägerin betrachteten Pulverchargen ganz bestimmte Parameter aufweisen und überdies die Berechnungen in der praktischen Anwendung zu berücksichtigende zusätzliche Faktoren außer Betracht lassen. Dass die anhand dieser Chargen gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich in der von der Klägerin vorgenommenen Weise verallgemeinert werden können, lässt sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen.
-
b)
Nach Merkmal 3.1 weist der biokompatible Werkstoff eine „unterschiedliche Korngröße zwischen 0 und 50 µm“ auf. -
aa)
Der vorgegebenen Spanne („zwischen 0 und 50 µm“) entnimmt der Fachmann zunächst, dass das Pulver grundsätzlich keine Körner enthalten darf, die größer als 50 µm sind. Diese Vorgabe dient der Erzielung einer Passgenauigkeit; das Bauteil ist mit einer Toleranz von ca. 50 µm herstellbar (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 38 [Frage 11.a)]). Auch diesen Umstand spricht das Klagepatent in Absatz [0005] an, wenn es dort heißt: - „Der Korngrößenverlauf …; er legt ferner die Abmessung und Paßgenauigkeit der Restauration fest.“
-
bb)
Soweit es die weitere Vorgabe einer „unterschiedlichen Korngröße“ angeht, entnimmt der Fachmann dem zunächst, dass die im Pulver enthaltenen Korngrößen nicht gleich sein dürfen (vgl. Einspruchsabteilung II, S. 7). Ausgeschlossen sind demnach Pulver, die nur eine Korngröße enthalten (vgl. auch GutA, S. 12). Es müssen mindestens zwei voneinander verschiedene Korngrößen im Pulver vorhanden sein. Hintergrund sind die bereits erörterten, in Absatz [0005] genannten Vorteile des Korngrößenverlaufs: Dieser gewährleistet eine besonders dichte Sinterung mit dem Vorteil hoher Druckbelastbarkeit des Formkörpers und geringer Bildung von Hohlräumen. Durch die Auswahl des Korngrößenverlaufs lässt sich die Schüttdichte des Pulvers beeinflussen, die wiederum von entscheidender Bedeutung für die spätere Festigkeit des Formkörpers ist. Konkret führt eine hohe Schüttdichte zu einer hohen Dichte im Produkt (GutA, S. 13 [Frage I.8.3]). Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass sich der Patentanspruch 1 nicht auf die Verwendung von Einkomponenten- oder Mehrkomponentenpulvern festlegt. Bei Einkomponentenpulvern besteht, wie bereits erwähnt, anders als bei Mehrkomponentenpulvern nicht die Möglichkeit, durch die Auswahl von Komponenten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten eine dichte Sinterung zu gewährleisten. Auch vor dem Hintergrund, in diesem Fall ebenfalls ein unterschiedliches Schmelzverhalten bei Einwirkung der Energie eines Laserstrahls sicherzustellen, weist das Klagepatent den Fachmann zur Auswahl unterschiedlicher Korngrößen an. - Einen bestimmten Korngrößenverlauf, insbesondere einen sog. kontinuierlichen (= serialen, stetigen) Korngrößenverlauf, bei dem prinzipiell alle Korngrößen im Pulvergemisch vorhanden sind (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 6 [Frage 2. a)]), gibt der Anspruch nicht vor. Ein kontinuierlicher Korngrößenverlauf ist zwar für die Erzielung einer besonders dichten Packung schon vor der Sinterung vorteilhaft (GutA, S. 12 f. [Frage 4. d)], Anlage zum Protokoll I, S. 7 [Frage 14]). Indem das Pulver Körner aller Größenfraktionen umfasst, wird sichergestellt, dass beim Auftragen des Pulvers wenig Hohlräume zwischen den Pulverkörnern entstehen (Anlage zum Protokoll I, S. 6 [Frage 12], S. 7 [Frage 14]). Ein theoretisches Optimum für die Packungsdichte kann nach den Ausführungen des Sachverständigen zusätzlich erzielt werden, wenn neben einem kontinuierlichen Korngrößenverlauf das Pulver eine sphärische Form besitzt und der Massenanteil der Körner der sog. Fuller-Parabel genügt (Anlage zum Protokoll I, S. 7 [Frage 13]). Eine ähnlich hohe Packungsdichte ist demnach – zumindest theoretisch – bei einer sog. trimodalen Mischung mit einem Partikelgrößenverhältnis von 1:7:49 erreichbar (Anlage zum Protokoll I, S. 7 [Frage 13]). Wird ein sog. bimodales Pulver mit nur zwei Korngrößen gewählt, ist hingegen ein Größenverhältnis zwischen größeren und kleineren Körnern von 1:7 von Vorteil, weil – was dem Fachmann am Prioritätstag bekannt war – die kleineren Körner sich in diesem Fall am besten in die Lücken zwischen den größeren Körnern legen (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 24 f. [Frage II.5.1] ff., siehe auch S. 36 [Frage 9.a)]).
- Hieraus lässt sich allerdings nicht der Schluss ziehen, der Anspruch setze zwingend einen solchen Verlauf voraus. Die Schüttdichte des Pulvers ist bei einer entsprechenden Auswahl der Korngrößen allein dadurch gegenüber einem Pulver mit gleicher Korngröße erhöht, dass mindestens zwei unterschiedliche Korngrößen enthalten sind (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 13 [Frage I.8.1], siehe auch S. 24 f. [Frage II.4.2], [Frage II.5.2]). Im Übrigen stellt es das Klagepatent in das Ermessen des Fachmanns, ein Pulver mit einem Korngrößenverlauf zu wählen, der eine dichte Sinterung und die Herstellung von Kronen, Brücken oder Inlays ermöglicht. Es ist nicht das Ziel der Erfindung, einen verbesserten oder gar optimalen Zahnersatz herzustellen, sondern lediglich, wie erläutert, einen anderen vorteilhaften Weg zur Herstellung derartiger Formkörper aufzuzeigen (vgl. Entscheidung TBK I, S. 7).
- Ausreichend, aber auch erforderlich ist demnach die Auswahl eines zur Erzielung einer dichten Sinterung geeigneten Pulvers, wobei dieses grundsätzlich keine Körner mit einer Korngröße größer als 50 µm aufweisen darf und Kornfraktionen von mindestens zwei unterschiedlichen Größen enthalten muss.
-
c)
Das mit der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens herstellbare Verfahrensprodukt muss, wie sich aus Merkmal 4 ergibt, als Zahnersatz, nämlich als Krone, Brücke oder Inlay, geeignet sein. - Eine bestimmte Mindestdichte oder eine maximale Restporosität gibt das Klagepatent allerdings nicht vor, sondern nennt in diesem Zusammenhang nur die besonders dichte Sinterung mit dem Vorteil hoher Druckbelastbarkeit des Formkörpers und geringer Bildung von Hohlräumen (Abs. [0005]). Dass das Klagepatent – wie bereits angesprochen – von einer „geringen“ Bildung von Hohlräumen spricht, zeigt zudem, dass es eine Dichte von annähernd 100 % gerade nicht für erforderlich hält.
- Konkrete Anforderungen an die Mindestdichte des mit der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens erzielbaren Zahnersatzes ergeben sich auch nicht aus dem in der Klagepatentschrift gewürdigten Stand der Technik. So beschreibt das Klagepatent in Bezug die US 4,863,XXX als nachteilig, dass „keine ausreichend dichten und somit hinreichend belastbaren Produkte“ herstellbar sind und somit die soeben erwähnten umfangreichen Nacharbeiten notwendig werden (Abs. [0003]). An der aus der FR 2 754 XXX bekannten Lehre kritisiert das Klagepatent eine „Restporosität“ und eine nicht ausreichende Festigkeit der „porösen Keramik“, die den Einsatz im hochbelastbaren Zahnaufbereich nicht zuließen (Abs. [0002]). Bestimmte (Mindest-)Werte nennt das Klagepatent auch an dieser Stelle nicht. Zwar mögen nach dem Wissen des Fachmanns mit dem in Absatz [0001] als Stand der Technik gewürdigten Gießverfahren oder dem Fräsen aus dem vollen Material Bauteildichten von 99 % erreichbar sein (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 3). Diese Verfahren erachtet das Klagepatent jedoch wegen des damit verbundenen erheblichen Abfalls als nachteilig. Dass die mit diesen Verfahren erzielbaren Bauteildichten auch mit dem erfindungsgemäßen Verfahren zwingend erreichbar sein müssen, lässt sich dem Klagepatent indes nicht entnehmen. Wie bereits erwähnt, macht es sich das Klagepatent auch nicht zur Aufgabe, einen verbesserten oder gar optimalen Zahnersatz herzustellen, sondern lediglich, einen anderen vorteilhaften Weg zur Herstellung derartiger Formkörper aufzuzeigen (vgl. Entscheidung TBK I, S. 7).
- Vor dem Hintergrund des dargelegten Verständnisses kommt es auf den von der Klägerin unter Verweis auf von ihr in der Berufungsinstanz vorgelegte gutachterliche Stellungnahmen geleisteten Vortrag, wonach Zahnersatz eine Mindestdichte im Bereich von 99 % aufweisen muss, nicht an. Ebenso kann dahinstehen, ob sich – wie von der Streithelferin der Beklagten behauptet – mit bimodalen Pulvern immerhin Schüttdichten von 94 % und mit trimodalen Pulvern sogar noch deutlich höhere Dichten erreichen lassen. Darüber hinaus kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass dem angesprochenen Durchschnittsfachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift unweigerlich bewusst ist, dass sich durch Lasersintern, bei dem die Pulverkörner nur oberflächlich angeschmolzen werden, kein Zahnersatz mit einer 99 %-igen Dichte herstellen lässt. Die fachkundige Technische Beschwerdekammer hat dies in ihrer ersten Einspruchsbeschwerdeentscheidung gerade nicht angenommen (Entscheidung TBK I, S. 5/6 Rn. 2.2).
-
3.
Ausgehend von dem dargestellten Verständnis macht die Beklagte mit der Anwendung des sog. „H-Verfahrens“ von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in seiner eingeschränkten Fassung nicht wortsinngemäß Gebrauch. - Weil bei dem „H-Verfahren“ unstreitig alle Pulverpartikel mehrfach vollständig durchgeschmolzen werden, handelt es sich nach dem vorstehend dargestellten Verständnis nicht um ein „D“ im Sinne des Klagepatents (Merkmale 1, 3, 4).
-
4.
Die Verletzung der Lehre des Klagepatents mit abgewandelten, aber äquivalenten Mitteln ist nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens geworden. -
a)
Allerdings ist die Frage der Äquivalenz nicht bereits deshalb nicht Streitstoff der Berufung geworden, weil Ausführungen hierzu in der Berufungsbegründung fehlen. -
aa)
Gemäß § 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ZPO hat die Berufungsbegründung die Bezeichnung der Umstände zu enthalten, aus denen sich nach Ansicht des Rechtsmittelführers die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergibt. Da die Berufungsbegründung erkennen lassen soll, aus welchen tatsächlichen und rechtlichen Gründen der Berufungskläger das angefochtene Urteil für unrichtig hält, hat dieser diejenigen Punkte rechtlicher Art darzulegen, die er als unzutreffend ansieht und dazu die Gründe anzugeben, aus denen er die Fehlerhaftigkeit jener Punkte und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung herleitet (BGH, NJW-RR 2016, 80 Rn. 6; NJW-RR 2022, 731 Rn. 11). Eine Berufungsbegründung genügt den Anforderungen des § 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 bis 4 ZPO demgemäß nur dann, wenn sie erkennen lässt, in welchen Punkten tatsächlicher oder rechtlicher Art das angefochtene Urteil nach Ansicht des Berufungsklägers unrichtig ist und auf welchen Gründen diese Ansicht im Einzelnen beruht (vgl. BGH, NJW-RR 2007, 414 Rn. 10). Der Berufungsführer muss mit der Berufungsbegründung klarstellen, in welchen Punkten und mit welcher Begründung er das Berufungsurteil angreift (BGH, NJW-RR 2007, 414 Rn. 10). Im Falle der uneingeschränkten Anfechtung muss die Berufungsbegründung geeignet sein, das gesamte Urteil in Frage zu stellen. Bei mehreren Streitgegenständen oder bei einem teilbaren Streitgegenstand muss sie sich grundsätzlich auf alle Teile des Urteils erstrecken, hinsichtlich derer eine Änderung beantragt ist; anderenfalls ist das Rechtsmittel für den nicht begründeten Teil unzulässig (BGH, NJW 2002, 682, 683; NJW 2003, 2531; NJW-RR 2007, 414 Rn. 10; BGH, Beschl. v. 14.09.2021 – VIII ZB 1/20, BeckRS 2021, 32917 Rn. 13; NJW-RR 2022, 731 Rn. 13; NJW-RR 2024, 799 Rn. 9; Beschl. v. 03.06.2024 – VI ZB 44/22, BeckRS 2024, 14707 Rn. 9; BeckOK ZPO/Wulf, 53. Ed. Stand: 01.07.2024, § 520 Rn. 22; Musielak/Voit/Ball, ZPO, 21. Aufl. 2024, § 520 Rn. 38). Liegt dem Rechtsstreit dagegen ein einheitlicher Streitgegenstand zugrunde, muss der Berufungskläger nicht zu allen für ihn nachteilig beurteilten Streitpunkten in der Berufungsbegründung Stellung nehmen, wenn schon der allein vorgebrachte – unterstellt erfolgreiche – Berufungsangriff gegen einen Punkt geeignet ist, der Begründung des angefochtenen Urteils insgesamt die Tragfähigkeit zu nehmen (BGH, NJW 2015, 3040 Rn. 12; NJW-RR 2024, 799 Rn. 9; Beschl. v. 03.06.2024 – VI ZB 44/22, BeckRS 2024, 14707 Rn. 9). Anders liegt es dann, wenn das Gericht seine Entscheidung auf mehrere voneinander unabhängige, selbständig tragende rechtliche Erwägungen stützt. In diesem Fall muss der Berufungskläger in der Berufungsbegründung für jede dieser Erwägungen darlegen, warum sie nach seiner Auffassung die angegriffene Entscheidung nicht tragen (BGH, NJW 2015, 3040 Rn. 12; NJW-RR 2024, 799 Rn. 9; Beschl. v. 03.06.2024 – VI ZB 44/22, BeckRS 2024, 14707 Rn. 9). -
bb)
Daran gemessen ist das Rechtsmittel nicht (teilweise) unzulässig, weil sich die Klägerin erst mit ihrer Berufungsreplik gegen die Ausführungen des Landgerichts zur Äquivalenz wendet. - Es handelt sich bei der äquivalenten Patentverletzung im Verhältnis zu der wortsinngemäßen Patentverletzung weder um einen anderen Streitgegenstand (vgl. Senat, Urt. v. 20.12.2012 – I-2 U 89/07, BeckRS 2013, 11856; Urt. v. 21.03.2013 – I-2 U 73/09, BeckRS 2013, 12504; GRUR-RR 2014, 185, 191 – WC-Sitzgelenk; Urt. v. 21.12.2017 – I-15 U 93/16, BeckRS 2017, 147919 Rn. 29; Urt. v. 01.08.2024 – I-2 U 125/22; OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 67 – Polsterumarbeitungsmaschine) noch besteht insoweit eine Teilbarkeit. Nachdem für die Bewertung der Teilbarkeit des Streitgegenstands grundsätzlich die zur Zulässigkeit eines Teilurteils aufgestellten Grundsätze herangezogen werden können (vgl. BGH, NJW-RR 2024, 799 Rn. 10 unter Verweis auf BGH, NJW 2018, 621 Rn. 10), ist entscheidend, ob sich der Teil eines einheitlichen Streitgegenstands so individualisieren und abgrenzen lässt, dass er einer gesonderten rechtlichen und tatsächlichen Beurteilung zugänglich ist (vgl. BGH, NJW 2000, 137, 138; Saenger/Saenger, ZPO, 10. Aufl. 2023, § 301 Rn. 2). Dies ist nicht der Fall. Die wortsinngemäße und die äquivalente Patentverletzung bedingen sich in ihrer rechtlichen Beurteilung gegenseitig und schließen sich zugleich aus. Die Ablehnung der – in erster Instanz hilfsweise geltend gemachten – Äquivalenz durch das Landgericht stellt aus diesen Gründen auch keine selbstständig die Abweisung der Klage tragende Erwägung dar.
-
b)
Die Klägerin hat jedoch – trotz Hinweises in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 05.09.2024 (Protokoll II S. 2, Bl. 2008 GA) – keinen Klageantrag gestellt, aus dem sich ergibt, in welcher tatsächlichen Gestaltung sich die Abweichung von den Vorgaben des Patentanspruchs verkörpern soll. Soll aber eine Ausführungsform als vom erteilten Klagepatent erfasst angegriffen werden, die nach Ansicht des Verletzungsklägers eine vom Wortsinn abweichende Gestalt aufweist, muss sich dies aus dem Antrag ergeben (BGH, GRUR 2010, 314 Rn. 31 – Kettenradanordnung II; GRUR 2011, 313 Rn. 38 – Crimpwerkzeug IV; vgl. auch GRUR 2014, 852, 853 – Begrenzungsanschlag). Soweit die Klägerin in ihrem Berufungsantrag abweichend vom Wortlaut des Patentanspruchs den Begriff „Schmelzen“ statt „Sintern“ verwendet, ist diese Antragstellung – wie bereits in erster Instanz (vgl. LGU, S. 5) – allein auf die wortsinngemäße Patentverletzung bezogen. - Dass die Klägerin in erster Instanz einen Hilfsantrag wegen einer äquivalenten Patentverletzung gestellt hatte, führt nicht dazu, dass dieser im Berufungsverfahren anfällt. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung fällt zwar ein wegen Zuerkennung des Hauptantrags erstinstanzlich nicht beschiedener Hilfsantrag des Klägers in der Berufungsinstanz allein durch die Rechtsmitteleinlegung seitens des Beklagten an, ohne dass es einer Anschlussberufung bedarf (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 220; NJW 2019, 1950 Rn. 19; NJW-RR 2013, 1334 Rn. 9; BGH, NJW-RR 2023, 1166 Rn. 11). Hier hat die Klägerin in erster Instanz jedoch nicht obsiegt, vielmehr ist ihre Klage vom Landgericht insgesamt abgewiesen worden, wobei das Landgericht sowohl dem auf eine wortsinngemäße Patentverletzung gestützten Klageantrag als auch dem hilfsweise auf eine äquivalente Patentverletzung gestützten Klageantrag nicht entsprochen hat.
-
c)
Abgesehen davon liegen die Voraussetzungen patentrechtlicher Äquivalenz nicht vor. Mit Recht hat das Landgericht auch eine äquivalente Patentverletzung verneint. -
aa)
Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende Ausführung in dessen Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit (zwar abgewandelten, aber) objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine im Prioritätszeitpunkt gegebenen Fachkenntnisse den Fachmann befähigt haben, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichenden Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen der Gleichwirkung, der Auffindbarkeit und der Orientierung am Patentanspruch erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fachmännischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lösung in Betracht zu ziehen und damit bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (st. Rspr., z.B. BGH, GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2007, 959 Rn. 24 – Pumpeinrichtung; GRUR 2011, 313 Rn. 35 – Crimpwerkzeug IV; GRUR 2014, 852 Rn. 12 – Begrenzungsanschlag; GRUR 2015, 361 Rn. 18 – Kochgefäß; GRUR 2021, 574 Rn. 40 – Kranarm). -
bb)
Im Streitfall kann dahinstehen, ob die erste und die zweite Voraussetzung patentrechtlicher Äquivalenz erfüllt sind. Insoweit muss hier insbesondere nicht entschieden werden, ob es im Hinblick auf das von der Beklagten eingesetzte „H-Verfahren“ schon an der erforderlichen Gleichwirkung fehlt. Zumindest sind diejenigen Überlegungen, die der Fachmann anzustellen hat, um zu dem angegriffenen Verfahren zu gelangen, nicht derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert, dass der Fachmann diese abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen Lehre gleichwertige Lösung in Betracht zieht, weshalb es hier jedenfalls an der dritten Voraussetzung patentrechtlicher Äquivalenz fehlt. - „Orientierung am Patentanspruch“ setzt voraus, dass die Überlegungen, die der Fachmann anzustellen hat, um zu der gleichwirkenden Abwandlung zu gelangen, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sind, dass er die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentgemäßen Lehre gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Dabei reicht es nicht aus, dass er aufgrund seines Fachwissens eine Lehre als technisch sinnvoll und gleichwirkend zu der in den Patentansprüchen formulierten Lehre erkennt. Vielmehr muss er sich am Patentanspruch orientieren, der mit allen seinen Merkmalen nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für seine Überlegungen bildet (BGH, GRUR 2002, 515, 517 – Schneidmesser I; GRUR 2011, 701 Rn. 35 – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2016, 921 Rn. 50 – Pemetrexed; GRUR 2016, 1254 Rn. 19 – V-förmige Führungsanordnung; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185, 193 – WC-Sitzgelenk; Urt. v. 19.09.2019 – I-15 U 36/15, GRUR-RS 2019, 44914 Rn. 56 – Türbandscharnier). Dabei ist der Patentinhaber an die technische Lehre gebunden, die er unter Schutz hat stellen lassen. Sie muss von ihm als sinnhaft hingenommen werden und darf bei der Suche nach einem gleichwirkenden Austauschmittel in ihrer sachlichen Berechtigung nicht (wieder) infrage gestellt werden (BGH, GRUR 2002, 511 – Kunststoffrohrteil; Senat, Urt. v. 10.06.2021 – I-2 U 19/19, GRUR-RS 2021, 15125 Rn. 63 – Rohrreinigungsgerät m.w.N.). Die Überlegungen dürfen sich nicht vom Sinngehalt des Patentanspruchs lösen, sondern müssen diesem so nahekommen, dass die Wertung geboten ist, die angegriffene Ausführungsform beruhe trotz der Abweichung auf dem Patentanspruch und stelle in einem weiteren Sinne noch eine patentgemäße Lösung dar (Senat, Urt. v. 10.06.2021 – I-2 U 19/19, GRUR-RS 2021, 15125 Rn. 63 – Rohrreinigungsgerät m.w.N.).
- Nach diesen Rechtsgrundsätzen fehlt es hier an einer Orientierung am Patentanspruch. Da ein D im Sinne des Klagepatents – wie ausgeführt – ein Verfahren ist, bei dem jedenfalls die größeren Pulverkörner nur oberflächlich angeschmolzen werden, macht die Beklagte mit der Anwendung des „H-Verfahrens“, bei dem alle Pulverkörner mehrfach vollständig durchgeschmolzen werden, genau das Gegenteil dessen, was das Klagepatent lehrt. Zwar mag auch mit dem „H-Verfahren“ Zahnersatz hoher – möglicherweise sogar höherer – Dichte und Eignung erzielbar sein. Das Klagepatent hat sich aber auf das nur oberflächliche Anschmelzen der Pulverkörner festgelegt.
-
5.
Die Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens durch einen dentaltechnisch sachverständigen Gutachter, wie von der Klägerin angeregt, war nicht veranlasst. - Dass der Sachverständige nicht auch auf dem Gebiet der Dentaltechnik praktisch tätig ist bzw. am Prioritätstag war, steht seiner Eignung für die Beantwortung der Beweisfrage nicht entgegen. Der Sachverständige ist nicht dazu herangezogen worden, um dem Senat in Bezug auf die Eignung als Zahnersatz den Kenntnisstand zu vermitteln, mit dem ein Durchschnittsfachmann am Prioritätstag versehen war und mit dem sich dieser dem Verständnis des Patentanspruchs genähert hat. Seine Heranziehung diente vielmehr maßgeblich der Klärung des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Verständnisses des Fachmanns von dem Begriff des Laser-Sinterns. Hierzu ist der gerichtliche Sachverständige als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Bereich Lasertechnik/Lasermaterialbearbeitung, der auch schon zum Prioritätstag mit der Entwicklung und Anwendung von Laserprozessen für die Präzisionsbearbeitung metallischer Werkstoffe in der Dienstleistung und im Maschinenbau tätig war (vgl. Ergänzungs-GutA, S. 5), besonders geeignet. Soweit der Sachverständige erklärt hat, nicht beurteilen zu können, welche Eigenschaften (Bauteildichte) die gesinterten Bauteile haben müssen, um als Zahnersatz einsetzbar zu sein, stellt dies seine Fachkompetenz für die von dem Senat adressierten Fragen vor diesem Hintergrund nicht in Frage.
- III.
- Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91a Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 1, § 101 Abs. 1 ZPO.
- Nachdem das Landgericht den Ausspruch über die Kosten der Streithelferin der Beklagten übergangen hat, hat der Senat auch über die Kosten der in erster Instanz verursachten Kosten der Nebenintervention zu befinden. Der Senat kann hierüber von Amts wegen entscheiden, ohne dass es einer Anschlussberufung bedurfte. Denn auch das Rechtsmittelgericht hat ohne Rücksicht auf Parteianträge eine unterbliebene Kostenentscheidung nach § 308 Abs. 2 ZPO nachzuholen (BAG, BB 1975, 231), wobei diese Vorschrift auch für die Kosten der Streithilfe gilt (Senat, Urt. v. 10.09.2024 – I-2 U 32/24; OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.11.2019 – 15 U 73/19, BeckRS 2019, 63215 Rn. 73). Das Verbot, die angefochtene Entscheidung zulasten des Rechtsmittelführers abzuändern (reformatio in peius), steht dem nicht entgegen (BGH, NJW 2021, 1018 Rn. 32 – Musterfeststellungsklage).
- Soweit die Parteien den Rechtsstreit im Berufungsrechtszug in der Hauptsache betreffend den ursprünglich ferner geltend gemachten Unterlassungsanspruch übereinstimmend für erledigt erklärt haben, entspricht es billigem Ermessen, die hierauf entfallenden Kosten ebenfalls der Klägerin aufzuerlegen. Weil die Beklagte von der Lehre das Klagepatents weder wortsinngemäß noch – soweit dies nach den obigen Ausführungen Gegenstand der Berufung geworden sein sollte – mit äquivalenten Mitteln Gebrauch macht, stand der Klägerin bis zum Erlöschen des Klagepatents auch ein Unterlassungsanspruch aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG – der allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage – nicht zu.
- Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
- Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).