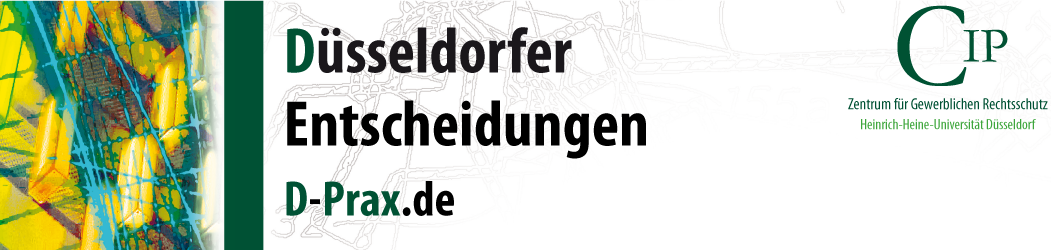Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3413
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 14. November 2024, I- 2 U 17/24
Vorinstanz: 4a O 61/18
- A.
Auf die Anschlussberufung der Klägerin wird das am 18.06.2019 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf unter Zurückweisung der Berufung der Beklagten teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:
I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren gesetzlichen Vertretern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
ein Spenderteil, das mindestens zwei Teilkomponenten aufweist, die jeweils durch eine Naht verbunden sind, wobei das Spenderteil eine erste spritzgegossene Kunststoffteilkomponente mit einer dazugehörigen ersten Verbindungsfläche entlang einer ersten Kante und eine zweite spritzgegossene Kunststoffteilkomponente mit einer dazugehörigen zweiten Verbindungsfläche aufweist, wobei die Naht durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden der ersten Teilkomponente und der zweiten Teilkomponente, um das Spenderteil zu definieren, ausgebildet ist, wobei ein Querschnittsabschnitt der Naht mindestens eine Stufe und mindestens eine Kontaktfläche zwischen einer äußeren und einer inneren Fläche des Spenderteils aufweist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei der Querschnittsabschnitt der Naht eine erste Stufe aufweist, die an die äußere Fläche des Spenderteils angrenzt, wobei die erste Teilkomponente transparent ist und die zweite Teilkomponente undurchsichtig ist, wobei das Spenderteil abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden ist, um ein Spendergehäuse auszubilden, und wobei der hintere Spenderabschnitt eingerichtet ist, an einer vertikalen Fläche montiert zu sein;
wobei das erste Komponententeil ein MABS-Kunststoffteil ist und das zweite Komponententeil ein ABS-Kunststoffteil ist, sowohl das erste als auch das zweite Komponententeil eine vordere Fläche und eine erste und zweite Seitenfläche aufweisen, die jeweils eine von der vorderen Fläche abgewandte freie Seitenkante aufweisen, und sich die Naht von der abgewandten freien Seitenkante, die zu der ersten Seitenfläche gehört, über zumindest einen Teil der vorderen Fläche des Spenderteils zu der abgewandten freien Seitenkante erstreckt, die zu der zweiten Seitenfläche gehört, und im Bereich der Naht eine führende Kante des zweiten Komponententeils derart angeordnet ist, dass sie das erste Komponententeil zum Verdecken der Naht überlappt;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22.06.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe
a. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
c. der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22.07.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe:
a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und, -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
d. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte Verbrauchsmaterialien zur Verwendung in Vorrichtungen nach Ziffer 1. an die unter Ziffer 2.b) genannten gewerblichen Abnehmer seit dem 22.07.2016 geliefert hat, und zwar unter Angabe
a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und, -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten, in Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer in der Aufstellung enthalten ist;
5. die unter I.1. bezeichneten, seit dem 22.06.2016 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 18.06.2014 und Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 14.11.2024) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufene Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziff. I. 1. bezeichneten und seit dem 22.07.2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. -
B.
Der Antrag der Beklagten auf Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen wird zurückgewiesen. -
C.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz. Die Kosten der Nebenintervention haben die Streithelferinnen der Beklagten selbst zu tragen. -
D.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. -
E.
Die Revision wird nicht zugelassen. -
F.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000 Euro festgesetzt. - Gründe:
-
A.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents EP 2 310 XXX XX (nachfolgend: Klagepatent, vorgelegt als Anlage KB1, in deutscher Übersetzung als Anlage KB1a). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Rückruf der angegriffenen Gegenstände sowie auf Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
Das Klagepatent wurde am 14.05.2009 unter Inanspruchnahme einer schwedischen Priorität vom 16.05.2008 angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 22.06.2016 im Patentblatt bekannt gemacht.
Das Klagepatent betrifft ein durch Spritzgießen hergestelltes Spenderteil. Sein erteilter Anspruch 1, den das Landgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat, lautet in der Verfahrenssprache wie folgt:
„Dispenser part comprising at least two component parts (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b) each joined by a seam (21; 33; 43a), said dispenser part comprising a first injection moulded plastic component part (17; 31; 41a) with an associated first mating surface along a first edge; a second injection moulded plastic component part (18; 32; 42a) having an associated second mating surface; the seam formedby said first mating surface and said second mating surface during injection moulding for joining said first component part (17; 31; 41a) and said second component part (18; 32; 42a) to define the dispenser part (20), wherein a transverse cross section of the seam (21; 33; 43a) comprises at least one step (44, 45, 46) and at least one contact surface intermediate an outer and an inner surface (47, 48) of the dispenser part (20), characterized in that the transverse cross section of the seam (21; 33; 43a) comprises a first step (44) adjacent the outer surface of the dispenser part (20), wherein the first component part (17; 31; 41a; 91; 101; 111) is transparent and the second component part (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) is opaque, wherein the dispenser part is detachably joined to a reardispensersection (96,106, 116), inorder to form a dispenser housing (97, 107, 117), and wherein the rear dispenser section (96, 106, 116) is arranged to be mounted on a vertical surface.” -
Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung dieses Patentanspruchs lautet wie folgt:
„Spenderteil, das mindestens zwei Teilkomponenten (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b) aufweist, die jeweils durch eine Naht (21; 33; 43a) verbunden sind, wobei das Spenderteil eine erste spritzgegossene Kunststoffteilkomponente (17; 31; 41a) mit einer dazugehörigen ersten Verbindungsfläche entlang einer ersten Kante und eine zweite spritzgegossene Kunststoffteilkomponenten (18; 32; 42a) mit einer zugehörigen zweiten Verbindungsfläche aufweist, wobei die Naht durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden der ersten Teilkomponente (17; 31; 41a) und der zweiten Teilkomponente (18; 32; 42a), um das Spenderteil (20) zu definieren, ausgebildet ist, wobei ein Querschnittsabschnitt der Naht (21, 33, 43a) mindestens eine Stufe (44, 45, 46) und mindestens eine Kontaktfläche zwischen einer äußeren und einer inneren Fläche (47, 48) des Spenderteils (20) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnittsabschnitt der Naht (21, 33, 43a) eine erste Stufe (44) aufweist, die an die äußere Fläche des Spenderteils (20) angrenzt, wobei die erste Teilkomponente (17; 31; 41a; 91; 101; 111) transparent ist und die zweite Teilkomponente (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) undurchsichtig ist, wobei das Spenderteil abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt (96, 106, 116) verbunden ist, um ein Spendergehäuse (97, 107, 117) auszubilden, und wobei der hintere Spenderabschnitt (96, 106, 116) eingerichtet ist, an einer vertikalen Fläche montiert zu sein.“ -
Auf eine von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht (nachfolgend: BPatG) den deutschen Teil des Klagepatents durch Urteil vom 12.11.2020 (5 Ni 22/18 (EP); Anlage BB 43; nachfolgend: BPatGU) für nichtig erklärt. Auf die Berufung der Klägerin hat der Bundesgerichtshof (nachfolgend: BGH) durch Urteil vom 14.03.2023 (X XX XX/XX; Anlage HRM 5 / BB 56; nachfolgend: BGHU) das Urteil des BPatG abgeändert und das Klagepatent mit folgender (deutscher) Fassung des Hauptanspruchs 1 aufrechterhalten (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind durch Unterstreichung gekennzeichnet):
Spenderteil, das mindestens zwei Teilkomponenten (17, 18; 31, 32; 41a, 42a; 91, 92; 101, 102; 111, 112a, 112b) aufweist, die jeweils durch eine Naht (21; 33; 43a) verbunden sind, wobei das Spenderteil aufweist:
eine erstes spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (17; 31; 41a) mit einer zugehörigen ersten Verbindungsfläche entlang einer ersten Kante und ein zweites spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (18; 32; 42a) mit einer zugehörigen zweiten Verbindungsfläche, wobei die Naht (21) durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden des ersten Komponententeils (17; 31; 41a) und des zweiten Komponententeils (18; 32; 42a) ausgebildet ist, um das Spenderteil (20) zu definieren, wobei ein querverlaufender Querschnitt der Naht (21) mindestens eine Stufe (44, 45, 46) und mindestens eine Kontaktfläche zwischen einer äußeren und einer inneren Fläche (47, 48) des Spenderteils (20) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der querverlaufende Querschnitt der Naht (21) eine erste Stufe (44) aufweist, die an die äußere Fläche des Spenderteils (20) angrenzt, wobei das erste Komponententeil (17; 31; 41a; 91; 101; 111) transparent ist und das zweite Komponententeil (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) undurchsichtig ist, wobei das Spenderteil abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt (96, 106, 116) verbunden ist, um ein Spendergehäuse (97, 107, 117) auszubilden, und wobei der hintere Spenderabschnitt (96, 106, 116) eingerichtet ist, an einer vertikalen Fläche montiert zu sein,
wobei das erste Komponententeil (17; 31; 41a; 91; 101; 111) ein MABS-Kunststoffteil ist und das zweite Komponententeil (18; 32; 42a; 92; 102; 112a, 112b) ein ABS-Kunststoffteil ist, sowohl das erste als auch das zweite Komponententeil eine vordere Fläche und eine erste und zweite Seitenfläche aufweisen, die jeweils eine von der vorderen Fläche abgewandte freie Seitenkante aufweisen, und sich die Naht von der abgewandten freien Seitenkante (22), die zu der ersten Seitenfläche gehört, über zumindest einen Teil der vorderen Fläche des Spenderteils zu der abgewandten freien Seitenkante (23) erstreckt, die zu der zweiten Seitenfläche gehört, und im Bereich der Naht eine führende Kante des zweiten Komponententeils derart angeordnet ist, dass sie das erste Komponententeil zum Verdecken der Naht überlappt. - Zur Veranschaulichung der beanspruchten Lehre wird nachfolgend Figur 13 des Klagepatents eingeblendet:
-
Diese zeigt ein Spendergehäuse (97), das ein erfindungsgemäßes Spenderteil (90) umfasst. Das Spenderteil (90) ist mit einem hinteren Spenderabschnitt (96) lösbar verbunden, wobei der hintere Spenderabschnitt (96) vorgesehen ist, um an einer vertikalen Fläche montiert zu werden. Das Spenderteil (90) wird von einem transparenten ersten Komponententeil (91) und einem opaken zweiten Komponententeil (92) gebildet, die durch eine Naht (93) verbunden sind.
Bei der Klägerin handelt es sich um ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das weltweit Hygiene- und Gesundheitsprodukte vertreibt. Die Beklagte ist eine italienische Wettbewerberin der Klägerin. Sie vertreibt nach den Feststellungen des Landgerichts im Tatbestand des angefochtenen Urteils in Deutschland unter der Marke „B“ unter anderem folgende Spender für Toilettenpapier und Papierhandtücher:
Toilettenpapierspender (B – Autocut toilet dispenser) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 1, Muster vorgelegt als Anlage K 7.1),
Handtuchrollenspender (B – Autocut towel dispenser) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 2, Muster vorgelegt als Anlage K 7.2 und B 45),
Handtuchspender (B – Fold handtowels) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 3, Muster vorgelegt als Anlage K 7.3 und B 46). -
Im Berufungsverfahren greift die Klägerin neben den drei bereits erstinstanzlich benannten Papierspendern die nachfolgend bezeichneten weiteren Spender an (vgl. auch die Übersicht in Anlage HRM 10):
Toilettenpapierspender (B – Autocut toilet dispenser) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 4a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 1, Muster vorgelegt als Anlage B 44),
Handtuchrollenspender (B – Autocut towel dispenser) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 5a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 2, Muster vorgelegt als Anlage HRM 12),
Handtuchspender (B – Fold handtowels) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 6a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 3, Muster vorgelegt als Anlage HRM 13),
Toilettenpapierspender (B – Bulk pack toilet paper) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 7a, Muster vorgelegt als Anlage B 47),
Toilettenpapierspender (B – Bulk pack toilet paper) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 8a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 7a, Muster vorgelegt als Anlage HRM 14),
Toilettenpapierspender (B – Maxi Jumbo) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 9a, Muster vorgelegt als Anlage B 48),
Toilettenpapierspender (B – Maxi Jumbo) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 10a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 9a, Muster vorgelegt als Anlage HRM 15),
Toilettenpapierspender (B – Mini Jumbo) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 11a, Muster vorgelegt als Anlage HRM 16),
Toilettenpapierspender (B – Mini Jumbo) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 12a, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform 11a, Muster vorgelegt als Anlage B 49),
Schaumseifenspender (B – Foam soap dispenser) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 13, Muster vorgelegt als Anlage HRM 17 (mit Umverpackung) / Anlage BB 65 (ohne Umverpackung)),
Schaumseifenspender (B – Foam soap dispenser) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 14, bis auf die Farbgebung identisch zur angegriffenen Ausführungsform13, Muster vorgelegt als Anlage HRM 18),
Handtuchspender (B – Autocut towel dispenser) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 15; in der Gestaltung des Gehäuses identisch zur angegriffenen Ausführungsform 2),
Falthandtuchspender (B – Folded hand towel dispenser) weiß – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 16; in der Gestaltung des Gehäuses identisch zur angegriffenen Ausführungsform 3),
Handtuchrollenspender (B – Autocut towel dispenser) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 17, identisch zur angegriffenen Ausführungsform 5a),
Toilettenpapierspender (B – Bulk pack toilet paper) schwarz – Produkt-Nr. XXXXXX (angegriffene Ausführungsform 18, identisch zur angegriffenen Ausführungsform 6a)
(nachfolgend zusammenfassend: angegriffene Ausführungsformen).
Muster der angegriffenen Ausführungsformen 1-3, 4a, 7a, 9a und 12a hat die Klägerin im Parallelverfahren XXX zur Akte gereicht; Muster der angegriffenen Ausführungsformen 5a, 6a, 8a, 10a, 11a, 13 und 14 sind im hiesigen Verfahren vorgelegt worden. Darüber hinaus hat die Beklagte mit den Anlagen BB 2 und B45 Abbildungen der angegriffenen Ausführungsformen vorgelegt. Beispielhaft werden nachfolgend Abbildungen der angegriffenen Ausführungsform 1 aus der Anlage BB2 wiedergegeben: -
Bei sämtlichen angegriffenen Ausführungsformen kann das vordere Spenderteil nach vorne zum Nutzer hin aufgeklappt werden, wobei es am Gehäuse mit zwei Scharnieren verbunden ist und um diese verschwenkt wird. Das Spenderteil weist jeweils zwei Komponententeile auf, die durch eine Naht miteinander verbunden sind und aus ABS- bzw. MABS-Kunststoff gefertigt sind.
Die Beklagte stellte die angegriffenen Ausführungsformen auf der Messe XXX 2017 in Berlin aus und bewarb diese in ihrem Online-Katalog. Die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 bezieht die Beklagte von der Streithelferin zu 1), die angegriffene Ausführungsform 3 von der Streithelferin zu 2).
Die Klägerin sieht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents. Die Beklagte, die erstinstanzlich Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung der Verhandlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren beantragt hat, stellt eine Verletzung in Abrede. Sie macht geltend, die angegriffenen Ausführungsformen würden weder ein erstes transparentes Komponententeil aufweisen noch sei das Spenderteil im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre abnehmbar mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden.
Mit dem angefochtenen Urteil vom 18.06.2019 hat das Landgericht eine Verletzung des Klagepatents bejaht und wie folgt erkannt: -
„I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
ein Spenderteil, das mindestens zwei Teilkomponenten aufweist, die jeweils durch eine Naht verbunden sind, wobei das Spenderteil eine erste spritzgegossene Kunststoffteilkomponente mit einer dazugehörigen ersten Verbindungsfläche entlang einer ersten Kante und eine zweite spritzgegossene Kunststoffteilkomponente mit einer dazugehörigen zweiten Verbindungsfläche aufweist, wobei die Naht durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden der ersten Teilkomponente und der zweiten Teilkomponente, um das Spenderteil zu definieren, ausgebildet ist, wobei ein Querschnittsabschnitt der Naht mindestens eine Stufe und mindestens eine Kontaktfläche zwischen einer äußeren und einer inneren Fläche des Spenderteils aufweist,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen
oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
wobei der Querschnittsabschnitt der Naht eine erste Stufe aufweist, die an die äußere Fläche des Spenderteils angrenzt, wobei die erste Teilkomponente transparent ist und die zweite Teilkomponente undurchsichtig ist, wobei das Spenderteil abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden ist, um ein Spendergehäuse auszubilden, und wobei der hintere Spenderabschnitt eingerichtet ist, an einer vertikalen Fläche montiert zu sein;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22.06.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe
a. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
c. der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden;
wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer 1. bezeichneten Handlungen seit dem seit dem 22.07.2016 begangen hat, und zwar unter Angabe:
a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen,
-zeiten und, -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen,
sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,
b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,
-zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen,
sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,
d. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die unter I.1. bezeichneten, seit dem 22.06.2016 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufene Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I. 1. bezeichneten und seit dem 22. Juli 2016 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.“ -
Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:
„Transparent“ im Sinne des Klagepatents sei ein Kunststoffteil, wenn es soweit durchsichtig sei, dass man den Füllstand eines hinter dem Komponententeil befindlichen Verbrauchsmaterials erkennen könne. Insofern orientiere sich der Fachmann an dem in der Patentschrift zum Ausdruck kommenden Zweck eines Merkmals. Dieser bestehe darin, den Füllstand der Verbrauchsmaterialien im Spender überprüfen zu können, ohne diesen öffnen zu müssen. Die Beschreibung des Klagepatents lasse keinen Gegensatz zwischen „Transparenz“ und „Transluzenz“ erkennen. Vielmehr würden die Begriffe „semi-transparent“ und „transluzent“ von dem anspruchsgemäßen Begriff „transparent“ mit umfasst. Unter Zugrundelegung dieses Verständnisses sei bei den angegriffenen Ausführungsformen ein transparentes erstes Komponententeil vorhanden.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen sei zudem das Spenderteil im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre „abnehmbar“ mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden. Dies erfordere nicht die Möglichkeit, das Spenderteil vollständig von dem hinteren Spenderabschnitt zu entfernen. Nach der Funktion dieses Merkmals, eine Befüllung des Spenders zu ermöglichen, genüge es vielmehr, dass sich das Spenderteil soweit (partiell) von dem hinteren Spenderabschnitt lösen lasse, dass ein Befüllen des Spenders ermöglicht werde. Dies sei auch dann der Fall, wenn das Spenderteil – wie bei den angegriffenen Ausführungsformen – verschwenkbar am hinteren Spenderabschnitt befestigt sei.
Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte Berufung eingelegt. Die Klägerin hat ihrerseits gegen das Urteil des Landgericht Anschlussberufung eingelegt.
Mi ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie geltend:
Das Landgericht habe eine zu weite Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 im Hinblick auf die „transparente“ Ausgestaltung des ersten Komponententeils und die „abnehmbare Verbindung“ zwischen Spenderteil und hinterem Spenderabschnitt vorgenommen.
Der Begriff „transparent“ sei erfindungsgemäß als „klar durchsichtig“, also ohne relevante Streuung bzw. Diffundierung der Lichtstrahlen zu verstehen. Er sei insbesondere von dem Begriff „transluzent“ abzugrenzen, womit eine Durchdringung von Licht gemeint sei, die aber kein Erkennen detaillierter Formen ermögliche. Die Klagepatentschrift verweise in nahezu allen Ausführungsbeispielen auf das Begriffspaar „opak“ und „transparent“. Soweit in der Beschreibung auch semi-transparente bzw. transluzente Ausgestaltungen erwähnt seien, würden diese von den „transparenten“ Ausgestaltungen unterschieden und seien wegen des insoweit eindeutigen Wortlauts nicht vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst. Auch in funktionaler Hinsicht würden sich transluzente Kunststoffteile wesentlich von den transparenten Kunststoffteilen unterscheiden. Üblicherweise schaue der Betrachter von schräg oben auf den Spender und dieser befinde sich häufig in schlecht ausgeleuchteten Toiletten- oder Waschräumen. Durch ein transluzentes Kunststoffteil könne der Betrachter in diesem Fall allenfalls etwas Weißliches durchschimmern sehen, nicht aber den Füllstand feststellen. In den angegriffenen Ausführungsformen sei kein transparentes Komponententeil verbaut; vielmehr seien ausschließlich transluzente und opake Teile verbaut.
Außerdem sei das Spenderteil bei den angegriffenen Ausführungsformen auch nicht „abnehmbar“ mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden. Der Begriff „detachably“/„abnehmbar“ sei von dem Begriff „pivotably“/„verschwenkbar“ zu unterscheiden. Insofern müsse das Gleiche gelten wie im Rahmen der Auslegung des Parallelpatents EP 2 313 XXX XX (nachfolgend: EP ʼXXX). Die „abnehmbare Verbindung“ im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre erfordere zwingend die Möglichkeit einer vollständigen Trennung von Spenderteil und hinterem Spenderabschnitt. Das Klagepatent beschreibe zwei „Zustände“, nämlich einen zusammengesetzten Zustand, bei dem das Spenderteil und der hintere Spenderabschnitt miteinander verbunden seien, um das Spendergehäuse zu bilden, und einen nichtverbundenen Zustand, in welchem das Spenderteil vom hinteren Spenderabschnitt abgenommen sei und zwar im Sinne einer vollständigen Trennung. Eine funktionale Betrachtung dürfe bei einem räumlich-körperlichen Merkmal nicht dazu führen, dass der Inhalt auf die bloße Funktion reduziert werde, und das Merkmal in einem Sinne interpretiert werde, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr in Übereinstimmung steht. Insofern gebe das Klagepatent mit der „Abnehmbarkeit“ eine bestimmte räumlich-körperliche Ausgestaltung vor; funktionale Erwägungen dürften nicht zu einer Auslegung „gegen“ die Begriffe des Klagepatents führen. Im Übrigen seien die Einsatzorte für Spenderteile der patentgemäßen Art zwar recht unterschiedlich, eines sei ihnen aber gemein, nämlich die räumliche Enge und schlechte Ausleuchtung. Bei einer Verschwenkung des Spenderteils um beispielsweise 90 Grad werde der Befüllvorgang erschwert, weil die aufgeklappte Frontseite dann in den Raum hineinrage. In vielen Situationen sei es deshalb von Vorteil, wenn die Frontseite komplett abgenommen werden könne, so dass sich das Reinigungspersonal auch frontal zum Spendergehäuse drehen, das Verbrauchsmaterial nachfüllen und den Dispenser dann wieder verschließen könne. Dem Fachmann seien zum Prioritätstag des Klagepatents nicht nur Spender mit verschwenkbaren Fronten, sondern auch solche mit komplett abnehmbaren Fronten bekannt gewesen. Sowohl das BPatG als auch der BGH seien in ihren Urteilen im Rechtsbestandsverfahren davon ausgegangen, dass nicht jede verschwenkbare Verbindung auch „abnehmbar“ im Sinne des Klagepatents sei.
Eine vollständige Trennung des Spenderteils vom hinteren Spenderabschnitt sei bei keiner der angegriffenen Ausführungsformen möglich, weshalb die Lehre des Klagepatentanspruchs 1 nicht verwirklicht sei. Der vom Klagepatent angesprochene Nutzer verfüge weder über spezielle Werkzeuge noch über das entsprechende handwerkliche Geschick, um das Spenderteil ohne Beschädigung der Scharniere einfach vom hinteren Spenderabschnitt lösen zu können.
Im Übrigen biete sie – die Beklagte – die angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland weder an noch vertreibe sie sie. Der Vertrieb in Deutschland finde vielmehr ausschließlich über ihr Tochterunternehmen C, Frankreich, statt, das die angegriffenen Ausführungsformen an Handelsunternehmen in Deutschland ausliefere. -
Die Beklagte und ihre Streithelferinnen beantragen,
die Klage unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4a O 61/18) vom 18.06.2019 abzuweisen. -
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückzuweisen,
dass der Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils, auf den die weiteren Aussprüche des landgerichtlichen Urteils rückbezogen sind, an den Wortlaut des vom BGH im Nichtigkeitsverfahren durch Urteil vom 14.03.2023 (X XX XX/XX) eingeschränkt aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 des Klagepatents angepasst werden soll,
und
auf die Anschlussberufung – nach teilweiser Klagerücknahme (vgl. Bl. 1507 R GA) – zu erkennen wie unter Ziffer A.I.4. des Tenors geschehen. -
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend, wobei sie nunmehr Anspruch 1 des Klagepatents in der Fassung geltend macht, die dieser Anspruch im Nichtigkeitsverfahren erlangt hat. Die Klägerin tritt den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages entgegen und macht überdies geltend, dass die angegriffenen Ausführungsformen auch die im Nichtigkeitsverfahren neu hinzugekommenen Merkmale wortsinngemäß verwirklichen. Sie führt aus:
Soweit das Klagepatent verlange, dass ein Komponententeil „transparent“ ausgebildet sei, beschreibe dies eine derart durchsichtige bzw. durchscheinende Fläche, dass der Füllstand des in dem Spender befindlichen Materials überprüft werden könne, ohne den Spender öffnen zu müssen. Dabei komme es nicht darauf an, ob eine genaue oder nur eine diffuse Bilderkennung gegeben sei. „Transparent“ werde nicht etwa von „transluzent“, sondern von „opak“ abgegrenzt. Bei den angegriffenen Ausführungsformen sei jeweils ein Komponententeil „transparent“ im vorgenannten Sinne und lasse den Füllstand erkennen, ohne dass der Spender geöffnet werden müsse. Dies gelte insbesondere auch für die schwarzen Ausführungsformen.
Die Vorgabe, dass das Spenderteil „abnehmbar“ mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden sei, verstehe der Fachmann dahin, dass die Verbindung der beiden Teile miteinander nicht permanent, sondern lösbar sein solle. Dies indiziere aber nicht, dass das Spenderteil vollständig abnehmbar sein müsse. Für eine Unterscheidung zwischen „lösbar verbunden“ („detachably joined“) und „verschwenkbar verbunden“ („pivotably joined“) gebe es keinen Raum. Das Klagepatent stelle diese beiden Begriffe in keiner Weise als gegensätzlich gegenüber. Insofern dürfe nicht auf die Auslegung des EP ʼXXX rekurriert werden, da es sich um ein anderes Patent handele. Funktional diene das Merkmal dazu, die Befüllbarkeit des Spenders zu gewährleisten. Diese Funktion werde auch dann erfüllt, wenn das Spenderteil nicht vollständig abnehmbar, sondern lediglich schwenkbar mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden sei. Es gehe aus der Beschreibung des Klagepatents nicht hervor und sei auch ansonsten technisch nicht nachvollziehbar, dass ein Spender in einer öffentlichen Toilettenkabine nicht in einem für das Nachfüllen erforderlichen Maß aufgeklappt werden könne. Die Fachperson erkenne, dass eine verschwenkbare Ausgestaltung gerade in beengten Räumen deutlich praktischer sei, weil das abgeklappte Spenderteil am hinteren Spenderabschnitt befestigt bleibe und daher weder festgehalten noch irgendwo abgelegt werden müsse. Auf diese Weise könne das Spendersystem mit einer Hand geöffnet werden und mit der anderen Hand könne Verbrauchsmaterial nachgefüllt werden. Aus diesem Grund würden etwa Toilettenpapierspendersysteme seit langem typischerweise so ausgestaltet, dass das Spenderteil zum Nachfüllen des Papiers lediglich aufgeklappt und nicht vollständig abgenommen werde. Die Urteile des BPatG und des BGH im Rechtsbestandsverfahren stünden einer weiten Auslegung des Begriffs „detachably joined“ nicht entgegen. Beide Gerichte hätten sich nicht abschließend mit der Frage beschäftigt, ob für eine „lösbare Verbindung“ im Sinne des Klagepatents zwingend eine vollständige Lösbarkeit erforderlich sei. Gegenstand beider Urteile sei vielmehr die konkrete Frage gewesen, ob die „lösbare Verbindung“ von Spenderteil und hinterem Spenderabschnitt in der entgegengehaltenen WO 2006/054XXX XX offenbart werde.
Bei richtiger Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 werde dieser von allen angegriffenen Ausführungsformen wortsinngemäß benutzt. Die jeweiligen Spenderteile könnten aufgeklappt und zumindest partiell vom hinteren Spenderabschnitt gelöst werden, um ein Nachfüllen zu ermöglichen. Im Übrigen sei auch eine „Abnehmbarkeit“ im engeren Sinne gegeben. Unter Zuhilfenahme von Werkzeug sei es ohne Beschädigung des Spendergehäuses möglich, den das Scharnier zusammenhaltenden Pin herauszuziehen und das Spenderteil vollständig abzunehmen.
Soweit die Klägerin in zweiter Instanz nunmehr auch ausdrücklich eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen 4 bis 16 geltend macht, ist sie der Auffassung, es handele sich hierbei um denselben Streitgegenstand wie in erster Instanz. Die neu eingeführten Ausführungsformen seien sämtlich kerngleich zu den bereits in erster Instanz eingeführten angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3. Weder unterscheide sich die Gehäusekonstruktion in patentrechtlich relevanter Weise, noch könne die unterschiedliche Farbgebung einen neuen Streitgegenstand begründen. Letztere sei insbesondere für die Frage der anspruchsgemäßen „Transparenz“ des ersten Komponententeils ohne Bedeutung.
Mit ihrer Anschlussberufung begehrt die Klägerin eine Verurteilung der Beklagten zur Auskunft und Rechnungslegung auch über das von der Beklagten vertriebene Verbrauchsmaterial. Sie ist der Auffassung, ein solcher Anspruch bestehe jedenfalls, soweit die Verbrauchsmaterialien an gewerbliche Abnehmer geliefert worden seien, die ein anspruchsgemäßes Spenderteil von der Beklagten erworben hätten. Der Rechnungslegungsanspruch diene der Ermittlung, Bezifferung und Durchsetzung des darauf aufbauenden Schadensersatzanspruchs. Grundsätzlich sei daher über Gewinne aus Zusatzgeschäften Auskunft zu erteilen. Eine Ausnahme sei nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nur dann vorzusehen, wenn zwar ein ursächlicher Zusammenhang der Zusatzgeschäfte mit der Veräußerung einer geschützten Vorrichtung bestehe, dieser Zusammenhang aber auf Umständen beruhe, die mit den technischen Eigenschaften der geschützten Erfindung nichts zu tun hätten. Dies sei etwa für Gewinne anzunehmen, die durch Reinvestition von erzielten Gewinnen aus einer Patentverletzung in anderen Bereichen erzielt habe oder die der Verletzer nur deshalb erlangt habe, weil er durch patentverletzende Vertriebshandlungen seinen Bekanntheitsgrad und damit den Vertrieb anderer Produkte steigern konnte. Derartiges sei im vorliegenden Fall im Hinblick auf die Geschäfte mit für die angegriffenen Papierspender bestimmten Papiermaterialien offensichtlich nicht anzunehmen.
Für die erforderliche Kausalität genüge es, dass durch den Verkauf der angegriffenen Ausführungsformen eine Nachfrage nach den Verbrauchsmaterialien geschaffen werde. Dies sei jedenfalls für Verbrauchsmaterialien anzunehmen, die speziell für den Gebrauch in den angegriffenen Ausführungsformen vorgesehen seien. Auf ihrer Webseite https://www.D.XXX biete die Beklagte – insoweit unstreitig – Papierutensilien und Seifen an, die zur Benutzung in den angegriffenen Ausführungsformen geeignet seien. Auf den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 6 sei zudem – auch insoweit unstreitig – der Hinweis aufgedruckt, den jeweiligen Papierspender ausschließlich mit den hierzu kompatiblen Papierutensilien der Beklagten zu benutzen. Die Beklagte bewerbe solche Utensilien explizit als kompatibel für den Gebrauch in den angegriffenen Ausführungsformen und stelle diese Kompatibilität durch spezifische Steck- und Haltemechanismen sicher. Insbesondere durch eine spezielle Ausgestaltung der Halterung („Plug“) in den angegriffenen Papierspendern werde sichergestellt, dass der jeweilige Spender nur mit dem passenden Papiermaterial der Beklagten befüllt werden könne. Die Beklagte nutze die angegriffenen Ausführungsformen solchermaßen als Einstieg in das Geschäft mit den Verbrauchsmaterialien. -
Die Beklagte beantragt,
die Anschlussberufung der Klägerin zurückzuweisen und die Klage auch insofern abzuweisen;
hilfsweise die nachfolgenden Geheimhaltungsmaßnahmen anzuordnen:
I. Die von den Anträgen B.II. 1 und 3 aus der Klageschrift vom 13.11.2017 und den Anträgen II. 1 und 2 aus der Anschlussberufung vom 02.03.2020 umfassten Auskünfte und Rechnungslegungen über die Vorrichtungen gemäß Antrag B.I.1 aus der Klageschrift vom 13.11.2017 und über Verbrauchsmaterialen zur Verwendung in Vorrichtungen gemäß Antrag B.I.1 inklusive der entsprechenden geforderten Belege werden als geheimhaltungsbedürftig eingestuft, somit die in den genannten Anträgen geforderten Auskünfte und Rechnungslegungen über
a) die Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
b) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, sowie die Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) die Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
d) die einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und
-preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Abnehmer,
e) die einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und
-preisen und die jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
f) die betriebene Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeit und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internetwerbung die Domain, die Zugriffszeiten und die Schaltungszeiträume,
g) die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinnen.
II. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig zur Folge hat, dass die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige Vertreter und alle sonstigen Personen, die an dem Verfahren beteiligt sind oder Zugang zu Dokumenten aus dem Verfahren haben, die als geheimhaltungsbedürftig eingestuften, in das Verfahren eingeführten Informationen vertraulich behandeln müssen und diese außerhalb etwaiger Vollstreckungsverfahren zu dem Verfahren Az.: 4a O 61/18, I-2 U 17/24, außerhalb der Bemessung einer eventuell dort festgelegten Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz und außerhalb eines sich gegebenenfalls anschließenden Betragsverfahrens nicht nutzen oder offenlegen dürfen, es sei denn, dass sie nachweislich von diesen außerhalb des hiesigen Verfahrens und eines möglichen Zwangsmittelverfahrens rechtmäßig Kenntnis erlangt haben und sich im Rahmen der gegebenenfalls mit dieser anderen Kenntniserlangung verbundenen Beschränkungen halten. Diese Verpflichtung besteht auch nach Abschluss des Verfahrens und eines etwaigen Zwangsmittelverfahrens fort. Dies gilt nicht, wenn und soweit das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses hinsichtlich der Informationen aus vorstehender Ziff. I durch rechtskräftiges Urteil verneint wird oder sobald die betroffenen Informationen für Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit solchen Informationen umgehen, bekannt wurden oder ohne weiteres zugänglich werden, ohne dass dies auf einem Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtungen beruht. Bei schuldhaften Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verpflichtungen kann das Gericht auf Antrag einer Partei ein Ordnungsgeld bis zu 100.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monate festsetzen und sofort vollstrecken.
III. Der Zugang zu den unter Ziff. I genannten Informationen, soweit sie im Verfahren vorgelegt werden, wird auf Seiten der Klägerin beschränkt auf
den E und den F;
die innerhalb des erteilten Mandats mitwirkenden anwaltlichen, patentanwaltlichen und sonstigen Vertreter der Klagepartei, inklusive Sekretariatsmitarbeiter, Rechtsreferendare, Patentanwaltskandidaten und Werkstudenten, soweit sie innerhalb des erteilten Mandats mitwirken und vergleichbar einem Rechtsanwalt verpflichtet sind, werden von dieser Beschränkung nicht erfasst. Für sie gelten die in Ziff. II klargestellten Rechtsfolgen der Einstufung als geheimhaltungsbedürftig gemäß § 16 I Geschäftsgeheimnisgesetz. -
Die Beklagte tritt der Klageerweiterung entgegen und macht geltend:
Soweit die Klägerin sich in zweiter Instanz nunmehr auch auf eine Verletzung des Klagepatents durch Angebot und Lieferung der angegriffenen Ausführungsformen 4 bis 16 berufe, handele es sich um eine unzulässige Klageänderung. Insofern liege ein neuer Streitgegenstand vor. Die Frage der Transparenz sei bei den schwarzen Spendern grundsätzlich anders zu beurteilen als bei den weißen Spendern, weil sie gegenüber letzteren eine höhere Lichtbrechung aufwiesen und das dahinter befindliche Verbrauchsmaterial kaum mehr wahrnehmbar sei. Die angegriffenen Ausführungsformen 9, 10, 13 und 14 hätten zudem eine gänzlich andere Gestaltung als die erstinstanzlich angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3. Die angegriffenen Ausführungsformen 13 und 14 dienten als Seifenspender auch einem anderen Zweck als die angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3.
Die erst in der Berufungsinstanz geltend gemachte Erstreckung der Auskunfts- und Rechnungspflicht auf den Vertrieb von Verbrauchsmaterialien stelle gleichfalls eine Klageänderung dar, die nicht sachdienlich und daher unzulässig sei. Insofern sei erstmals in zweiter Instanz Vortrag zu technischen Gegebenheiten der angegriffenen Ausführungsformen erfolgt, der begründen solle, dass die angegriffenen Ausführungsformen nur mit den von der Beklagten angebotenen Verbrauchsmaterialien betrieben werden könnten. Dies werde ausdrücklich bestritten. Die Käufer der Verbrauchsmaterialien würden mitnichten sämtlich über einen Dispenser aus dem Unternehmen der Beklagten verfügen. Umgekehrt verwende nicht jeder Abnehmer eines Dispensers aus dem Hause der Beklagten diesen mit den von ihr angebotenen Verbrauchsmaterialien. Die Spender der Beklagten seien auch mit Verbrauchsmaterialien von Wettbewerbern betreibbar. Gleiches gelte umgekehrt für die Verbrauchsmaterialien der Beklagten, die in Spendern von Wettbewerbern einsetzbar seien.
Eine Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht im Hinblick auf Verbrauchsmaterialien scheitere ohnehin schon an der erforderlichen Kausalität der mit den Verbrauchsmaterialien erzielten Gewinne zu dem Verkauf der angegriffenen Ausführungsformen. Diese sei nur anzunehmen, wenn keine weiteren Ursachen neben dem Verkauf der patentverletzenden Vorrichtungen die Kaufentscheidung des Kunden beeinflusst hätten. Die Erfindung des Klagepatents betreffe ausschließlich die Abdeckung und habe keinerlei Bezug zu den einzulegenden Verbrauchsmaterialien.
Ihr französisches Tochterunternehmen liefere im Übrigen nur an Handelsunternehmen, die die streitgegenständlichen Spender selbst nicht verwenden würden. Die Endkunden hingegen würden zunächst die Verbrauchsmaterialien erwerben und erst im Anschluss hieran die passenden Dispenser. Sie – die Beklagte – sei einer der EU-weit führenden Papierhersteller und seit Jahrzehnten in diesem Marktsegment tätig. Keineswegs präsentiere sie ihre Papiermaterialien und die Dispenser als „zwingende Einheit“. Vielmehr rücke sie mit ihrer Werbung insbesondere ihre Papierprodukte in das Bewusstsein der angesprochenen Kunden. Der Verkauf der Papiermaterialien stehe in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der angeblichen Patentverletzung, da sie mit den Eigenschaften der geschützten Erfindung nichts zu tun hätten. Der Verkauf der Dispenser folge vielmehr dem Verkauf der Verbrauchsmaterialien nach. In einem solchen Fall komme weder ein Schadensersatzanspruch noch ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung über die Verbrauchsmaterialien in Betracht.
Im Übrigen sei die Formulierung der Anträge der Klägerin auf Auskunft und Rechnungslegung über Verbrauchsmaterialien unbestimmt. Es sei nicht erkennbar, ob der Antrag nur solche Verbrauchsmaterialien umfassen solle, die an Kunden geliefert worden seien, die bereits über eine angegriffene Ausführungsform verfügen, oder ob sich der Antrag grundsätzlich auf alle Verbrauchsmaterialien erstrecke, die für die Verwendung in einer der angegriffenen Ausführungsformen geeignet seien.
Sollte der Klägerin ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zuerkannt werden, so müsse ihr – der Beklagten – Geheimnisschutz gewährt werden. Denn es müssten Geschäftsinterna offenbart werde, die nicht jedermann bekannt seien und einen erheblichen wirtschaftlichen Wert hätten. -
Die Klägerin beantragt,
den Antrag der Beklagten auf Geheimnisschutz zurückzuweisen,
hilfsweise
den von der Beklagten im Schriftsatz vom 09.09.2024 hilfsweise geltend gemachten Antrag zu III. dahingehend zu erweitern, dass zusätzlich zu den dort genannten Personen den folgenden Mitarbeitern der Klägerin Zugang zu den unter Hilfsantrag I. genannten Informationen gewährt wird: G, H. - Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen. Die Akte des Parallelverfahrens XXX (LG Düsseldorf 4a O XXX/XX) einschließlich der in diesem Verfahren zur Akte gereichten Muster der angegriffenen Ausführungsformen lag vor. Der Senat hat in der mündlichen Verhandlung vom 08.10.2024 die angegriffenen Ausführungsformen in Augenschein genommen; hinsichtlich des Ergebnisses wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen (Bl. 1507-15017 GA).
-
B.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Der Klägerin stehen daher – wie das Landgericht zu Recht erkannt hat – gegen die Beklagte die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Rückruf der angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Schadenersatzpflicht aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu, wobei infolge der zulässigen Anschlussberufung der Klägerin auch ein Anspruch auf Rechnungslegung in Bezug auf Verbrauchsmaterialien zuzuerkennen ist. Infolge der Antragsanpassung nach der Entscheidung des BGH im Nichtigkeitsverfahren und aufgrund des Erfolgs der Anschlussberufung hat der Senat den Tenor des landgerichtlichen Urteils zur besseren Übersichtlichkeit und Klarstellung insgesamt neu gefasst.I.
Entgegen der Auffassung der Beklagten hat die Klägerin mit ihrer Patentverletzungsklage nicht allein die von der Beklagten angebotenen Papierspender mit den Produkt-Nr. XXX302, XXX300 und XXX314 angegriffen. -
1.
Über welchen Lebenssachverhalt das Gericht nach dem Klagebegehren zu entscheiden hat, kann nicht ohne Berücksichtigung der rechtlichen Grundlage entschieden werden, auf die der Kläger seine Klageanträge stützt. Denn diese rechtliche Grundlage bestimmt, welche Einzelheiten eines (behaupteten) tatsächlichen Geschehens in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht für die gerichtliche Erkenntnis (zumindest potenziell) von Bedeutung sind. Bei einer Patentverletzungsklage sind demgemäß für die Eingrenzung des Streitgegenstands, der der gerichtlichen Entscheidungsfindung unterworfen wird, vornehmlich diejenigen tatsächlichen Elemente von Bedeutung, aus denen sich Handlungen des Beklagten ergeben sollen, die einen der Tatbestände des § 9 PatG ausfüllen. Zur sachlichen Eingrenzung dieser vom Klagebegehren umfassten Handlungen kommt es wiederum typischerweise in erster Linie darauf an, aus welcher tatsächlichen Ausgestaltung eines angegriffenen Erzeugnisses sich nach dem Klagevortrag ergeben soll, dass das Erzeugnis unter den mit der Klage geltend gemachten Patentanspruch subsumiert werden kann. Der Streitgegenstand der Patentverletzungsklage wird insoweit regelmäßig im Wesentlichen durch die üblicherweise als angegriffene Ausführungsform bezeichnete tatsächliche Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs bestimmt (BGH, GRUR 2012, 485 Rn. 18 – Rohrreinigungsdüse II; GRUR 2021, 1167 Rn. 44 – Ultraschallwandler; Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 52 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; Urt. v. 08.08.2024 – I-2 U 33/21).
Ist eine weitere, erst in zweiter Instanz in den Rechtsstreit eingeführte Ausführungsform in patentgemäßer Hinsicht kerngleich mit der von Beginn an diskutierten Ausführungsform, betrifft sie denselben Streitgegenstand, so dass sich die Klage und der Urteilsausspruch von vornherein auf sie bezogen haben. Maßgeblich für die Beurteilung der Kerngleichheit ist dabei der Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, weswegen alle diejenigen neuen Ausführungsvarianten im Berufungsverfahren mit zu behandeln sind, die anhand der Entscheidungserwägungen der Vorinstanz als Patentverletzung ausgewiesen sind. Denn allein die erstinstanzliche Entscheidung ist Grundlage für die Entscheidung des (erstinstanzlich obsiegenden) Klägers, ob er Anschlussberufung einlegt oder nicht. Eine solche ist nur zulässig, wenn das Begehren auf ein Mehr gegenüber dem erstinstanzlichen Urteil gerichtet ist. Mit der Anschlussberufung kann insbesondere nicht derselbe Antrag wiederholt werden, dem das erstinstanzliche Urteil stattgegeben hat (BGH, NJW 1991, 3029 – Anzeigenrubrik I; Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 53 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; Urt. v. 08.08.2024 – I-2 U 33/21).
Hieraus folgt unmittelbar, dass eine nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Anspruchs für die Bestimmung des Streitgegenstandes außer Betracht zu bleiben hat. Entscheidend ist vielmehr (allein) der die maßgebliche Fassung des Klagepatentanspruchs wiedergebende landgerichtliche Tenor; an ihm ist zu prüfen, ob verschiedene angegriffene Ausführungsformen im Kern gleichartig sind (vgl. Senat, Urt. v. 19.12.2019 – I-2 U 62/16, GRUR-RS 2019, 38883 Rn. 44 – Befestigungszwischenstück; Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 54 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid).
Ob die Verletzungsgegenstände kerngleich sind, beurteilt sich neben dem Klagebegehren insbesondere nach den patentrechtlichen Fragestellungen, denen sich das entscheidende Gericht in seinem Urteil gewidmet hat. Werfen andere Verletzungsgegenstände, die in den Entscheidungsgründen nicht ausdrücklich genannt sind, im Hinblick auf den im landgerichtlichen Tenor wiedergegebenen Wortlaut des Patentanspruchs andere patentrechtliche Fragen auf als diejenigen, mit denen sich das erstinstanzliche Gericht in seinen Entscheidungsgründen befasst hat, so ist eine Kerngleichheit zu verneinen. Stellen sich hingegen für die weiteren angegriffenen Verletzungsformen dieselben patentrechtlichen Fragestellungen, die das Landgericht in seiner Entscheidung diskutiert hat, so dass insbesondere über etwaige Einwendungen des Beklagten in dem erstinstanzlichen Urteil bereits mit entschieden wurde, und kommt in den weiteren Verletzungsformen ungeachtet etwaiger Abweichungen im Einzelnen erkennbar das Charakteristische der ursprünglichen Ausführungsform zum Ausdruck, so ist Kerngleichheit gegeben (Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 55 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; Urt. v. 08.08.2024 – I-2 U 33/21). -
2.
Ausgehend von diesen Grundsätzen sind die angegriffenen Ausführungsformen 4 bis 16 vom Streitgegenstand des Verfahrens erster Instanz umfasst gewesen.
Mit ihrer auf den erteilten Patentanspruch 1 des Klagepatents gestützten Klage hat sich die Klägerin gegen sämtliche Spender aus dem Hause der Beklagten gewandt, in welchen (aus ihrer Sicht) klagepatentgemäße Spenderteile mit einem ersten und einem zweiten Komponententeil vorgesehen sind (Klageschrift vom 19.09.2017, S. 40 Rn. 89, Bl. 64 GA). Dabei hat sie sich in der Klageschrift beispielhaft auf die Papierspender mit den Produkt-Nr. XXX302, XXX300 und XXX314 bezogen. Zur Veranschaulichung hat sie Muster als Anlagen K7.1 bis K7.2 zur (Parallel-) Akte gereicht. Auf die Farbgebung und äußere Form des Gehäuses hat sie dabei nicht abgestellt; erkennbar ist sie der Auffassung gewesen, dass diese für die Beschreibung der angegriffenen Ausführungsformen mit den Merkmalen des Patentanspruchs ohne Bedeutung seien. Streitgegenstand ist damit die im Klageantrag mit den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 beschriebene angegriffene Ausführungsform, die jedenfalls in der Farbgebung weiß mit den Produkt-Nr. XXX302, XXX300 und XXX314 von der Beklagten in Deutschland angeboten und vertrieben wird.
Anderes ergibt sich auch nicht aus der angegriffenen Entscheidung. Zwar hat das Landgericht allein auf die Spender mit den Produkt-Nr. XXX302, XXX300 und XXX314 und die hierzu vorgelegten Muster Bezug genommen, diese unterscheiden sich hinsichtlich der Merkmale des ursprünglich geltend gemachten erteilten Patentanspruchs 1 hingegen nicht wesentlich von den angegriffenen Ausführungsformen 4a bis 16. Entsprechende Unterschiede, die im Hinblick auf die Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 von Relevanz wären, legt die Beklagte auch nicht dar. Soweit sie auf unterschiedliche Gehäuseformen abstellt, trägt sie nicht im Einzelnen vor, welche Merkmale des Patentanspruchs hiervon betroffen sein sollen. Sie beruft sich vielmehr vordringlich auf die unterschiedliche Farbgebung der Spender. Die Farbgebung spielt für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre aber ebenso wenig eine Rolle wie die Art der Verwendung des Spenders. Letztere wird im Anspruch nicht einmal erwähnt. Die Farbgebung kann sich zwar grundsätzlich auf die Lichtdurchlässigkeit eines Kunststoffteils auswirken, für die Frage der „Transparenz“ nach der erfindungsgemäßen Lehre spielt sie allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Insofern weist Abs. [0083] der Klagepatentschrift ausdrücklich darauf hin, dass ein Kunststoffteil zugleich farbig und transparent im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre sein kann:
„… Darüber hinaus sind Kombinationen aus einem oder mehreren farbigen und/oder transparenten Materialien verwendbar. …“
Entscheidend für die Frage der erfindungsgemäßen „Transparenz“ des ersten Komponententeils ist nicht die Farbwahl als solche, sondern der Grad der Lichtdurchlässigkeit des verwendeten Kunststoffmaterials. Diese kann bei geringerer (Farb-) Pigmentierung bei dunklen Farben auch höher sein als bei weißen Materialien. Im Rahmen der in der mündlichen Verhandlung vom 08.10.2024 durchgeführten Inaugenscheinnahme der angegriffenen Ausführungsformen vermochte sich der Senat davon zu überzeugen, dass die Lichtdurchlässigkeit der verwendeten Materialien für das erste Komponententeil bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht in erfindungswesentlicher Weise voneinander abweicht (s.u.).
Wollte man – entgegen den vorstehenden Ausführungen – eine Kerngleichheit im Hinblick auf die Ausführungsformen mit schwarzer Farbgebung verneinen, so hätte die Klägerin ihre Klage jedenfalls in zulässiger Weise im Rahmen ihrer form- und fristgerecht eingelegten Anschlussberufung (s.u.) um diese Ausführungsformen erweitert. In späteren Schriftsätzen ergänzend benannte weitere Ausführungsformen in schwarzer Farbgebung wären dann sämtlich vom Streitgegenstand der mit der Anschlussberufung geltend gemachten Klageerweiterung umfasst. Zur weiteren Begründung wird insoweit auf die Ausführungen unter II.4. verwiesen. -
II.
Mit ihrer Berufungserwiderung vom 02.03.2020 macht die Klägerin – wie vorstehend erwähnt – in der Berufungsinstanz erstmals im Wege der Anschlussberufung auch einen Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung für Verbrauchsmaterialien geltend. Diese Anschlussberufung ist – wie bereits an dieser Stelle ausgeführt werden soll – zulässig, insbesondere ist sie innerhalb der Anschlussberufungsfrist des § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO erfolgt. In der Erweiterung der Klage liegt zwar eine Klageänderung i.S.d. § 263 ZPO, diese ist aber gemäß § 533 ZPO zulässig, weil sie sachdienlich ist und auf Tatsachen gestützt wird, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 zugrunde zu legen hat. -
1.
Die Sachdienlichkeit einer Klageänderung richtet sich auch in der Berufungsinstanz im Grundsatz nach den zu § 263 ZPO geltenden Regeln. Danach hängt die Sachdienlichkeit der Klageänderung davon ab, ob eine Entscheidung auch über die geänderte Klage im selben Verfahren objektiv prozesswirtschaftlich ist, weil sie den Streitstoff des anhängigen Verfahrens zumindest teilweise ausräumt und einem anderenfalls zu gewärtigenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, NJW 2000, 800, 803 mwN; Senat, InstGE 10, 248 – Occluder). Allein die Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits kann allerdings nicht das entscheidende Kriterium für die Sachdienlichkeit einer Klageänderung sein, denn dann müsste die Änderung praktisch immer zugelassen werden, weil der Kläger mit seiner Erweiterung schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben hat und deshalb in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er ein weiteres Verfahren einleiten wird, wenn im anhängigen Prozess die Klageerweiterung nicht zugelassen wird. Die zweite wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist, dass für die Beurteilung der geänderten Anträge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann; zu verneinen ist sie, wenn ein völlig neuer Streitstoff eingeführt würde, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertbar ist (Senat, InstGE 10, 248 – Occluder, mwN; InstGE 11, 167 – Apotheken-Kommissioniersystem; Urt. v. 22.02.2018 – 2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 65; Urt. v. 30.09.2021 – 2 U 14/21, GRUR-RS 2021, 30146 Rn. 19 – Klageerweiterung; Urt. v. 24.06.2021 – I-2 U 116/05, GRUR-RS 2021, 17019 Rn. 47 – Faserstoffbahn, mwN). Im Hinblick auf § 533 ZPO gilt das besonders für Klageänderungen in der Berufungsinstanz, insbesondere wenn die Klageänderung darin besteht, dass erstmals gänzlich neue Ansprüche erhoben werden, mit deren Berechtigung das Landgericht nicht befasst worden ist. Aufgabe des Berufungsgerichtes ist die Überprüfung landgerichtlicher Entscheidungen und nicht die erstinstanzliche Prüfung neu gestellter Ansprüche an Stelle des hierfür nach dem Gesetz zuständigen Landgerichtes. -
2.
Nach diesen Grundsätzen sind hier die Voraussetzungen für eine Zulassung der Klageänderung zu bejahen. Denn mit der Einbeziehung der Verbrauchsmaterialien in den bereits in erster Instanz geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch werden die bestehenden Streitpunkte zwischen den Parteien im Hinblick auf eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen insgesamt erledigt und so ein möglicher weiterer Prozess vermieden. Mit dem auf die Verbrauchsmaterialien gerichteten Antrag auf Auskunft und Rechnungslegung wird nicht ein „gänzlich neuer“ Anspruch erhoben, auch wenn ein hierauf bezogener Anspruch von der Klägerin in erster Instanz noch nicht (gesondert) geltend gemacht worden ist. Der bislang geltend gemachte Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist bereits darauf gerichtet gewesen, die Höhe des Schadens zu ermitteln, der der Klägerin durch die schuldhafte Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre durch die Beklagte entstanden ist und noch entstehen wird. Dass dabei zunächst nur derjenige Umsatz (und Gewinn) im Fokus stand, den die Beklagte im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs durch den Vertrieb der patentverletzenden Spender als solche erzielt hat, steht einer Einbeziehung auch der Verbrauchsmaterialien in den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch nicht entgegen. Auch wenn ein hierauf bezogener Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch in erster Instanz noch nicht verfolgt worden ist, war Gegenstand des erstinstanzlichen Rechtsstreites die Verletzung des Klagepatentanspruchs 1 durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Spender. Damit in engem Zusammenhang steht der Vertrieb der für diese Spender bestimmten Verbrauchsmaterialien. Der dadurch erzielte Umsatz ist „lediglich“ für den möglichen Umfang der Schadensersatzpflicht der Beklagten bedeutsam, die von der Klägerin schon in erster Instanz geltend gemacht und von dem Landgericht in dem angegriffenen Urteil festgestellt worden ist. -
3.
Der Zulässigkeit der Klageänderung steht auch § 533 Nr. 2 ZPO nicht entgegen, der voraussetzt, dass die Klageänderung auf Tatsachen gestützt werden kann, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat.
Das Landgericht hat sich im Rahmen der Erörterung der geltend gemachten Ansprüche mit der konstruktiven Ausgestaltung der angegriffenen Spender auseinandergesetzt, um eine Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre festzustellen. Die angegriffenen Ausführungsformen sind unstreitig zur Aufnahme von Verbrauchsmaterial bestimmt und ebenso unstreitig bietet die Beklagte Verbrauchsmaterial an, das zur Verwendung in den angegriffenen Spendern geeignet ist. Unstreitiges Vorbringen hat der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung stets zugrunde zu legen. Aus dem bereits erstinstanzlich als Anlage K15 vorgelegten Produktkatalog der Beklagten ergibt sich zudem, dass die Beklagte bestimmte Verbrauchsmaterialien explizit als „kompatibel“ mit den angegriffenen Spendern anbietet. Dies ist auch den Verpackungen der angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3 zu entnehmen, die dem Landgericht als Anlagen K7.1 bis K7.3 im Parallelverfahren 4a O XXX/XX (betreffend das EP 2 313 XXX XX; hiesiges Az. XXX) vorlagen. Auf diese Muster hat die Klägerin bereits in erster Instanz ausdrücklich Bezug genommen und die landgerichtliche Akte des Parallelverfahrens war beigezogen. Insofern kann die Klageänderung vorliegend auf Tatsachen gestützt werden, die der Senat seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. -
4.
Sofern man eine Kerngleichheit im Hinblick auf die Ausführungsformen mit schwarzer Farbgebung verneinen würde, hätte die Klägerin ihre Klage jedenfalls in zulässiger Weise im Rahmen ihrer form- und fristgerecht eingelegten Anschlussberufung um diese Ausführungsformen erweitert.
Die angegriffenen Ausführungsformen 4a, 5a und 6a hat die Klägerin – zusammen mit den Ausführungsformen 9a, 10a, 13, 15 und 16 – innerhalb der Anschlussberufungsfrist in das Berufungsverfahren eingeführt. Eine hierin liegende Anschlussberufung ist, sofern eine solche erforderlich sein sollte, ebenfalls zulässig.
Die Anschlussberufung ist auch insoweit form- und fristgerecht eingelegt worden, § 524 ZPO. Die in § 533 Nr. 1 und 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Klageerweiterung im Berufungsrechtszug liegen gleichfalls vor.
Die (unterstellte) Klageerweiterung ist sachdienlich. Die vorgenannten weiteren angegriffenen Ausführungsformen unterscheiden sich von den angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 3 im Wesentlichen lediglich insoweit, als bei ihnen das Gehäuse – und damit insbesondere auch das erste Komponententeil – schwarz eingefärbt ist. Im Übrigen sind die Ausführungsformen hinsichtlich ihrer für die patentrechtliche Beurteilung bedeutsamen Ausgestaltung identisch. Was die übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 anbelangt, ergeben sich damit für die patentrechtliche Beurteilung keine Unterschiede. Etwas anderes gilt allenfalls für das Merkmal 2.3 (transparente Ausgestaltung). Bei der Beurteilung der Unterschiede zwischen beiden Ausführungsformen geht es jedoch im Wesentlichen darum, aus der Ermittlung des Sinngehalts des in Rede stehenden Anspruchsmerkmals, mit dem sich bereits das Landgericht befasst hat, im Hinblick auf die weiteren Ausführungsformen die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Hierbei kann auf die bisherigen Ergebnisse zurückgegriffen werden; diese können hier den Ausgangspunkt für die Frage bilden, ob die weiteren angegriffenen Ausführungsformen der Lehre des Klagepatents entsprechen.
Zwar dürften die weiteren Ausführungsformen der Klägerin nicht unbekannt gewesen sein; diese hätten ihr jedenfalls bekannt sein müssen. Diesem Gesichtspunkt kann hier jedoch keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Die Klägerin hat bereits in der Klageschrift zu erkennen gegeben, dass sie sich gegen sämtliche Spender aus dem Hause der Beklagten der Produktreihe „B“ wendet, in welchen (aus ihrer Sicht) klagepatentgemäße Spenderteile mit einem ersten und einem zweiten Komponententeil vorgesehen sind. Dabei hat sie sich nur beispielhaft auf die angegriffenen Ausführungsformen 1, 2 und 3 bezogen. Insoweit hätte bereits das Landgericht auf eine Klarstellung hinwirken müssen, welche weiteren Produkte die Klägerin konkret angreift. Darüber hinaus weisen die weiteren angegriffenen Ausführungsformen nur so geringfügige Unterschiede gegenüber den bislang angegriffenen Ausführungsformen auf, dass eine einheitliche Befassung mit allen Ausführungsformen zweckmäßig erscheint.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass auch die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO erfüllt sind. Es ist unstreitig, dass die Beklagte auch die weiteren angegriffenen Ausführungsformen auf ihrer Internetseite bewirbt und diese selbst – allerdings im Ausland – herstellt. Unstreitig ist ferner, dass auch die neuen angegriffenen Ausführungsformen in Deutschland vertrieben werden. Ebenso ist die Ausgestaltung der weiteren Ausführungsformen zwischen den Parteien nicht streitig.
Soweit die Klägerin nach Einreichung der Anschlussberufung noch weitere Ausführungsformen mit schwarzer Farbgebung in das Berufungsverfahren eingeführt hat, sind diese von dem Streitgegenstand der mit der Anschlussberufung geltend gemachten (hier unterstellten) Klageerweiterung umfasst. -
III.
Zu Recht hat das Landgericht im Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatentanspruchs 1 gesehen und die Beklagte gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zum Rückruf verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz dem Grunde nach festgestellt. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von allen Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 wortsinngemäß Gebrauch. Dies gilt auch für die im Nichtigkeitsverfahren neu hinzugetretenen Merkmale des Klagepatentanspruchs 1, deren Verwirklichung zwischen den Parteien nicht im Streit steht. -
1.
Das Klagepatent betrifft Spender, die in Restaurants, Toiletten oder ähnlichem für Rollen oder Stapel aus Papier oder für Substanzen wie Seife oder flüssige Handcreme vorgesehen sind (Anlage KB1a Abs. [0007]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift gemäß Anlage KB1a).
Nach den einleitenden Ausführungen der Klagepatentschrift kann es aus unterschiedlichen Gründen wünschenswert sein, ein Spenderteil vorzusehen, bei dem zumindest die Außenfläche, die Schale oder ein vergleichbarer Teil aus zwei ähnlichen oder unterschiedlichen Kunststoffen gefertigt sind. So kann es etwa vorteilhaft sein, einen Teil der Frontfläche transparent zu gestalten, um die Überprüfung des Füllstandes ohne das Öffnen des Gehäuses zu ermöglichen. Zugleich kann es gewünscht sein, den Ausgabemechanismus, z.B. aus ästhetischen Gründen, zu verbergen und die Frontfläche deshalb in diesem Bereich opak auszugestalten (Abs. [0002]).
Bei der Herstellung eines solchen, zwei Komponenten umfassenden Spenderteils wird die erste Komponente in der Regel in einer ersten Form spritzgegossen und in eine zweite Form überführt, in der sodann die zweite Komponente gegossen wird. Hierbei kann es zu einem Verzug mindestens der ersten Komponente und der Fuge kommen, insbesondere in oder nahe den Bereichen der Seitenkanten. Werden die Komponenten sodann miteinander verbunden, kann es der Verbindungsnaht – selbst mit lokalen Verstärkungen – an ausreichender Stabilität fehlen, um den zu erwartenden Kräften – beispielsweise durch einen Stoß – standzuhalten. Eine schwache Naht kann dazu führen, dass das Spenderteil entlang mindestens eines Teils der vorderen Fläche reißt, was einen Austausch des Spenderteils erforderlich macht (Abs. [0003]).
In der weiteren Beschreibung (Abs. [0060]) geht das Klagepatent auf eine Naht aus dem Stand der Technik ein und illustriert diese anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3: -
Die Klagepatentschrift nimmt auf verschiedene aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren zum Herstellen von spritzgegossenen Produkten Bezug. So ist etwa aus der WO 98/02361 (vorgelegt als Anlage BB 3) bekannt, das Material der zweiten Komponente über den die erste Komponente bildenden Vorformling zu spritzen und die Materialien entlang einer kontinuierlichen, kreisförmigen Fuge zu verbinden. Die JP 03-120022 (vorgelegt als Anlage BB 5) offenbart ein Verfahren, bei dem die zwei Komponenten in einer Form platziert und sodann durch Spritzgießen eines zusätzlichen Materials in einen Spalt zwischen den Komponenten verbunden werden (Abs. [0004]).
Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Spenderteil bereitzustellen, das geeignet ist, die dargestellten Probleme hinsichtlich eines Verzugs des Spenderteils und der Festigkeit der Naht zu lösen (Abs. [0005]).
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung des Urteils des BGH vom 14.03.2023 ein Spenderteil mit folgenden Merkmalen vor: -
1. Das Spenderteil (20) weist mindestens ein erstes und ein zweites spritzgegossenes Kunststoffkomponententeil (17, 18) auf.
2. Die beiden Komponententeile (17, 18)
2.1 weisen jeweils auf:
2.1.1 eine Verbindungsfläche entlang einer Kante,
2.1.2 eine vordere Fläche,
2.1.3 eine erste und eine zweite Seitenfläche, die jeweils eine von der vorderen Fläche abgewandte freie Seitenkante aufweisen;
2.2 sind durch eine Naht (21) verbunden [1.1.1],
2.2.1 die durch die erste Verbindungsfläche und die zweite Verbindungsfläche während des Spritzgießens zum Verbinden des ersten Komponententeils (17) und des zweiten Komponententeils (18) ausgebildet ist, um das Spenderteil (20) zu definieren;
2.2.2 die sich von der abgewandten freien Seitenkante (22), die zu der ersten Seitenfläche gehört, über zumindest einen Teil einer vorderen Fläche des Spenderteils zu der abgewandten freien Seitenkante (23) erstreckt, die zu der zweiten Seitenfläche gehört;
2.2.3 wobei ein querverlaufender Querschnitt der Naht mindestens eine Stufe und mindestens eine Kontaktfläche zwischen einer äußeren und inneren Fläche des Spenderteils aufweist und die erste Stufe an die äußere Fläche des Spenderteils angrenzt;
2.2.4 und im Bereich der Naht eine führende Kante des zweiten Komponententeils derart angeordnet ist, dass sie das erste Komponententeil zum Verdecken der Naht überlappt.
2.3 Das erste Komponententeil (17) ist transparent und das zweite Komponententeil (18) undurchsichtig.
2.4 Das erste Komponententeil (17) ist ein MABS-Kunststoffteil und das zweite Komponententeil (18) ein ABS-Kunststoffteil.
3. Das Spenderteil ist abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt (96) verbunden, um ein Spendergehäuse auszubilden.
4. Der hintere Spenderabschnitt (96) ist eingerichtet, an einer vertikalen Wand montiert zu sein. -
Die vorstehend wiedergegebene Merkmalsgliederung entspricht im Wesentlichen der Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in seinem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsberufungsurteil. Die Gliederung beinhaltet aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich Bezugszeichen von jeweils einem entsprechenden Ausführungsbeispiel. Der – im vorliegenden Rechtsstreit keine entscheidende Rolle spielende – Begriff „seam“ (Merkmal 2.2) wird in der Merkmalsgliederung entsprechend der in der Klagepatentschrift wiedergegebenen deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 mit „Naht“ übersetzt. Er kann aber auch – wie im Parallelverfahren – mit „Fuge“ übersetzt werden.
Die beiden Komponententeile des Spenderteils weisen jeweils eine Verbindungsfläche auf (Merkmal 2.1.1), wobei diese beiden Verbindungsflächen patentgemäß während des Spritzgießens zusammengefügt werden, um eine erfindungsgemäße Naht zu bilden (Merkmal 2.2.). Auf diese Weise sollen die beiden Komponententeile ausreichend fest verbunden werden, um das Beschädigungsrisiko, beispielsweise im Falle eines Stoßes gegen den Spender, zu verringern.
Zum besseren Verständnis wird nachfolgend Figur 4d der Klagepatentschrift wiedergegeben, die ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Naht (43d) zeigt: -
2.
Dies vorausgeschickt, bedürfen im Hinblick auf den Streit der Parteien die Merkmale 2.3 und 3. der vorstehenden Merkmalsgliederung näherer Erläuterung. -
a)
Gemäß Merkmal 3 ist das Spenderteil abnehmbar (lösbar) mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden, um das Spendergehäuse auszubilden.
Der angesprochene Fachmann – als solcher kann im Anschluss an die von den Parteien hingenommene Definition des Bundespatentgerichts (Anlage BB43, S. 16) ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Kunststofftechnik mit Fachhochschul- oder entsprechendem Abschluss, der mehrere Jahre Berufserfahrung in der Produktentwicklung von Aufnahmebehältern aufweist, angesehen werden – erkennt, dass dieses Merkmal nicht nur Ausgestaltungen erfasst, bei denen das Spenderteil vollständig von dem hinteren Spenderabschnitt entfernt werden kann, sondern auch solche, bei denen die Verbindung zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt zumindest soweit gelöst werden kann, dass ein (Nach-) Befüllen des Spenders ermöglicht wird. -
aa)
In der gem. Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen Verfahrenssprache lautet Merkmal 3 wie folgt: “..the dispenser part is detachably joined to a rear dispenser section, in order to form the dispenser housing“.
Das Spenderteil ist hiernach mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden („joined“), um das Spenderhäuse auszubilden. Das Spendergehäuse besteht neben dem Spenderteil aus dem hinteren Spenderabschnitt, der gemäß Merkmal 4 so ausgestaltet ist, dass er an einer vertikalen Wand montiert werden kann. Die Verbindung zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt wird im Patentanspruch als „detachably” beschrieben. In der in der Klagepatentschrift wiedergegeben deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 ist die englische Formulierung „detachably joined“ mit „abnehmbar verbunden“ ins Deutsche übersetzt. Die Wortkombination „detachably joined“ lässt sich allerdings auch mit „lösbar verbunden“ ins Deutsche übersetzen. Dementsprechend wird die englische Wendung „detachably joined“ in der von der Klägerin als Anlage K 1a vorgelegten deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift im Beschreibungsteil auch mit „lösbar verbunden“ übersetzt. Welche Übersetzung im vorliegenden Fall die passende bzw. exakteste ist, bedarf keiner abschließenden Klärung. Denn es ist nicht erkennbar, dass sich aus der einen oder anderen Übersetzung ein anderer sachlicher Gehalt des Merkmals 3 ergibt. Nachfolgend werden deshalb die Begriffe bzw. Formulierungen „abnehmbar verbunden“ und „lösbar verbunden“ synonym verwendet.
Der in Rede stehende Begriff „detachably” bzw. „detachably joined“ wird in der Patentschrift nicht ausdrücklich definiert. In den Absätzen [0077], [0078] und [0079] der besonderen Patentbeschreibung heißt es jeweils nur, dass das Spenderteil „abnehmbar“ bzw. „lösbar“ („detachably“) mit einem hinteren Spenderabschnitt (96) verbunden ist, um ein Spendergehäuse zu bilden. Dort wird damit nur der Wortlaut des Merkmals 3 wiederholt.
Nach dem allgemeinen Sprachverständnis deutet der Begriff „abnehmbar“ darauf hin, dass das Spenderteil von dem hinteren Spenderabschnitt „abgenommen“ werden kann, was auf den ersten Blick nahelegen könnte, dass das Spenderteil von dem hinteren Spenderabschnitt entfernt bzw. abgetrennt werden kann. Eindeutig ergibt sich dies indes aus dem Anspruchswortlaut nicht. Denn dieser trifft keine Aussage dazu, ob die „Abnahme“ auch voraussetzt, dass das Spenderteil von dem hinteren Spenderabschnitt vollständig „abgenommen“ werden kann. -
bb)
Darüber hinaus bleibt der Fachmann an diesem Punkt nicht stehen. Selbst dann, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder dem Fachverständnis eindeutig zu sein scheint, ist stets eine Auslegung des Patentanspruchs geboten, in der es den technischen Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln gilt.
Maßgeblich für den Wortsinn eines Anspruchs ist nämlich der technische Sinn der verwendeten Begriffe, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2016, 169 Rn. 16 – Luftkappensystem; GRUR 2009, 655 – Trägerplatte; GRUR 2020, 159 Rn. 18 – Lenkergetriebe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung, mwN). Bei der Auslegung eines patentgemäßen Begriffs kommt es deshalb nicht auf das allgemeine Sprachverständnis an (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.12.2019 – I-15 U 97/16, GRUR-RS 2019, 54492 Rn. 39 – Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen; Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz). Es stellt vielmehr einen festen Grundsatz der Patentauslegung dar, dass jede Patentschrift ihr eigenes Lexikon für die in ihr gebrauchten Begrifflichkeiten darstellt und deswegen nur unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen Aufschluss darüber gewonnen werden kann, was der Anspruch mit einer bestimmten Formulierung meint. Das Auslegungsgebot gilt dabei generell und somit auch für Begriffe, die von der Formulierung her scheinbar eindeutig sind (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente, mwN; GRUR 2021, 942 Rn. 21 – Anhängerkupplung II). In Anbetracht der lexikalischen Bedeutung jeder Patentschrift verbietet es sich, die Merkmale eines Patentanspruchs anhand der Definition in Fachbüchern oder nach dem allgemeinen Sprachverständnis auszulegen; vielmehr müssen sie aus der Patentschrift selbst heraus verstanden werden (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2005, 754 – werkstoffeinstückig; GRUR 2015, 868 Rn. 26 – Polymerschaum II; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2015, 1095 Rn. 13 – Bitdatenreduktion; GRUR 2016, 1031 Rn. 13 – Wärmetauscher; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung; Urt. v. 16.05.2024 – 2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 73 – Rotorelemente). Handelt es sich bei dem in Rede stehenden Begriff um einen Begriff oder Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, darf deshalb nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen oder üblichen fachlichen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Es ist vielmehr stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden) Sinne verwendet (Senat, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz, mwN). Ein eigenes Begriffsverständnis kommt hierbei nicht nur dann in Betracht, wenn der Beschreibungstext (z.B. durch eine Legaldefinition) explizit deutlich macht, dass ein bestimmter Begriff des Patentanspruchs in einem ganz bestimmten, sich vom Üblichen unterscheidenden Sinne verstanden wird, sondern auch dann, wenn sich ein solches Verständnis aus der grundsätzlich gebotenen funktionsorientierten Auslegung ergibt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.10.2011 – I-2 U 3/11, GRUR-RS 2011, 26945 Rn. 16 – Wärmedämmelement; Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14, GRUR-RS 2016, 03043 Rn. 44 – Kontrollsystem; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 75 – Unterbauleiste; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 64 – Kinderreisesitz). So kann es beispielsweise verfehlt sein, für die Deutung des Patentanspruchs an einem hergebrachten Begriffsverständnis zu haften, wenn dieses zu einer Differenzierung zwischen vom Anspruch erfassten und außerhalb des Patentanspruchs liegenden Ausführungsformen führt, die angesichts des technischen Inhalts der Erfindung unangebracht ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14, GRUR-RS 2016, 03043 Rn. 44 – Kontrollsystem; Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 75 – Unterbauleiste; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz).
In Anwendung dieser Grundsätze ist dem Wortsinn von Merkmal 3 nicht das Erfordernis einer vollständigen Abtrennbarkeit des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt zu entnehmen.
Die Funktion bzw. der Zweck der abnehmbaren Verbindung besteht offensichtlich darin, ein (regelmäßiges) Nachfüllen des Spenderinhalts zu ermöglichen (BPatGU S. 21; ebenso: BPatG, Urt. v. 15.10.2019 – 5 Ni 2/18 zum EP 2 313 XXX). Darauf weist die Klagepatentschrift zwar nicht ausdrücklich hin. Diese Funktion liegt für den Fachmann aber auf der Hand, weshalb sie keiner Erwähnung in der Patentschrift bedarf. Denn das anspruchsgemäße Spendergehäuse ist ausweislich Abs. [0007] der Patentbeschreibung bestimmt für einen Spender für Verbrauchsmaterialien in Restaurants, Toiletten oder Ähnlichem, der mit Rollen oder Stapeln aus Papier oder anderen Wischmaterialien oder mit Waschsubstanzen wie etwa flüssiger Handcreme, Seife oder anderen Reinigungsmitteln bestückt werden kann. Hieraus entnimmt der Fachmann, dass das Spendergehäuse so ausgebildet sein muss, dass es Waschmaterialien oder Waschsubstanzen aufnehmen und an einen Nutzer abgeben kann. Im Hinblick auf die übliche Verwendung eines solchen Spenders in Restaurants, Toiletten oder Ähnlichem muss das Spendergehäuse darüber hinaus so ausgebildet sein, dass ein regelmäßiges Nachfüllen von Papiertüchern, Papierrollen oder Waschsubstanzen, z.B. durch eine Reinigungskraft, möglich ist.
Um ein regelmäßiges Nachfüllen des Spenders mit solchem Verbrauchsmaterial zu ermöglichen, ist es „nur“ erforderlich, die im Patentanspruch vorgesehene Verbindung zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt, durch die das Spendergehäuse ausgebildet wird, soweit (partiell) zu „lösen“, dass das Gehäuse zum Zwecke einer Beschickung des Spenders mit Papiermaterial oder Waschsubstanzen geöffnet werden kann. Dies kann, wie der Fachmann unschwer erkennt, sowohl durch eine vollständige Abnahme des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt als auch durch ein Verschwenken des Spenderteils gegenüber dem hinteren Spenderabschnitt um 90 bis 180° nach vorne – zum Nutzer hin – bewerkstelligt werden. Einer vollständigen Abnahme des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt bedarf es zur Erfüllung der der „abnehmbaren Verbindung“ zugedachten Funktion mithin nicht.
Dass es dem Klagepatent zur Erfüllung der vorgenannten Funktion gerade auf eine vollständige Abtrennbarkeit des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt ankommt, lässt sich der Klagepatentschrift nicht entnehmen.
Aus der Beschreibung und Darstellung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung ergibt sich in dieser Hinsicht nichts. So kann der Fachmann insbesondere den Figuren 13 bis 15, die das patentgemäße Spendergehäuse im Ganzen zeigen, nicht entnehmen, wie die „abnehmbare“ Verbindung des Spenderteils mit dem hinteren Spenderabschnitt bei den in diesen Figuren gezeigten Ausführungsbeispielen konstruktiv bewerkstelligt ist. Die genannten Figuren, die nachfolgend eingeblendet werden, lassen allesamt konstruktive Einzelheiten der gewählten Verbindung von Spenderteil und hinterem Spenderabschnitt nicht erkennen. -
Auch in den zugehörigen Beschreibungsstellen (Abs. [0077] bis [0079]) wird die „lösbare Verbindung“ in konstruktiver Hinsicht nicht genauer beschrieben. Dass das Spenderteil von dem hinteren Spenderabschnitt vollständig abnehmbar sein muss, lässt sich mithin weder den Zeichnungen noch den diese betreffenden Beschreibungspassagen entnehmen.
Soweit das Landgericht im Parallelverfahren betreffend das EP ‘XXX auf eine Verwendung der Spendergehäuse in engen Toilettenkabinen abstellt und argumentiert, dass es in solchen beengten Verhältnissen vorteilhaft sein könne, das Spenderteil vollständig abnehmen und zur Seite legen zu können, kann es unter bestimmten Umständen ebenso als vorteilhaft erachtet werden, wenn das Spenderteil im geöffneten Zustand des Spendergehäuses am hinteren Spenderabschnitt gehalten wird, weil dann keine Ablagemöglichkeit für das Spenderteil gesucht werden muss und mit der freien Hand unmittelbar das Papiermaterial nachgefüllt werden kann. Das Klagepatent geht auf solche Aspekte nicht ein. In der Klagepatentschrift, in der nicht einmal die Zielsetzung der von Merkmal 3 gelehrten „abnehmbaren Verbindung“ des Spenderteils mit dem hinteren Spenderabschnitt (Nachfüllbarkeit von Papiermaterial) thematisiert wird, werden keine Vor- oder Nachteile in Bezug auf die Verbindung des Spenderteils und des hinteren Spenderabschnitts zur Ausbildung des Spendergehäuses erwähnt. Es fehlt vielmehr jegliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik, weshalb der Klagepatentschrift auch nicht entnommen werden kann, dass sich das Klagepatent – aus bestimmten funktionalen Gründen – für eine bestimmte Verbindungsmöglichkeit, nämlich eine solche, die eine vollständige Trennung des Spenderteils vom hinteren Spenderabschnitt ermöglicht, entschieden hat. -
cc)
Die gebotene funktionale Betrachtung (vgl. BGH, GRUR 2024, 1523 – Waage; GRUR 2024, 1515 Rn. 35 – Stereofotogrammetrie; Senat, Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 64 – Kinderreisesitzbasis, mwN) darf zwar bei räumlich-körperlich definierten Merkmalen nicht dazu führen, dass ihr Inhalt auf die bloße Funktion reduziert und das Merkmal in einem Sinne interpretiert wird, der mit der räumlich-körperlichen Ausgestaltung, wie sie dem Merkmal eigen ist, nicht mehr in Übereinstimmung steht (BGH, GRUR 2016, 921 Rn. 30 ff. – Pemetrexed; Senat, Urt. v. 26.11.2020 – I-2 U 65/19, GRUR-RS 2020, 37856 Rn. 69 – Trägerplatte; Urt. v. 04.04.2024 – I-2 U 72/23, GRUR-RS 2024, 7750 Rn. 58 – Spanabhebendes Werkzeug). Dies setzt allerdings voraus, dass einem Begriff, der im Patentanspruch zur Beschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes verwendet wird, eine so eindeutige Bedeutung bzw. ein so eindeutiger Inhalt zukommt, dass jegliche Ausgestaltung, die hiervon abweicht – auch dann, wenn sie ebenfalls zur Erfüllung der technischen Funktion des Merkmals geeignet ist – als nicht dem Wortsinn entsprechend anzusehen ist.
Dies ist hier im Hinblick auf Merkmal 3 nicht der Fall. Die dort geforderte „Abnehmbarkeit“ („Lösbarkeit“) betrifft nicht das Spenderteil und den hinteren Spenderabschnitt als solche. Vielmehr wird allein die Verbindung der beiden Bauteile als „abnehmbar“ bzw. „lösbar“ („detachably“) bezeichnet, ohne dabei ausdrücklich auszusprechen, dass hierdurch die Verbindung beider Bauteile miteinander vollständig aufhebbar sein soll. Aus dem Anspruchswortlaut ergeben sich vielmehr zwei Zustände: In dem einen Zustand soll die Verbindung bestehen, um das geschlossene Spendergehäuse auszubilden, in dem anderen Zustand soll die Verbindung „abgenommen“ bzw. „gelöst“ werden, um das Spendergehäuse zu öffnen. Letzteres schließt die Möglichkeit ein, dass die Verbindung nur partiell „abgenommen“ bzw. „gelöst“ wird. Dies kann z.B. durch das Lösen einer Verrastung erfolgen, die in der Folge das Verschwenken des Spenderteils um ein Scharnier zum Öffnen des Gehäuses ermöglicht. Auch auf diese Weise wird die zuvor bei geschlossenem Gehäuse bestehende vollständige Verbindung zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt „gelöst“ und in eine nur noch partielle Verbindung beider Bauteile überführt, die ein Öffnen des Spendergehäuses ermöglicht. -
dd)
Soweit das Parallelpatent EP ʼXXX in Abs. [0005] zwei mögliche Ausgestaltungen aus dem Stand der Technik benennt, wie das Spenderteil am hinteren Spenderabschnitt befestigt sein kann, um den Nachfüllvorgang zu ermöglichen, fehlt eine entsprechende Passage in der Klagepatentschrift. Insbesondere differenziert die Klagepatentschrift an keiner Stelle zwischen den Begriffen „detachably joined“/“abnehmbar verbunden“ und „picvotably joined“/“verschwenkbar verbunden“. Erst recht findet keine Auseinandersetzung mit etwaigen Vor- und Nachteilen der verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten des Spenderteils am hinteren Spenderabschnitt statt. Hieraus zieht der Fachmann den Schluss, dass es der klagepatentgemäßen Lehre auf diesen Aspekt gerade nicht ankommt und von der „abnehmbaren Verbindung“ im Sinne von Merkmal 3. sämtliche Verbindungen erfasst werden sollen, die ein mit der – ggf. auch nur partiellen – Trennung von Spenderteil und hinterem Spenderabschnitt einhergehendes Öffnen des Spendergehäuses dergestalt ermöglichen, dass Verbrauchsmaterial nachgefüllt werden kann. -
ee)
Die von der Beklagten angeführten Äußerungen der Klägerin im Erteilungsverfahren betreffend das Parallelpatent ʼXXX geben keinen Anlass zu einer abweichenden Beurteilung.
Bei der Erteilungsakte handelt es sich von vornherein um kein zulässiges Auslegungsmaterial, weil sie in Art. 64 EPÜ nicht erwähnt und auch nicht allgemein veröffentlicht ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 511, 513 f. – Kunststoffrohrteil; GRUR 2010, 602 Rn. 33 – Gelenkanordnung; GRUR 2016, 257 Rn. 36 – Glasfasern II; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2014, 185, 196 – WC-Sitzgelenk; Urt. v. 07.04.2016 – I-2 U 79/13, GRUR-RS 2016, 11229 Rn. 59 – Messsensoren; Urt. v. 20.07.2017 – I-15 U 61/16, GRUR-RS 2017, 125984 Rn. 64 – Bauteilverbindungsvorrichtung; Urt. v. 01.02.2018 – I-2 U 33/15, GRUR-RS 2018, 11286 Rn. 86 – Polysiliziumschicht; GRUR-RR 2020, 137 Rn. 123 ff. – Bakterienkultivierung; Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 123 – Endoskopievorrichtung; GRUR-RR 2023, 101 Rn. 60 – elektrohydraulisches Pressgerät). Dies gilt umso mehr, als vorliegend nicht das Erteilungsverfahren zum Klagepatent, sondern das Erteilungsverfahren zum Parallelpatent ʼXXX angesprochen wird. Die dort getätigten Äußerungen können – aufgrund des zum Teil übereinstimmenden Wortlauts der unter Schutz gestellten Ansprüche – allenfalls ein Indiz dafür sein, wie der Fachmann das betreffende Merkmal begreift (vgl. BGH, NJW 1997, 3377, 3380 – Weichvorrichtung II; GRUR 2016, 921 Rn. 39 – Pemetrexed; Urt. v. 17.12.2020 – X ZR 15/19, GRUR-RS 2020, 42976 Rn. 26 – L-Aminosäureproduktion; Senat, GRUR-RR 2023, 101 Rn. 60 – elektrohydraulisches Pressgerät; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 93 – Kinderreisesitzbasis; Urt. v. 04.07.2024 – I-2 U 30/20, GRUR-RS 2024, 19029 Rn. 126 – Solarzelle, mwN).
Die von der Beklagten in Bezug genommenen Äußerungen der Klägerin im Erteilungsverfahren betreffend das Parallelpatent ʼXXX lassen entsprechende (eindeutige) Schlüsse jedoch nicht zu. Auf die entsprechenden Ausführungen des Senats im Parallelverfahren XXX wird verwiesen. -
ff)
Schließlich veranlassen auch die im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteile des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs (Anlagen BB 43 und BB 56) den Senat nicht zu einer anderen Beurteilung.
Die Entscheidungsgründe einer das Klagepatent aufrechterhaltenen Einspruchsentscheidung oder eines aufrechterhaltenden Nichtigkeitsurteils binden den Verletzungsrichter nicht (vgl. Senat, Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 9/21, GRUR-RS 2021, 39586 Rn. 59 – Halterahmen III, mwN; Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 60 – Rohrbearbeitungsvorrichtung; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 50 – Kinderreisesitz). Es ist eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist (st. Rspr.; vgl. nur BVerfG, GRUR-RR 2009, 441, 442; BGH, GRUR 2010, 858 Rn. 15 – Crimpwerkzeug III; GRUR 2015, 868 Rn. 25 – Polymerschaum; GRUR 2015, 972 Rn. 20 – Kreuzgestänge; GRUR 2021, 574 Rn. 32 – Kranarm; Senat, Urt. v. 26.11.2015 – I-2 U 74/14, BeckRS 2016, 15016 Rn. 33, mwN). Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist demgemäß Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 20 – Kreuzgestänge, m.w.N; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 76 – Rohrbearbeitungsvorrichtung).
Die vorliegenden Urteile des BPatG und des BGH hat der Senat allerdings als (gewichtige) sachverständige Äußerungen zu würdigen. Sie geben aus seiner Sicht indes keinen Anlass zu einer anderweitigen Auslegung des Patentanspruchs 1. Das BPatG führt auf S. 21 seines Urteils zu Merkmal 3 aus:
„Das gemäß den Figuren 13 bis 15 aus zumindest zwei Teilkomponenten zusammengesetzte Spenderteil (vordere Abdeckung) ist zudem abnehmbar mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden, wobei der hintere Spenderabschnitt an einer vertikalen Wand montierbar ausgestaltet ist (Merkmale 1.8 und 1.9). Die Funktion der Abnehmbarkeit des Spenderteils bezieht sich gemäß der Beschreibung der Streitpatentschrift explizit auf die Spenderteile (90), (100) und (110) der Figuren 13 bis 15, die von den jeweiligen hinteren Spenderabschnitten „rear dispenser sections“ (96), (106), bzw. (116) abnehmbar ausgestaltet sind (Absätze [0077], [0078], [0079] sowie Patentanspruch 1 gemäß Streitpatent). Eine Abnehmbarkeit des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt versteht der Fachmann überdies derart, dass das Abnehmen für ein Nachfüllen des Spenderinhalts (z.B. Papierrolle, Papiertücherstapel) geeignet sein soll.“
Diese Ausführungen versteht der Senat als Bestätigung der von ihm vorgenommenen funktionalen Auslegung des Klagepatentanspruchs 1. Das BPatG deutet in dem vorstehend wiedergegebenen Abschnitt in keiner Weise an, dass es die Möglichkeit der vollständigen Entfernung des Spenderteils vom hinteren Spenderabschnitt nach der erfindungsgemäßen Lehre für zwingend erforderlich erachtet. Entsprechendes findet sich auch in dem Urteil des BGH vom 14.03.2023 nicht. Im Rahmen der Auslegung des Patentanspruchs 1 befasst sich der BGH nicht mit der „abnehmbaren Verbindung“ zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt.
Erst im Hinblick auf den Offenbarungsgehalt der Ni 3 (WO 2006/054XXX XX) und die Frage der Patentfähigkeit des Gegenstands des Klagepatents setzen sich sowohl der BGH (erstmals) als auch das BPatG (erneut) mit der „abnehmbaren Verbindung“ im Sinne des Merkmals 3 auseinander. Das BPatG führt hierzu aus (BPatGU S. 25):
„In Bezug auf das Merkmal 1.8 und die „abnehmbare Verbindung“ des Spenderteils (cover 2) mit dem hinteren Spenderabschnitt (portion 3) sind insbesondere die Ausführungen auf Seite 5 ab Zeile 2 relevant, wonach das Drehgelenk über Schwenkstifte oder sonstige mögliche drehbare Befestigungselemente, auch in Form von Vorsprüngen und entsprechenden Ausnehmungen realisiert werden kann. Damit soll der Begriff „Scharnierstruktur“ breit aufgefasst werden und jede Struktur umfassen, die es ermöglicht, die Abdeckungen schwenkbar am Grundkörper zu befestigen (…) Somit sind dem Fachmann alle möglichen Varianten von Drehgelenken offenbart, die grundsätzlich auch „abnehmbare“ Ausführungen mit einschließen. Im Übrigen ist die Zielsetzung einer Trennung des Deckels vom Grundkörper die, eine Beschickung des Spenders vorzunehmen. Das Drehgelenk ermöglicht eine entsprechende „Abnahme“ des Deckels und dient dabei lediglich einer alternativen „Ablage“ im Sinne einer einfacheren Handhabung. Insofern ist auch das Merkmal 1.8 in der Ni 1 offenbart.“ -
Im Urteil des BGH heißt es lediglich (BGHU Rn. 51):
„Wie der Senat bereits im Zusammenhang mit dem früher zu beurteilenden Patent ausgeführt hat, sind auch die Merkmale 3 und 4 offenbart …“ -
Die hier in Bezug genommene Passage aus dem Urteil des BGH vom 07.12.2021 (Az: X ZR 111/19) betreffend das Parallelpatent ʼXXX lautet (Rn. 50):
„In Ni 3 ist zwar nicht ausdrücklich offenbart, dass die Abdeckung (2) nicht nur schwenkbar, sondern auch abnehmbar ist. Aus den Ausführungen, wonach jede Ausgestaltung in Betracht kommt, die ein Schwenken ermöglicht, ergibt sich jedoch hinreichend deutlich, dass auch Scharniere in Betracht kommen, bei denen eines der verschwenkbaren Teile abgenommen werden kann. Dies steht in Einklang mit dem als Alternative angeführten Beispiel, bei dem Vorsprünge am Körper (3) in Vertiefungen in der Abdeckung (2) greifen. Diese Ausgestaltung ermöglicht jedenfalls dann ein Entfernen der Abdeckung, wenn deren Seitenwände eine gewisse Flexibilität aufweisen.“ - Soweit den Ausführungen des BPatG und des BGH zum Offenbarungsgehalt der Ni 1 (im Parallelverfahren Ni 3) zu entnehmen sein sollte, dass eine „abnehmbare“ Verbindung im Sinne des Klagepatentanspruchs 1 mehr erfordert als ein Verschwenken des Spenderteils gegenüber dem hinteren Spenderabschnitt, nämlich die Möglichkeit der vollständigen Entfernung des Spenderteils von dem hinteren Spenderabschnitt, haben sich beide Gerichte mit dem Inhalt des Merkmals 3 nicht explizit auseinandergesetzt. Insbesondere wird die Frage, ob auch (nur) verschwenkbare Verbindungen zwischen dem Spenderteil und dem hinteren Spenderabschnitt, bei denen beide Bauteile nicht vollständig voneinander getrennt werden können, den Vorgaben des Merkmals 3 entsprechen können, nicht erörtert. Auf diese Frage kam es im Rechtsbestandsverfahren auch nicht entscheidend an, weil die entgegengehaltene Ni 1 nach Auffassung des BGH und des BPatG verschwenkbare Verbindungen offenbart, bei denen auch ein vollständiges Abnehmen (Entfernen) des Spenderteils vom hinteren Spenderabschnitt möglich ist. Darüber hinaus klingt jedenfalls im Urteil des BPatG durchaus ein insoweit weiteres Verständnis des Merkmals 3 an, wenn dieses feststellt, dass die Zielsetzung einer Trennung des Deckels vom Grundkörper darin liegt, eine Beschickung des Spenders zu ermöglichen, und weiter ausführt, dass das Drehgelenk – mithin eine verschwenkbare Verbindung – eine entsprechende „Abnahme“ des Deckels ermöglicht. Dies könnte so zu verstehen sein, dass das Merkmal 3 auch nach Auffassung des BPatG nicht notwendig eine vollständige Abnehmbarkeit des Spenderteils vom hinteren Spenderabschnitt voraussetzt.
-
b)
Gemäß Merkmal 2.3 ist das erste Komponententeil „transparent“ ausgebildet. Nach der erfindungsgemäßen Lehre ist ein Komponententeil transparent, wenn es in höherem Maße durchscheinend ist, so dass wesentliche optische Merkmale aus dem Inneren des Spendergehäuses wie etwa der Füllstand einer Seife oder der noch vorhandene Vorrat an Papiertüchern von außen zumindest schemenhaft zu erkennen sind (vgl. auch BPatGU S. 21). -
aa)
Soweit der Fachmann unter „transparenten“ Kunststoffen – wie von der Beklagten vorgetragen – üblicherweise solche versteht, die vollständig durchsichtig sind, also keine relevante Streuung oder Diffundierung der Lichtstrahlen verursachen, kommt es hierauf für die Auslegung des Klagepatentanspruchs 1 nicht an. Denn in Anbetracht der lexikalischen Bedeutung jeder Patentschrift verbietet es sich, wie bereits ausgeführt (s.o.), die Merkmale eines Patentanspruchs anhand der Definition in Fachbüchern oder nach dem allgemeinen Sprachverständnis auszulegen; vielmehr müssen sie aus der Patentschrift selbst heraus verstanden werden, wobei grundsätzlich eine funktionsorientierte Auslegung geboten ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.10.2011 – I-2 U 3/11, GRUR-RS 2011, 26945 Rn. 16 – Wärmedämmelement; Urt. v. 14.01.2016 – I-2 U 77/14, GRUR-RS 2016, 03043 Rn. 44 – Kontrollsystem; Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung).
Die Klagepatentschrift führt in Abs. [0002] aus, dass es im Stand der Technik bereits bekannt war, einen Abschnitt des Spenderteils transparent zu gestalten, um die Überprüfung des Füllstandes eines in dem Spender enthaltenen Verbrauchsartikels zu erleichtern. Hierbei kann es sich um Papierrollen, Papiertücher, Seife oder ähnliches handeln (vgl. Abs. [0007]). Eben dieser technische Sinn liegt auch Merkmal 2.3 zugrunde, wenn dieses fordert, das erste Komponententeil transparent auszubilden (vgl. auch BPatGU S. 21). Hierfür genügt es, dass das Komponententeil soweit durchscheinend ist, dass es dem Nutzer bzw. der Reinigungskraft möglich ist zu erkennen, ob und (grob) wie viel Verbrauchsmaterial noch in dem Spender enthalten ist. -
bb)
Dem steht nicht entgegen, dass der Fachmann eine solche Ausgestaltung üblicherweise dem Begriff der „Transluzenz“ oder der „Semi-Transparenz“ zuordnen würde. Die Klagepatentschrift sieht keinen Gegensatz zwischen „transparent“ und „transluzent“, sondern grenzt vielmehr „transparente“ Materialien von „opaken“ Materialien ab (vgl. auch die Merkmale 3.1 und 4.1). In Abs. [0009] der Klagepatentschrift wird im Hinblick auf die Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform ausgeführt, dass die anspruchsgemäßen Komponententeile „aus dem gleichen oder unterschiedlichen Kunststoffmaterialien in einer beliebigen Kombination einer opaken, semi-opaken, semi-transparenten oder transparenten Form hergestellt sind“. In Abs. [0053] wird ein Ausführungsbeispiel beschrieben, bei dem das erste Material „ein transparentes oder transluzentes Harz“ ist. In beiden Beschreibungsstellen setzt die Klagepatentschrift nicht die Begriffe „transparent“ und „semi-transparent“ / „transluzent“ als Gegensatzpaar ein, sondern stellt opake bzw. semi-opake Materialien den transparenten bzw. semi-transparenten Materialien gegenüber. Dabei geht sie davon aus, dass auch die semi-transparenten und damit transluzenten Ausgestaltungen von dem Schutzbereich des Klagepatents umfasst sind. -
cc)
In dieser Einschätzung sieht der Senat sich durch das Urteil des BPatG vom 12.11.2020 bestätigt, das als (gewichtige) sachverständige Äußerung zu würdigen ist. Das BPatG führt dort aus (S. 21):
„Nach Merkmal 1.7 ist als transparente Teilkomponente auch eine in höherem Maße durchscheinende, eine aus sogenanntem transluzenten Material hergestellte Kunststoffkomponente anzusehen, bei der wesentliche optische Merkmale aus dem Inneren eines Gehäuses (Papiervorrat) auch von außen zumindest schemenhaft zu erkennen sind.“
An späterer Stelle (BPatGU S. 29) wird ausgeführt, dass sich für die erste Kunststoffteilkomponente der Einsatz von MABS als geeignetes Material aufdränge. Dieser Werkstoff sei „als glasklares, naturfarbenes Granulat sowie in vielen transparenten und gedeckten Einfärbungen lieferbar“. Somit kenne „der Fachmann für Spritzguss diesen Werkstoff als Einsatz auch ganz speziell als (teil)-transparente Komponente für diese Anwendung“. Das BPatG geht auch hier – entsprechend seiner zuvor vorgenommenen Auslegung – davon aus, dass eine Teiltransparenz der ersten Kunststoffteilkomponente für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre ausreicht.
Dem ist der BGH in seinem Urteil vom 14.03.2023 (Anlage BB 56) nicht entgegengetreten. Soweit er die Auswahl der eingesetzten Kunststoffe durch das zusätzlich eingefügte Merkmal 2.4 auf MABS und ABS beschränkt hat, stellt er in seinem Urteil zugleich klar, dass MABS „transparent“ sei, ABS hingegen „undurchsichtig“ (BGHU Rn. 30). Auf die Unterscheidung, dass MABS in seiner Grundform klar durchsichtig ist, es den Werkstoff aber auch in teiltransparenten Einfärbungen gibt, geht der BGH in seinem Urteil nicht ein. Vielmehr lässt er die Frage, ob auch ein transluzentes Material „transparent“ im Sinne des Klagepatentanspruchs 1 sein kann, ausdrücklich dahinstehen (BGHU Rn. 31). Der Senat bejaht diese Frage – der sachverständigen Äußerung des BPatG folgend – aufgrund einer funktionalen Auslegung des Merkmals 2.3.
Aus den Rn. 63, 64 des Urteils des BGH ergibt sich nichts anderes. Dort stellt der BGH lediglich fest, dass durch die Entgegenhaltung Ni 3 (WO 99/18835), die eine Abdeckung aus einem halbtransparenten oder transluzenten Material oder alternativ eine Abdeckung aus opakem Material mit einem transparenten Sichtfenster zeigt, Merkmal 2.3 (dort Merkmal 2.a) nicht offenbart sei. Hieraus lässt sich nicht der Rückschluss ziehen, die erfindungsgemäße Lehre umfasse keine Ausgestaltungen, bei denen das erste Komponententeil transluzent ausgebildet ist. Der BGH hat – wie bereits ausgeführt – die Frage, ob auch ein tranluzentes Material als „transparent“ im Sinne des Klagepatents anzusehen ist, ausdrücklich offengelassen (BGHU Rn. 31). Dem Klagepatent kommt es gerade nicht darauf an, durch das transparente Komponententeil eine möglichst perfekte Sicht auf das Füllmaterial zu ermöglichen, sondern es soll dem Nutzer lediglich möglich sein, den Füllstand des Verbrauchsmaterials bei geschlossenem Spendergehäuse (grob) abzuschätzen. -
dd)
Der Klagepatentschrift lässt sich dabei nicht entnehmen, dass die transparente Ausgestaltung des ersten Komponententeils an jedwedem möglichen Einsatzort und unter allen in Betracht kommenden Einsatzorten eine Überprüfung des Füllstandes ohne Öffnen des Spenders ermöglichen soll. Es reicht insoweit aus, dass dies unter in Betracht kommenden, nicht völlig ungewöhnlichen Lichtverhältnissen möglich ist. -
3.
Ausgehend von der oben erläuterten Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents machen die angegriffenen Ausführungsformen von dieser wortsinngemäß Gebrauch. Für Merkmal 1, die Merkmalsgruppe 2, Merkmal 2.4 und Merkmal 4. steht dies zwischen den Parteien zu Recht außer Streit und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung. Hinsichtlich der Merkmale 2.1.3 und 2.2.2, die im Parallelverfahren XXX zwischen den Parteien im Streit stehen, wird ergänzend auf die diesbezüglichen Ausführungen des Senats in dem ebenfalls am 14.11.2024 verkündeten Urteil in der Parallelsache verwiesen. Dass die angegriffenen Ausführungsformen auch die in diesem Verfahren streitigen Merkmale 3 und 2.3 verwirklichen, ergibt sich aus den nachstehenden Ausführungen. -
a)
Die angegriffenen Ausführungsformen weisen sämtlich Spenderteile auf, die im Sinne des Merkmals 3 „abnehmbar“ („lösbar“) mit dem hinteren Spenderabschnitt verbunden sind. Die Spenderteile sind unstreitig jeweils verschwenkbar am hinteren Spenderabschnitt befestigt und ermöglichen das regelmäßige Nachfüllen von Papiermaterial im montierten Zustand des Spendergehäuses an einer Wand. Darauf, ob die Spenderteile vollständig von dem hinteren Spenderabschnitt entfernt werden können, kommt es nach der Lehre des Klagepatents nicht an. -
b)
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen darüber hinaus auch Merkmal 2.3, denn sie weisen ein transparentes erstes Kunststoffteil aus MABS und ein opakes zweites Komponententeil aus ABS auf. Von der Tatsache, dass das erste Komponententeil bei sämtlichen angegriffenen Ausführungsformen jedenfalls soweit durchscheinend ist, dass ein Nutzer den Füllstand des eingelegten Verbrauchsmaterials grob schemenhaft erkennen kann, hat sich der Senat im Wege der Inaugenscheinnahme der angegriffenen Ausführungsformen in der mündlichen Verhandlung am 08.10.2024 überzeugt.
Der Senat hat die Inaugenscheinnahme der angegriffenen Ausführungsformen unter den im Sitzungssaal herrschenden Lichtverhältnissen bei eingeschalteter Deckenbeleuchtung vorgenommen und die Spender dabei an die Wand gehalten, um eine Situation herzustellen, wie sie üblicherweise bei der vorgesehenen Verwendung der Spender in Toiletten, Restaurants oder Ähnlichem herrscht. Soweit die Beklagte im Rahmen der mündlichen Verhandlung darauf abgestellt hat, dass die angegriffenen Ausführungsformen überwiegend in dunkel gefliesten, schlecht ausgeleuchteten Räumen eingesetzt würden, verfängt dieser Einwand nicht. Die angegriffenen Ausführungsformen sind jedenfalls für den im Klagepatent vorgesehenen Einsatz in „normalen“ Toiletten, Restaurants und ähnlichem objektiv geeignet, wenn unter den dort regelmäßig herrschenden Lichtverhältnissen bei geschlossenem Gehäuse der Füllstand zumindest schemenhaft erkennbar ist. Entsprechende Lichtverhältnisse vermochte der Senat im Sitzungssaal in angemessener Weise nachzustellen. Insofern hält der Senat die Situation bei eingeschalteter Beleuchtung für maßgeblich; es kann nicht davon ausgegangen werden, dass es üblicherweise auf Toiletten, in Restaurants oder an ähnlichen Orten an einer entsprechenden Beleuchtung fehlt.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen 1, 3, 4a, 6a, 10a, 11a war der Füllstand unter diesen Bedingungen jeweils gut zu erkennen. Dies gilt – soweit verfügbar – für eine Befüllung sowohl mit weißem Papier als auch mit Umweltpapier, wobei die Erkennbarkeit bei einer Befüllung mit Umweltpapier durchweg etwas schlechter war als bei einer Befüllung mit weißem Papier. Bei den angegriffenen Ausführungsformen 2, 5a, 7a, 9a und 12a war der Füllstand jedenfalls schemenhaft zu erkennen, wobei durchgängig die Sichtbarkeit aus der Seitenansicht etwas besser war als aus der Frontansicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform 8a war der Füllstand von allen Papierspendern am schlechtesten zu erkennen. Auch hier konnte der Senat den Füllstand aber noch schwach schemenhaft durch die geschlossene Gehäusefront erkennen; aus der Seitenansicht war die Erkennbarkeit insofern etwas besser. Zu den angegriffenen Ausführungsformen 15 und 16 haben die Parteien keine Muster zur Akte gereicht. Da sie aber nach den übereinstimmenden Angaben beider Parteien in der Gestaltung des Gehäuses den angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 entsprechen, gelten die zu diesen Ausführungsformen getroffenen Feststellungen des Senats entsprechend.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen 13 und 14 – den Seifenspendern – war der Füllstand etwas schwerer zu erkennen. Der Senat geht allerdings davon aus, dass eine mit der Befüllung der Spender betraute Reinigungsperson Kenntnis von der Gestalt der eingesetzten Seifenkartusche oder auch des eingesetzten Seifenbeutels hat und deshalb weiß, worauf sie bei der Betrachtung des Spendergehäuses zu achten hat, wenn sie den Füllstand der Seife überprüft. Unter Berücksichtigung dessen ist der Füllstand auch bei den angegriffenen Ausführungsformen bei geschlossenem Gehäuse jedenfalls schemenhaft zu erkennen. Dies gilt umso mehr, wenn die Reinigungskraft den Spender nicht nur aus der Frontansicht, sondern – wovon im normalen Betrieb auszugehen sein wird – auch aus der Seitenansicht betrachtet. In diesem Fall lässt die transluzente Ausgestaltung des ersten Komponententeils auch bei geschlossenem Gehäuse jedenfalls bei genauer Betrachtung die Ermittlung des Füllstandes der im Spender befindlichen Waschsubstanz zu.
Dabei vermochte der Senat nicht festzustellen, dass die Ausführungsformen in schwarzer Farbgebung eine grundsätzlich schlechtere Lichtdurchlässigkeit aufweisen als die Ausführungsformen in weißer Farbgebung. Die Erkennbarkeit des Füllstandes hängt vielmehr im Einzelfall von verschiedenen Faktoren wie dem Grad der Mattierung des Kunststoffmaterials, der Größe des ersten Komponententeils und dem jeweiligen Einfallswinkel des Lichts ab. Allen angegriffenen Ausführungsformen ist gemein, dass sie ein erstes Komponententeil aufweisen, durch das auch bei geschlossenem Gehäuse zumindest schemenhaft der Füllstand des eingebrachten Verbrauchsmaterials zu erkennen ist.
Die von der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 26.08.2024 (dort S. 16 ff, Bl. 1357 GA) abgedruckten Abbildungen begründen keine andere Beurteilung. Wie die Beklagte selbst ausführt (S. 22, Bl. 1363), können Fotografien in diesem Fall die Wirklichkeit nicht vollständig abbilden, u.a. weil die angegriffenen Ausführungsformen eine spiegelnde Oberfläche aufweisen. Aus eben diesem Grund hat der Senat eine Inaugenscheinnahme der angegriffenen Ausführungsformen durchgeführt. -
4.
Aufgrund der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre durch die angegriffenen Ausführungsformen stehen der Klägerin die (noch) geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte zu, Art. 64 EPÜ, §§ 139 ff. PatG, §§ 242, 259 BGB. -
a)
Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts im Tatbestand des angefochtenen Urteils hat die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen auf der Messe CMS 2017 ausgestellt. Außerdem bewirbt sie diese in einem online abrufbaren Produktkatalog. Hierin liegt jeweils ein dem Berechtigten vorbehaltenes Anbieten nach § 9 Nr. 1 PatG.
Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Landgerichts vertreibt die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen außerdem unter der Marke „I“ in Deutschland. Einen Tatbestandsberichtigungsantrag hat die Beklagte nicht gestellt. Soweit sie im Berufungsverfahren bestreitet, die angegriffenen Ausführungsformen nach Deutschland zu liefern bzw. diese im Inland selbst zu vertreiben, und vorträgt, die angegriffenen Spender würden durch ein Tochternehmen von ihr, die J, nach Deutschland geliefert bzw. an deutsche Kunden vertrieben, kann sie hiermit im Berufungsverfahren nicht mehr gehört werden, nachdem die Klägerin dieses Vorbringen mit Nichtwissen bestreitet (vgl. Bl. 1507 R GA).
Davon abgesehen trifft die Beklagte auch eine Verantwortlichkeit für den Vertrieb patentverletzender angegriffener Ausführungsformen in Deutschland durch ihre französische Tochtergesellschaft. Denn für eine Patentverletzung hat auch derjenige einzustehen, der eine Benutzung des geschützten Gegenstands durch einen Dritten durch eigenes fahrlässiges Verhalten ermöglicht oder fördert, wenn dieses Verhalten einer Rechtspflicht zuwiderläuft, die jedenfalls auch dem Schutz des verletzten absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und daher zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Ob und in welchem Umfang eine Rechtspflicht zur Verhinderung eines schutzrechtsverletzenden Erfolgs besteht, richtet sich im Einzelfall nach der Abwägung aller betroffenen Interessen und relevanten rechtlichen Wertungen (vgl. BGH, GRUR 2017, 785 Rn. 52 f. – Abdichtsystem). Werden durch die Verletzung einer solchen Rechtspflicht begangene fremde Verletzungshandlungen schuldhaft ermöglicht oder gefördert, kommen gegen den Verletzer dieser Pflicht Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft/Rechnungslegung in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2017, 785 Rn. 78, 83 – Abdichtsystem; OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 167 – Polsterumarbeitungsmaschine). Unter den vorgenannten Voraussetzungen kommt erst recht eine Haftung desjenigen in Betracht, der das Klagepatent durch eine eigene Benutzungshandlung iSd § 9 PatG verletzt. Dies gilt auch für einen Schaden, der erst durch das Hinzutreten einer weiteren Benutzungshandlung eines anderen (unmittelbar) verursacht worden ist. Die Vorschrift des § 139 Abs. 2 PatG beschränkt die Haftung auf Schadensersatz nicht auf den unmittelbar aus der eigenen vorsätzlichen oder fahrlässigen Benutzungshandlung resultierenden Schaden. Daher haftet ein Verletzer auch für den Schaden, der erst durch Hinzutreten einer weiteren Benutzungshandlung eines anderen entstanden ist, wenn ihm diese Benutzungshandlung aufgrund seiner eigenen Benutzungshandlung nach den vorstehenden Grundsätzen wertungsmäßig zuzurechnen ist (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 168 – Polsterumarbeitungsmaschine). Regelmäßig ist dies anzunehmen, wenn der Patentverletzer durch eigene Angebotshandlungen den Vertrieb bzw. Absatz patentverletzender Erzeugnisses eines anderen Unternehmens seiner Unternehmensgruppe fördert. Die Haftung entspricht insofern dem Rechtsgedanken des § 840 Abs. 1 BGB, wonach mehrere nebeneinander für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden Verantwortliche als Gesamtschuldner haften (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 168 – Polsterumarbeitungsmaschine).
Die Beklagte hat die angegriffenen Ausführungsformen, die durch die Unternehmensgruppe in Deutschland vertrieben worden sind, unstreitig in ihrem Internetauftritt beworben. Hierin liegt ein dem Berechtigten vorbehaltenes Anbieten nach § 9 Nr. 1 PatG. Die Beklagte behauptet nicht und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass es angegriffene Ausführungsformen gegeben hat, die zwar in Deutschland vertrieben worden sind, die aber nicht Gegenstand ihres Internetauftrittes und damit ihres Angebots gewesen sind. Es kann dahinstehen, ob die Beklagte durch das Anbieten der angegriffenen Ausführungsformen einen Anstifter-, Gehilfen- oder Mittäterbeitrag zu den Vertriebshandlungen der J in Deutschland gesetzt hat. Jedenfalls hat die Beklagte durch die Bewerbung der angegriffenen Ausführungsformen deren Vertrieb in Deutschland durch die Unternehmensgruppe pflichtwidrig und schuldhaft ermöglicht bzw. gefördert und haftet daher für den hieraus entstandenen Schaden nach § 139 Abs. 2 PatG auch ohne eine ggf. fehlende vorsätzliche Beteiligung (vgl. hierzu OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 166 ff. – Polsterumarbeitungsmaschine).
Darüber hinaus hat die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen unstreitig auch selbst hergestellt, der J zum Vertrieb überlassen und ihren anschließenden Vertrieb durch die J geduldet, obwohl sie dies zumindest durch Einstellung der Herstellung und/oder Überlassung an die J hätte unterbinden können.
Soweit es im Urteilstenor zu A.I.1. heißt, dass das Spenderteil „lösbar“ mit einem hinteren Spenderabschnitt verbunden ist, entspricht diese Formulierung dem Berufungsantrag der Klägerin. Alternativ könnte es dort anstelle von „lösbar“ auch „abnehmbar“ heißen, da beide Begriffe hier synonym verwendet werden. -
b)
Dass die Beklagte nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a 3 S. 1 PatG auch zum Rückruf der das Klagepatent verletzenden Papierspender verpflichtet ist und der Klägerin nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG außerdem allen Schaden zu ersetzen hat, der dieser durch die patentverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird, hat das Landgericht in dem angegriffenen Urteil zutreffend festgestellt. -
c)
Soweit bereits das Landgericht einen Anspruch der Klägerin auf Auskunft und Rechnungslegung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zuerkannt hat, bezieht sich der Rechnungslegungsanspruch – entgegen der Auffassung der Beklagten – nicht nur auf die patentverletzenden Spender, sondern im zuerkannten Umfang auch auf das in diesen zu verwendende Verbrauchsmaterial. Die zulässige Anschlussberufung der Klägerin (s.o.) ist insoweit begründet. -
aa)
Der durch die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zu kompensierende Schaden ist in der Beeinträchtigung des absoluten Rechts und der mit diesem verbundenen, allein dem Inhaber zugewiesenen Nutzungsmöglichkeiten zu sehen. Der Schaden besteht darin, dass der Verletzer die durch das immaterielle Schutzgut vermittelten konkreten Marktchancen für sich nutzt und sie damit zugleich der Nutzung durch den Schutzrechtsinhaber entzieht. Ziel der Methoden zur Schadensberechnung ist die Ermittlung desjenigen Betrags, der zum Ausgleich dieses Schadens erforderlich und angemessen ist, und damit die Ermittlung des wirtschaftlichen Werts des Schutzrechts und der in ihm verkörperten Marktchancen. Dieser wird durch den erwarteten, aber entgangenen Gewinn des Schutzrechtsinhabers, durch den tatsächlichen Gewinn des Verletzers oder durch die Gewinnerwartung erfasst, die vernünftige Vertragsparteien mit dem Abschluss eines Lizenzvertrags über die Nutzung des Schutzrechts verbunden hätten (BGH GRUR 2012, 1226 Rn. 15 f. – Flaschenträger; GRUR 2024, 273 Rn. 19, 20 – Polsterumarbeitungsmaschine; GRUR 2024, 1201 Rn. 32 – Verdampfungstrockneranlage).
Schadensersatzrelevant für die Bemessung des Verletzergewinns ist zunächst, was außer Zweifel steht, derjenige Umsatz (und Gewinn), den der Verletzer im Rahmen seines Geschäftsbetriebes mit der patentgeschützten Vorrichtung als solcher erzielt. Damit ist der mögliche Umfang der Schadenersatzpflicht jedoch noch nicht abgesteckt. Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 1962, 509, 512 – Dia-Rähmchen II) zur Herausgabe des Verletzergewinns kann unter Umständen auch ein weitergehender Gewinn herausverlangt werden. Der Gewinn des Patentverletzers, wenn der Patentinhaber ihn soll herausverlangen können, muss hiernach in einer solchen Beziehung zu dem Patent und der Patentverletzung stehen, dass er eben deshalb billigerweise dem Patentinhaber gebührt. Denn der Anspruch auf Herausgabe des Gewinns beruht auf der Erwägung, dass es unbillig wäre, dem Verletzer einen Gewinn zu belassen, der auf einer schuldhaften unbefugten Benutzung des Schutzrechts beruht (BGH, GRUR 2019, 496 Rn. 20 – Spannungsversorgungsvorrichtung). Er zielt auf eine Kompensation des Umstands, dass sich der Verletzer bei Umsatzgeschäften die erfindungsgemäße Lehre zunutze gemacht und damit die von der Rechtsordnung dem Schutzrechtsinhaber zugewiesene Marktchance für sich genutzt hat (BGH, GRUR 2012, 1226 Rn. 35 – Flaschenträger). Die Abschöpfung des Verletzergewinns dient zudem der Sanktionierung des schädigenden Verhaltens und auf diese Weise der Prävention gegen eine Verletzung der besonders schutzbedürftigen Immaterialgüterrechte (BGH, GRUR 2019, 496 Rn. 20 – Spannungsversorgungsvorrichtung). In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt sich regelmäßig nicht genau ermitteln, sondern nur abschätzen. Der notwendige ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutzrechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist dabei nicht nur im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen. Auch bei Gewinnen aus dem Inverkehrbringen patentgemäßer Vorrichtungen ist vielmehr wertend zu bestimmen, ob und in welchem Umfang der erzielte Gewinn auf den mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Eigenschaften des veräußerten Gegenstands oder anderen Faktoren beruht (BGH, GRUR 2013, 1212 Rn. 5 – Kabelschloss; GRUR 2012, 1226 Rn. 20 – Flaschenträger; GRUR 2024, 273 Rn. 24 f. – Polsterumarbeitungsmaschine; GRUR 2024, 1201 Rn. 16 – Verdampfungstrockneranlage).
Hiervon ausgehend umfasst der Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns auch Zusatzgeschäfte, die zwar keine Benutzungshandlung i.S.v. § 9 PatG oder § 10 PatG darstellen, deren Abschluss aber in ursächlichem Zusammenhang mit patentverletzenden Handlungen steht und einen hinreichenden Bezug zu dem verletzenden Gegenstand aufweist (BGH, GRUR 2024, 273 Rn. 28 – Polsterumarbeitungsmaschine; GRUR 2024, 1201 Rn. 15 – Verdampfungstrockneranlage).
Ein solcher hinreichender Bezug besteht jedenfalls bei Gewinnen aus mit der Patentverletzung in ursächlichem Zusammenhang stehenden Geschäften über Verbrauchsmaterialien, die zur Verwendung mit einer patentverletzenden Vorrichtung bestimmt sind. Wie der Gewinn aus dem Inverkehrbringen des verletzenden Gegenstands wird in solchen Konstellationen zwar auch der Gewinn aus dem Vertrieb der Verbrauchsmaterialien in aller Regel nicht allein auf der Patentverletzung beruhen, sondern auf anderen Faktoren, die für die Kaufentscheidung des Kunden maßgeblich waren. Dies ändert aber nichts daran, dass der Gewinn jedenfalls auch auf der Patentverletzung beruht, weil der Vertrieb des Verbrauchsmaterials ohne das Inverkehrbringen der patentverletzenden Vorrichtung nicht oder nicht in demselben Maße hätte erfolgen können.
Dies ist insbesondere in Konstellationen naheliegend, in denen das Verbrauchsmaterial – wie vorliegend – seiner Beschaffenheit nach auf die geschützte Vorrichtung abgestimmt ist oder wenn der Bezug aus einer Hand aus sonstigen Gründen Vorteile bietet (BGH, GRUR 2024, 273 Rn. 42 – Polsterumarbeitungsmaschine). Charakteristisch für den Vertrieb von Verbrauchsmaterialien ist gerade die enge Bindung an das Verletzergeschäft, das in ganz naheliegender Weise den Weg zu den weiteren Erlösen aus der Lieferung von Verbrauchsmaterialien ebnet, weil sie erforderlich sind, um den Verletzungsgegenstand ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen oder weiter zu verwenden. Dieser beinahe zwangsläufige Zusammenhang verlangt eine Erstreckung der Schadenersatzpflicht auch auf solche Folgegeschäfte (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 16. Aufl. Kap. D Rn. 816). Der Einwand des Verletzers, er hätte den Gewinn mit den Verbrauchsmaterialien auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten erzielen können, ist ihm unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich versagt (vgl. BGH, GRUR 2024, 273 Rn. 40 – Polsterumarbeitungsmaschine; vgl. hierzu auch GRUR 2024, 1201 Rn. 43 ff. – Verdampfungstrockneranlage). -
bb)
Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch dient der Ermittlung, Bezifferung und Durchsetzung des der Klägerin zustehenden Schadenersatzanspruchs aus § 139 Abs. 2 PatG. Als Hilfsanspruch zur Verwirklichung seines Schadensersatzanspruchs steht dem Patentinhaber insoweit gegen den Verletzer ein nach Inhalt und Umfang dem Grundsatz von Treu und Glauben unterstehender akzessorischer Hilfsanspruch auf Rechnungslegung aus den §§ 242, 259 BGB zu. Dieser Anspruch ist seinem Umfang nach auf die zur Durchsetzung des Hauptanspruchs erforderlichen Informationen begrenzt, die der Gläubiger selbst nicht anders erlangen kann und deren Erteilung dem Schuldner unschwer möglich und zumutbar ist (BGH, GRUR 2019, 496 Rn. 12 – Spannungsversorgungsvorrichtung).
Da der Patentinhaber frei zwischen den einzelnen Berechnungsmethoden des Schadensersatzes wählen kann und sich daher insbesondere auch nicht vor Auskunftserteilung und Rechnungslegung hinsichtlich der von ihm präferierten Form der Schadensberechnung festlegen muss (BGH, GRUR 2000, 226, 227 – Planungsmappe; GRUR 2008, 93 – Zerkleinerungsvorrichtung), reicht es für das Bestehen eines Rechnungslegungsanspruchs aus, dass sich aus den die Verbrauchsmaterialien betreffenden Geschäften ein Beitrag zum Verletzergewinn ergeben kann. Der Rechnungslegungsanspruch ist nicht auf solche Geschäftsvorfälle beschränkt, die tatsächlich und nachweislich einen Beitrag zum herauszugebenden Verletzergewinn leisten. Nur wenn die Auskunftserteilung und Rechnungslegung grundsätzlich alle Geschäftsvorfälle umfasst, die kausal auf dem Vertrieb der patentverletzenden Vorrichtung beruhen, ist der Berechtigte in der Lage zu überprüfen, ob und gegebenenfalls inwieweit der Verletzer auch insoweit herauszugebenden Gewinn aus der Patentverletzung gezogen hat. Bestimmte Arten von Geschäftsvorfällen unterfallen daher nur dann per se nicht der Rechnungslegung, wenn von vornherein ein Beitrag zum Verletzergewinn hinreichend sicher ausgeschlossen werden kann. Daher erstreckt sich die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung regelmäßig auch auf durch die Veräußerung von Verbrauchsmaterialien generierte Umsätze des Verletzers mit dem Abnehmer einer patentverletzenden Vorrichtung, die kausal auf der Veräußerung der patentverletzenden Vorrichtung beruhen können. Ob der aus diesen Umsatzgeschäften erzielte wirtschaftliche Ertrag gerade auf denjenigen Vorteilen beruht, die das Klagepatent gegenüber dem Stand der Technik zur Verfügung stellt, kann für den Umfang des herauszugebenden Verletzergewinns von Bedeutung sein, ist aber für die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung unerheblich (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 191 – Polsterumarbeitungsmaschine; Senat, Urt. v. 02.11.2008 – I-2 U 82/02, BeckRS 2010, 22916; GRUR 2023, 394 Rn. 61 – Tassenspender; LG Düsseldorf, InstGE 6, 136). Allein auf diese Weise wird der Berechtigte in die Lage versetzt, für die Berechnung des Verletzergewinns relevante Vorgänge zu ermitteln und die Angaben des Verletzers zum erzielten Verletzergewinn zu überprüfen (OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641Rn. 192 – Polsterumarbeitungsmaschine; Senat, GRUR 2023, 394 Rn. 61 – Tassenspender).
Soweit es um Gewinne aus Zusatzgeschäften geht, besteht ein Anspruch auf Rechnungslegung danach in Bezug auf alle Geschäfte, die es aufgrund ihres Inhalts, aufgrund der Umstände, unter denen sie geschlossen worden sind, oder aufgrund sonstiger Anhaltspunkte als nicht fernliegend erscheinen lassen, dass sie in Ursachenzusammenhang mit einer rechtswidrigen Benutzungshandlung stehen (BGH, GRUR 2024, 273 Rn. 75 – Polsterumarbeitungsmaschine; LG Düsseldorf, Urt. v. 11.04.2006 – 4b O 430/02, InstGE 6, 137 – Magnetspule; LG München, Urt. v. 04.03.2022 – 21 O 7664/20, GRUR-RS 2022, 42052 – Umfang der Auskunftspflicht bei Peripheriegeräten). Ob ein solcher Zusammenhang tatsächlich besteht, ist gegebenenfalls nach Rechnungslegung zu entscheiden. -
cc)
Danach ist das Begehren der Klägerin auf Rechnungslegung (auch) über das Verbrauchsmaterial gerechtfertigt. Die von der Klägerin mit ihrem Antrag geforderte Rechnungslegung bezieht sich dabei von vornherein nicht auf jeden beliebigen Verkauf von Verbrauchsmaterial an jedweden Abnehmer, sondern es geht ausschließlich um Lieferungen von Verbrauchsmaterial zur Verwendung in den in diesem Rechtsstreit angegriffenen Spendern, d.h. um Lieferungen von mit den angegriffenen Ausführungsformen kompatiblen Papierrollen, Papiertüchern und Waschsubstanzen an gewerbliche Abnehmer der Beklagten, die auch eine der angegriffenen Ausführungsformen erworben haben.
Die Klägerin bewirbt bestimmtes, von ihr angebotenes Verbrauchsmaterial als kompatibel zu den angegriffenen Papier- bzw. Seifenspendern. Hierauf weist sie nicht nur auf ihren Webseiten und in ihrem Produktkatalog hin, sondern auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 6 findet sich auch der explizite Hinweis, den erworbenen Spender ausschließlich mit den hierzu kompatiblen Papierutensilien der Beklagten zu benutzen. Ein entsprechender Hinweis auf die kompatible Seife findet sich auch auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsformen 13 und 14. Aus der Sicht eines objektiven Empfängers wird hierdurch ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den angegriffenen Papier- bzw. Seifenspendern und dem zu deren Bestückung vorgesehenen Verbrauchsmaterial der Beklagten hergestellt, wobei der Abnehmer den betreffenden Hinweis sogar dahin verstehen kann, dass die Spender nur mit dem Verbrauchsmaterial der Beklagten verwendet werden können und sich erst dann der von der Beklagten beworbene Effekt eines geringeren Verbrauchs einstellt.
Dadurch, dass die Beklagte selbst durch ihre Werbung, ihren Produktkatalog und zum Teil auch auf der Verpackung der angegriffenen Ausführungsformen einen unmittelbaren Bezug zu bestimmten, von ihr angebotenen Verbrauchsmaterialien herstellt, besteht hier die nicht nur fernliegende Möglichkeit, dass sich – auch – aus dem Umsatz der Beklagten mit dem an die Abnehmer der angegriffenen Ausführungsformen zu deren Betrieb vertriebenen Verbrauchsmaterial ein Beitrag zu dem Gewinn ergibt, den die Beklagte mit während der Schutzdauer begangenen Verletzungshandlungen erzielt (hat). Nach den Umständen des vorliegenden Falls genügt insoweit zunächst, dass die Beklagte – möglicherweise – solches Verbrauchsmaterial nicht oder jedenfalls nicht in demselben Umfang abgesetzt hätte, wenn sie den Abnehmern desselben nicht zuvor bzw. gleichzeitig die patentverletzenden Spender überlassen hätte.
Das durch die Beklagte selbst beschriebene Geschäftsmodell zeichnet sich dadurch aus, dass der maßgebliche Umsatz und Gewinn nicht mit dem Verkauf der Dispenser, sondern mit der Lieferung des Verbrauchsmaterials erwirtschaftet wird. Soweit der Umsatz für das Verbrauchsmaterial bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise den patentverletzenden Dispensern und dort der Nutzung der patentgemäßen Funktionalität zuzurechnen ist, ist er anteilig dem Verletzergewinn zuzurechnen. Für die Überprüfung, ob der Verletzer einen Teil des mit dem patentverletzenden Erzeugnis erzielten Gewinns mittelbar über den Umsatz mit dem Verbrauchsmaterial erwirtschaftet und daher auch ein Teil des Umsatzes mit dem Verbrauchsmaterial möglicherweise unter diesem Gesichtspunkt zum Verletzergewinn beiträgt, benötigt die Klägerin die Angaben zu den Umsatzgeschäften mit Verbrauchsmaterial für die patentverletzenden Dispenser (vgl. auch: OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 192 – Polsterumarbeitungsmaschine).
Soweit die Beklagte geltend macht, dass sich das von ihr vertriebene Verbrauchsmaterial nicht nur in den angegriffenen erfindungsgemäßen Spendern, sondern in gleicher Weise auch in von ihr angebotenen patentfreien Spendern und Spendern anderer Hersteller verwenden lasse, ist bei der gebotenen Bewertung nicht auszuschließen, dass die Abnehmer des Verbrauchsmaterials der Beklagten dieses gerade wegen seiner Eignung zur Verwendung in den patentgemäßen angegriffenen Ausführungsformen, gegebenenfalls zumindest zu größeren Mengen, abnehmen. Dass sich das Verbrauchsmaterial auch in einer patentfreien Vorrichtung verwenden lassen mag, bei der die Vorteile der erfindungsgemäßen Ausbildung der angegriffenen Ausführungsformen nicht genutzt werden, schließt nicht aus, dass gerade auch deren patentgemäße Ausgestaltung dazu geführt hat, dass anschließend (auch) der Absatz des Verbrauchsmaterials der Beklagten begünstigt war. Ob dies tatsächlich der Fall war, muss für die hier allein zur Entscheidung gestellte Rechnungslegungspflicht nicht entschieden werden (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 2022, 641 Rn. 194 – Polsterumarbeitungsmaschine).
Genauso ist ohne Belang, ob die Beklagte die von ihr angebotenen Spender ausschließlich an Handelsunternehmen veräußert. Abgesehen davon, dass es die Beklagte damit in der Hand hätte, ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung allein durch eine entsprechende Vertriebsgestaltung zu entgehen, hat die Beklagte auch über die Lieferung der Spender an Handelsunternehmen, die wiederum die Spender an deren Nutzer weiterveräußern, eine entsprechende Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien auf Abnehmerseite geschaffen, die ihr ggf. weitere Absatzmöglichkeiten eröffnet. Der für das Entstehen der Rechnungslegungspflicht erforderliche Kausalzusammenhang ist damit gegeben. Ob und ggf. in welchem Umfang sich diese Lieferungen letztlich im Rahmen der Schadensberechnung niederschlagen, bedarf an dieser Stelle keiner Entscheidung. Für den Rechnungslegungsanspruch genügt die – hier bestehende – Möglichkeit, dass sich hieraus ein Beitrag zum Verletzergewinn ergibt.
Im Rahmen ihrer Rechnungslegungsverpflichtung hinsichtlich Verbrauchsmaterialien schuldet die Beklagte die im Urteilstenor zu A.I.4. genannten Informationen. Ihren weitergehenden Auskunfts- und Rechnungslegungsantrag hat die Beklagte im Verhandlungstermin vor dem Senat zurückgenommen. -
C.
Der (Hilfs-) Antrag der Beklagten, ihr für den Fall ihrer Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung für die zu erteilenden Informationen Geheimnisschutz zu gewähren, indem diese Informationen als geheimhaltungsbedürftig eingestuft und der Klägerin besondere Geheimhaltungspflichten auferlegt werden, ist unbegründet und deshalb zurückzuweisen. Für eine solche Anordnung gibt es keine gesetzliche Grundlage. -
I.
Die §§ 16, 19 GeschGehG finden auf die tenorierte Verpflichtung des Patentverletzers zur Auskunft und Rechnungslegung über seine unberechtigten Benutzungshandlungen keine Anwendung (so bereits: LG Düsseldorf, Beschl. v. 26.09.2022 – 4c O 59/20 ZV I; bestätigend: Senat, GRUR 2023, 677 – Geheimnisschutz II; zustimmend: Thomas in FS Kühnen 2024, S. 945 ff; jetzt auch ausdrücklich für einen bereits im Erkenntnisverfahren gestellten Antrag: LG Düsseldorf, Urt. v. 02.07.2024 – 4c O 19/23; ebenso: Köhler/Bornkamm, GeschGehG, 42. Aufl., § 16 Rn.25; vgl. zu den Einzelheiten auch: Kühnen Hdb. Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. D Rn. 126 ff.; aA: LG Mannheim, GRUR-RS 2021, 51390 = GRUR 2022, 1176 Ls. – Geheimnisschutzanordnung; offengelassen in der Nachinstanz nach Erledigung in der Hauptsache von OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, 28741 – Auskunftspflicht; aA auch BeckOK PatR/Kircher, 33. Ed. 15.07.2023, PatG § 145a Rn. 22).
Nach § 145a S. 2 PatG gelten als streitgegenständliche Informationen i.S.d. § 16 Abs. 1 GeschGehG „sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen“. Aufgrund eines titulierten Anspruchs zu erteilende Auskünfte sind hiervon schon dem Wortlaut nach nicht umfasst. Es handelt sich dabei nicht um von einer Partei im Rahmen des Verfahrens geleisteten Vortrag, sondern um die Erfüllung eines tenorierten materiell-rechtlichen Anspruchs. Die hiernach zu erteilenden Informationen sind zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Geheimnisschutz – wird dieser wie hier bereits im Erkenntni.S.v.erfahren geltend gemacht – noch nicht einmal Gegenstand des Verfahrens und damit in keiner Weise „eingeführt“ im Sinne der Vorschrift des § 145a PatG. Vielmehr wird hier ein Geheimnisschutz vorbeugend geltend gemacht für in der Zukunft zu erteilende und ihrem Inhalt nach noch völlig unbekannte Informationen.
Solche Informationen sind nach dem Willen des Gesetzgebers kein tauglicher Gegenstand für die Anordnung von Geheimnisschutzmaßnahmen nach den §§ 16, 19 GeschGehG. Schon vor der Ergänzung des S. 2 in § 145a PatG hat die Gesetzesbegründung zu § 145a PatG ausgeführt, dass es „zur Anspruchsbegründung oder zur Verteidigung“ notwendig sein könne, Geschäftsgeheimnisse vor Gericht zu offenbaren (BT-Drs. 19/25821, 57). Mit dem nachträglich eingefügten S. 2 sollte ausweislich der weiteren Begründung klargestellt werden, dass der Begriff der streitgegenständlichen Informationen in § 16 Abs. 1 GeschGehG nicht streng im Sinne des zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu verstehen ist, sondern grundsätzlich alle vom Kläger sowie vom Beklagten im Rahmen seiner Verteidigung eingeführten Informationen umfasst (BT-Drs. 19/30498, 56; so auch bereits BT-Drs. 19/25821, 57, 2. Abs.). Anhaltspunkte dafür, dass jenseits des Vortrags zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung auch die im Wege eines tenorierten Auskunftsanspruchs an den Gläubiger zu offenbarenden Informationen von § 145 a S. 2 PatG umfasst sein sollen, lassen sich der Gesetzesbegründung hingegen nicht entnehmen (Senat, GRUR 2023, 677 – Geheimnisschutz II).
Für die Anordnung von Schutzmaßnahmen betreffend die tenorierte Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht des Patentverletzers besteht auch unter Berücksichtigung des Schutzzwecks der §§ 16 bis 20 GeschGehG kein Anlass. Im originären Anwendungsbereich dieser Vorschriften dienen die hiernach möglichen Anordnungen dem Schutz desjenigen Geheimnisträgers, der in seinen Rechten verletzt ist, weil sein Geschäftsgeheimnis unbefugt von einem Nichtberechtigten erlangt, genutzt oder offengelegt worden ist. Übertragen auf den Patentverletzungsprozess kommen damit Konstellationen in Betracht, in denen der Verletzte zur Geltendmachung seiner Rechte Geschäftsgeheimnisse offenbaren muss oder aber – wie ebenfalls in der Gesetzesbegründung erwähnt wird und wie es in § 145a S. 2 PatG zum Ausdruck kommt – der mutmaßliche Verletzer Geschäftsgeheimnisse offenlegen muss, um sich gegen eine (unberechtigte) Inanspruchnahme zu verteidigen. Der Schutz des wegen einer Patentverletzung Verurteilten vor der uneingeschränkten Erteilung tenorierter Auskünfte findet in der Gesetzesbegründung hingegen an keiner Stelle Erwähnung (Senat, GRUR 2023, 677 – Geheimnisschutz II).
II.
Ein Anspruch auf verfahrensrechtlichen Geheimnisschutz kann auch nicht damit begründet werden, dass die zu erteilenden Informationen ohnehin einer aus einem Auskunftsschuldverhältnis folgenden Zweckbindung unterlägen und der Auskunftsgläubiger in diesem Zusammenhang offenbarte Geschäftsgeheimnisse des Auskunftsschuldners seinen Mitarbeitern oder externen Beratern nur insoweit offenbaren dürfe, wie dies für eine zweckentsprechende Auswertung und Verwendung notwendig sei, wobei er überdies die hinzugezogenen Personen zur Geheimhaltung verpflichten müsse (so: Haedicke, GRUR 2020, 785; LG Mannheim, GRUR 2022, 301 Rn. 36 ff. – Geheimnisschutzanordnung; Schumacher, GRUR Patent 2023, 41, 42; offen gelassen von OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, 28741 – Auskunftspflicht; ablehnend: Thomas in FS Kühnen 2024, S. 945, 952). Auch wenn man annimmt, was hier keiner weiteren Vertiefung und Entscheidung bedarf, dass die Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht der Beklagten ein solches Pflichtenverhältnis zwischen den Parteien begründet, könnten sich hieraus – im Falle einer bereits erfolgten oder drohenden Zuwiderhandlung – allenfalls Unterlassungs- und ggf. Schadensersatzansprüche der Beklagten gegen die Klägerin ergeben. Solange es hingegen – wie hier – keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass die Klägerin – als Gläubigerin des tenorierten Anspruchs auf Auskunft und Rechnungslegung – gegen ihre Pflicht zur Geheimhaltung und zweckgebundenen Verwertung der von ihr erlangten Informationen verstoßen wird, kommt die – allein vorbeugende – Anordnung von Geheimhaltungsanordnungen nicht in Betracht (vgl. zum Zwangsvollstreckungsverfahren auch: OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2022, 28741 Rn. 33 – Rechtzeitige Erfüllung einer titulierten Auskunftspflicht).
Soweit dem in der Literatur entgegengehalten wird, der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch erhalte so einen ungerechtfertigten Sanktionscharakter (so: Schumacher, GRUR Patent 2023, 41, 42), ist darauf hinzuweisen, dass der Patentverletzer Täter einer unerlaubten (deliktischen) Handlung ist, die rechtswidrig in nicht nur einfachgesetzlich geschützte, sondern wegen Art. 14 GG sogar grundrechtlich garantierte Eigentumspositionen des Schutzrechtsinhabers eingreift. Das Gesetz hält aus diesem Grund für den Verletzten in den §§ 139 ff. PatG bestimmte, den Störungszustand beendende und das begangene Unrecht kompensierende Sanktionen bereit. Typischerweise ist die zugrundeliegende Verletzungssituation dadurch gekennzeichnet, dass der Patentinhaber erfindungsgemäße Erzeugnisse selbst herstellt und/oder vertreibt. Es repräsentiert daher den Regel- und keinen Sonderfall, dass sich in einem Patentverletzungsprozess am Markt tätige Wettbewerber gegenüberstehen, weswegen es gerade nichts Außergewöhnliches ist, sondern – ganz im Gegenteil – der üblichen Konstellation entspricht, dass der Verletzer im Rahmen seiner Auskunfts- und Rechnungspflicht demjenigen geheime Geschäftsdaten (wie Preise) offenbaren muss, mit dem er auf dem betreffenden Markt um Aufträge und Kunden konkurriert. Dem in § 140b PatG gesetzlich normierten und durch eine ergänzende Anwendung der §§ 242, 259 BGB in der Rechtsprechung anerkannten Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung können in derartigen Konstellationen nicht diejenigen nachteiligen Folgen für die Wettbewerbsposition des Verletzers entgegengehalten werden, die normale und gewöhnliche Folge der Pflicht zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sind (Senat, Beschl. v. 21.07.2010 – I-2 U 47/10, BeckRS 2011, 2537 – Gleitsattelscheibenbremse; vgl. auch: Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 16. Aufl. Kap. D Rn.875).
Soweit die Beklagte außerdem auf die Enforcement-Richtlinie verweist, sollte durch diese gerade die Position desjenigen, dessen geistiges Eigentum durch deliktische Tat verletzt worden ist, in besonderer Weise gestärkt werden (vgl. Senat, Beschl. v. 21.07.2010 – I-2 U 47/10, BeckRS 2011, 2537 – Gleitsattelscheibenbremse).
Zwar steht hier auch ein Rechnungslegungsanspruch der Klägerin aus den §§ 242, 259 BGB hinsichtlich nicht patentverletzender Verbrauchsmaterialien in Rede. Dies vermag in Bezug auf den diesbezüglichen Rechnungslegungsanspruch an dem vorstehenden Ergebnis indes nichts zu ändern, weil die Beklagte der in ihrem Ausschließlichkeitsrecht verletzten Patentinhaberin auch diese Auskunft aufgrund der von ihr begangenen patentverletzenden Handlungen in ihrer Eigenschaft als Patentverletzerin schuldet. -
D.
Der nach Schluss der mündlichen Verhandlung zur Akte gereichte Schriftsatz der Klägerin vom 14.10.2024, im Hinblick auf welchen ein Schriftsatznachlass nicht gewährt worden ist, gibt keinen Anlass, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen, § 156 ZPO. -
E.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Kostenentscheidung zur Nebenintervention beruht auf § 101 Abs. 1 HS 2 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Dass der BGH im Nichtigkeitsverfahren von einem engeren Verständnis des hier streitigen Merkmals 3 ausgegangen ist, lässt sich seinem Nichtigkeitsberufungsurteil nicht eindeutig entnehmen; wie bereits ausgeführt, hat er sich dort nicht weiter mit der Auslegung dieses Merkmals befasst. Dass die §§ 16, 19 GeschGehG auf die tenorierte Verpflichtung des Patentverletzers zur Auskunft und Rechnungslegung nicht anwendbar sind, erscheint dem Senat eindeutig. Gegenteilige obergerichtliche Rechtsprechung liegt insoweit nicht vor.