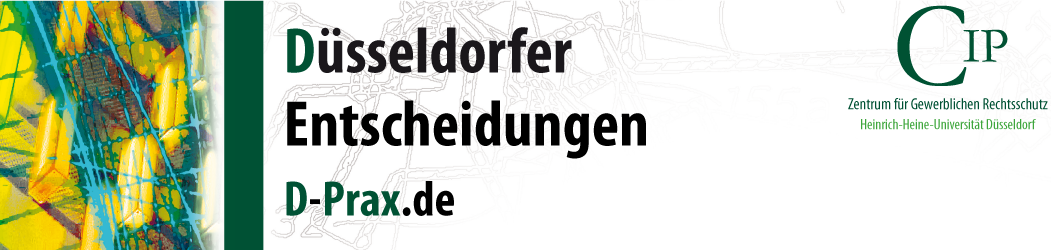Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3414
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 10. September 2024, I- 2 U 32/24
Vorinstanz: 4c O 34/22
- I.
Die Berufung der Klägerin gegen das am 21. Juli 2023 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen. -
II.
Auf die Anschlussberufung der Beklagten wird Ziffer 2. des Tenors des landgerichtlichen Urteils vom 21. Juli 2023 wie folgt abgeändert:
Die Kosten des Rechtsstreits in erster Instanz sowie die erstinstanzlichen Kosten der Nebenintervention trägt die Klägerin. -
III.
Die Klägerin trägt auch die Kosten des Berufungsverfahrens sowie die zweitinstanzlichen Kosten der Nebenintervention. -
IV.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind für die Beklagten und ihre Streithelferin wegen ihrer Kosten vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % der aufgrund der Urteile vollstreckbaren Beträge abwenden, wenn nicht die Beklagten oder die Streithelferin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten. -
V.
Die Revision wird nicht zugelassen. -
VI.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000 Euro festgesetzt.
- Gründe:
-
A.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 10 2011 123 XXX XX (nachfolgend: Klagepatent, vorgelegt als Anlage K17). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung sowie auf Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
Das Klagepatent ist eine Teilanmeldung zu der aus der Stammanmeldung der DE 10 2011 003 XXX XX (nachfolgend: DE ´XXX) herausgeteilten Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2011 123 XXX.X. Als solche nimmt es deren Anmeldetag vom 09.02.2011 sowie die Priorität der japanischen Schrift JP 2010-026XXX vom 09.02.2010 in Anspruch. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 19.05.2022 im Patentblatt bekannt gemacht.
Die Streithelferin der Beklagten hat am 30.09.2022 Einspruch gegen das Klagepatent vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erhoben (vgl. Anlage St2), über den noch nicht entschieden ist. Das Parallelpatent DE ´XXX hat das Bundespatentgericht (BPatG) mit Urteil vom 29.02.2024 (Anlage St11) in einer eingeschränkten Fassung aufrechterhalten. Dieses ist Gegenstand eines Parallelverfahrens vor dem Senat mit dem Aktenzeichen I-2 U 33/24 (erstinstanzliches Az.: 4c O 19/22).
Das Klagepatent trägt die Bezeichnung „A“. Sein Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung: - „Halbleitervorrichtung mit einer SiC-Halbleiterschicht (2), einem Wannenbereich (4), der selektiv an einer Oberfläche der SiC-Halbleiterschicht (2) gebildet ist, und einem Dotierungsimplantationsbereich (3), der selektiv an einer Oberfläche des Wannenbereichs (4) gebildet ist, wobei der Dotierungsimplantationsbereich (3) eine Vertiefung aufweist, die in einem Abschnitt von ihm an einer Oberfläche des Dotierungsimplantationsbereichs (3) gebildet ist außer in einem Abschnitt nahe einem Endabschnitt, und der Abschnitt nahe dem Endabschnitt eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht (2) hin gebogene Form hat, wobei die Halbleitervorrichtung weiterhin umfasst: eine Gateelektrode (8), wobei die Gateelektrode sich bis über den Abschnitt nahe dem Endabschnitt und über die Vertiefung erstreckt.“
- Die beanspruchte Halbleitervorrichtung wird im Klagepatent unter anderem anhand der nachfolgend wiedergegebenen Figur 22 erläutert:
- Die anspruchsgemäße Halbleitervorrichtung umfasst eine SiC-Halbleiterschicht (2), an deren Oberfläche ein Wannenbereich (4) gebildet ist. An einer Oberfläche des Wannenbereichs (4) ist durch lonenimplantation selektiv ein Dotierungsimplantationsbereich (3) gebildet. Der Dotierungsimplantationsbereich (3) weist eine Vertiefung auf. Im Urteil des Bundespatentgerichts vom 29.02.2024 zum Parallelpatent DE ´XXX (Anlage St11, S. 12 oben) ist diese Vertiefung zur Verdeutlichung in einem vergrößerten Ausschnitt aus der (kolorierten) Figur 22 gezeigt, der nachfolgend wiedergegeben wird:
- Es ist zu erkennen, dass der die Vertiefung aufweisende Abschnitt („vertiefter Oberflächenbereich“) nicht bis zum Ende des Dotierungsimplantationsbereichs (3, blau koloriert) reicht, sondern sich ein „nicht vertiefter Oberflächenbereich“ anschließt, der eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht (2) hin gebogene Form aufweist.
-
Bei der Klägerin handelt es sich um ein in Irland ansässiges Unternehmen, das in dem Bereich der Verwertung von Patenten tätig ist.
Die Beklagte zu 1) ist ein Tochterunternehmen des Automobilherstellers B Inc. mit Sitz in C, USA, das den Vertrieb dieser Fahrzeuge in Deutschland verantwortet. Die Beklagte zu 2) gehört der B International B.V., die wiederum ein Tochterunternehmen der B Inc. und für die Herstellung der Elektrofahrzeuge in Deutschland zuständig ist. Sie betreibt unter anderem die in D unter dem Stichwort „E“ bekannt gewordene Produktionsstätte für B Elektrofahrzeuge. Derzeit wird dort ausschließlich das Fahrzeugmodell F hergestellt.
In den B Elektrofahrzeugen der Modellreihen G, H, I und F sind sog. „drive units“ verbaut, die den Motor, ein Differentialgetriebe und einen „drive inverter“ enthalten. Letzterer weist Mikrochips der Streithelferin auf, welche mit Feldeffekttransistoren (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) ausgestattet sind. -
Die Klägerin hat erstinstanzlich die Auffassung vertreten, die angegriffenen Feldeffekttransistoren seien Halbleitervorrichtungen im Sinne des Klagepatents und würden unmittelbar wortsinngemäß von der Lehre des Klagepatentanspruchs 1 Gebrauch machen.
Die bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig vorhandenen Unebenheiten an der Oberfläche des Sourcebereichs seien als erfindungsgemäße Vertiefungen im Dotierungsimplantationsbereich einzuordnen. Das Klagepatent mache insoweit keine konkreten räumlich-körperlichen Angaben, insbesondere sei eine bestimmte Mindesttiefe nicht angegeben. Die bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen Unebenheiten seien bewusst und planvoll durch Ätzen hervorgerufen. Sie seien herstellungsbedingt keineswegs zwingend; vielmehr könnten die bei der Dotierung verwendeten Masken auch rückstandslos und ohne das Verursachen von Beschädigungen an der Oberfläche wieder entfernt werden.
Für die Verwirklichung der klagepatengemäßen Lehre sei es unerheblich, dass die angegriffene Ausführungsform lediglich „abgeflachte Hakenstrukturen“ aufweise. Diese würden sich jedenfalls gegenüber einer Vertiefung nach oben absetzen. Das Klagepatent erfordere im Hinblick auf den erfindungsgemäß vorgesehenen hakenförmigen Abschnitt keinen bestimmten Winkel. Insbesondere werde deshalb keine senkrechte Abknickung in einem Winkel von 90° gefordert. Auch eine Hinter-/ Unterschneidung verlange das Klagepatent nicht. Der hakenförmige Endabschnitt sei erfindungsgemäß nicht dazu vorgesehen, hieran eine Maske auszurichten. -
Die Beklagten und deren Streithelferin, die Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen das Klagepatent gerichteten Einspruchsverfahrens beantragt haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und geltend gemacht:
Da das Klagepatent nach dem Implantieren des Sourcebereichs die Implantierung des Wannenbereichs in dessen Vertiefung vorsehe, zeichne der Wannenbereich stets den Verlauf der Oberfläche der Halbleitervorrichtung nach. Daran fehle es in der angegriffenen Ausführungsform aufgrund eines abweichenden Herstellungsvorgangs.
Zudem fordere das Klagepatent eine planmäßig erzeugte und eindeutig abgrenzbare Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich. Es bedürfe eines erkennbaren Höhenunterschiedes, der dazu geeignet sei, Fehlausrichtungen der Maske zu verhindern. Denn die erfindungsgemäße Vertiefung solle eine Ausrichtung der Maske am Markenbereich und am Sourcebereich ermöglichen. Die angegriffene Ausführungsform weise demgegenüber lediglich unbeabsichtigte, unwesentliche und unregelmäßige Unebenheiten auf, die dadurch bedingt seien, dass im Herstellungsprozess beim Entfernen der Masken auch das Substrat geringfügig abgetragen werde. Solche geringfügigen Abtragungen würden bei jedem aus dem Stand der Technik bekannten Herstellungsverfahren auftreten. Dies sei gerade nicht das, was die erfindungsgemäße Lehre mit dem Begriff der „Vertiefung“ verlange.
Der hakenförmige Endabschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs müsse geeignet sein, sich mit einer anderen Schicht zu „verhaken“. Dies setze voraus, dass die Biegung nach oben in einem Winkel von maximal 90° erfolge. In der angegriffenen Ausführungsform hingegen sei nur eine minimale Biegung erkennbar; der Winkel betrage annähernd 180°.
Vorsorglich werde mit Nichtwissen bestritten, dass die Abbildungen in der Klageschrift einen Mikrochip der Streithelferin zeigen würden.
Hinsichtlich der Beklagten zu 2) liege im Übrigen schon keine Erstbegehungsgefahr für alle B-Modelle vor. Die Herstellung anderer Modelle als des Modells F in der E stehe nicht unmittelbar bevor. Insbesondere gebe es keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass in der E demnächst das Modell G produziert werden solle.
Den geltend gemachten Ansprüchen auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung stehe zudem der Einwand der Unverhältnismäßigkeit entgegen. Bei den betroffenen Elektrofahrzeugen handele es sich um ein komplexes, aufwändiges und kostenintensives Produkt, bei welchem nur ein Teil von Tausenden angeblich das Klagepatent verletze. Die wirtschaftlichen Folgen einer Unterlassungsverfügung würden ein außergewöhnliches Ausmaß erreichen und seien auch im staatlichen Interesse zu vermeiden, das in dem Erhalt der durch die E geschaffenen Arbeitsplätze und der Förderung klimafreundlicher Technologien zu sehen sei. Jedenfalls aber sei den Beklagten eine Aufbrauch- bzw. Umstellungsfrist einzuräumen. -
Mit Urteil vom 21.07.2023 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
Soweit das Klagepatent im Dotierungsimplantationsbereich eine Vertiefung vorsehe, verstehe es hierunter eine planmäßig vorhandene Aussparung in einem Teilbereich der Oberfläche des Wafers, in der der Sourcebereich angeordnet sei. Die anspruchsgemäße Vertiefung müsse gegenüber anderen Teilbereichen der Vorrichtung deutlich abgrenzbar und gezielt herbeigeführt worden sein. Funktional diene die Vertiefung der Ausrichtung der Maske. Hieraus ergebe sich, dass der Höhenunterschied ausreichend groß sein müsse und nicht jede noch so kleine Unebenheit in der Halbleiteroberfläche genüge.
Im Endbereich der Vertiefung sei zudem erfindungsgemäß ein Abschnitt vorgesehen, der sich hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleitervorrichtung erstrecke. Dies erfordere eine deutliche Verlaufsänderung in Richtung der Halbleiterschicht im Sinne einer nach oben hin gebogenen Form. Konkrete Winkelangaben gebe das Klagepatent nicht vor, entscheidend sei aber, dass es durch den hakenförmigen Abschnitt zu einer räumlich-körperlichen Abgrenzung eines seitlichen Sourcebereichs komme, der sich hin zur Waferoberfläche und weg von der Vertiefung erstrecke. Auf diese Weise begrenze der hakenförmige Abschnitt seitlich die abschnittsweise gebildete Vertiefung und trage zur stabilen Bildung einer Inversionsschicht an der Waferoberfläche bei. Hierdurch werde ein Stromfluss durch die Halbleitervorrichtung ermöglicht und ein stabiler Kanalwiderstand erzeugt.
Es lasse sich nicht feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform eine erfindungsgemäße Vertiefung aufweise, die an ihren Endabschnitten eine hakenförmig nach oben hin gebogene Form habe. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten weise der von ihr als „Vertiefung“ identifizierte Abschnitt lediglich einen Höhenunterschied von 0,05 m auf. Die von der Klägerin als „abgeflachte Hakenstruktur“ bezeichneten Bereiche ließen sich von dem vertieften Bereich nicht klar abgrenzen und seien allenfalls als Erhebung zu beschreiben, die sich fließend mehr in die Breite als in die Höhe erstrecke. -
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klagebegehren weiterverfolgt. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens macht sie insbesondere geltend, das Landgericht habe die objektive Aufgabe des Vorrichtungsanspruchs verkannt und die im Klagepatentanspruch 1 verwendeten Begriffe „Vertiefung“ und „hakenförmig“ fehlerhaft ausgelegt.
Es sei nicht richtig, dass der vom Klagepatent unter Schutz gestellte Vorrichtungsanspruch die objektive Aufgabe lösen solle, Schwankungen der Kanallänge zu unterdrücken. Diese Aufgabe könne nur ein auf ein Herstellungsverfahren gerichteter Anspruch erfüllen. Die objektive Aufgabe der Erfindung des Klagepatents liege in der Verbesserung von Transistoren mit Stufen an der Waferoberfläche. Dies erfolge durch das Vorsehen des hakenförmigen Sourcebereichs.
Das Landgericht habe nicht nur die objektive Aufgabenstellung des Klagepatents verkannt, sondern auch den technischen Hintergrund der Erfindung falsch wiedergegeben. So hänge die Bildung der Gateoxidschicht nicht von einer hakenförmigen Ausgestaltung ab, insbesondere sei die isolierende Gateoxidschicht nicht für die zuverlässige Bildung der Inversionsschicht und damit für den Stromfluss durch die Halbleitervorrichtung verantwortlich. Unbeachtlich sei insofern auch, wie dick die Gateoxidschicht insbesondere oberhalb der Hakenstruktur des Sourcebereichs sei. An der Oberfläche des Sourcebereichs sei es die Aufgabe der Gateoxidschicht, das Gate vom Sourcebereich zu isolieren. Beide Parteien hätten erstinstanzlich übereinstimmend vorgetragen, die Inversionsschicht entstehe an der Oberfläche des Wannenbereichs. Demgegenüber sei das Landgericht fehlerhaft davon ausgegangen, die Inversionsschicht entstehe im Sourcebereich.
Das Klagepatent selbst beschreibe die erfindungsgemäße „Vertiefung“ im Dotierungsimplantationsbereich als einen produktionsbedingten Nachteil, weil der Dotierungsimplantationsbereich ohne weitere Maßnahmen dann nicht mehr bis zur (ehemaligen) Waferoberfläche reiche. Dieser produktionsbedingte Nachteil entstehe nach der Beschreibung des Klagepatents durch den Herstellungsprozess, nämlich insbesondere durch Abtragen von Material an der Waferoberfläche durch Ätzvorgänge im Produktionsvorgang. „Gebildet“ im Sinne des Klagepatents sei eine Vertiefung dann, wenn sie die unmittelbare, nicht aber unbedingt gewünschte Folge eines Herstellungsprozesses sei. Nicht erforderlich sei, dass die Vertiefung einen Beitrag zur Lösung der in der Klagepatentschrift formulierten Aufgabe leiste. Die Vertiefung im Sourcebereich sei lediglich ein unerwünschter Nebeneffekt. Sie diene insbesondere nicht – wie das Landgericht fehlerhaft angenommen habe – der Ausrichtung von Masken. Dies sei allein Aufgabe des Markenbereichs.
Bei richtigem Verständnis des Klagepatents verwirkliche die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale der geltend gemachten Anspruchskombination. Die Vertiefungen seien dort keineswegs einem Zufall geschuldet, sondern gerade Folge des Produktionsprozesses. Insofern sei unstreitig, dass bei dem Entfernen der Maske Material der Waferoberfläche abgetragen werde. Die hierdurch bedingten Nachteile gleiche die angegriffene Ausführungsform in erfindungsgemäßer Weise durch einen hakenförmigen Abschnitt an den Enden des Dotierungsimplantationsbereichs aus. Erst durch diesen führe die Inversionsschicht bei einer Dicke von weniger als 40 bis 50 nm zu einem eingeschalteten Transistor. Der hakenförmige Bereich lasse sich dabei klar von der Vertiefung abgrenzen. -
Die Klägerin macht im Berufungsverfahren – wie auch schon vor dem Landgericht – den Patentanspruch 1 des Klagepatents in einer eingeschränkten Fassung geltend und beantragt (die Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 sind durch Kursivdruck gekennzeichnet),
das angefochtene Urteil abzuändern und wie folgt neu zu fassen:
I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft von bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
eine Halbleitervorrichtung mit einer SiC-Halbleiterschicht, einem Wannenbereich, der selektiv an einer Oberfläche der SiC-Halbleiterschicht gebildet ist, und einem Dotierungsimplantationsbereich, der selektiv an einer Oberfläche des Wannenbereichs gebildet ist, wobei der Dotierungsimplantationsbereich eine Vertiefung aufweist, die in einem Abschnitt von ihm an einer Oberfläche des Dotierungsimplantationsbereichs gebildet ist außer in einem Abschnitt nahe einem Endabschnitt, und der Abschnitt nahe dem Endabschnitt eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin gebogene Form hat, wobei die Halbleitervorrichtung weiterhin umfasst: eine Poly-Si-Gateelektrode, wobei die Poly-Si-Gateelektrode sich bis über den Abschnitt nahe dem Endabschnitt und über die Vertiefung erstreckt;
wobei der Wannenbereich (4) durch Ionenimplantation gebildet ist
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 19.05.2022 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
wobei die geschuldeten Angaben zu I. 2. a) und I. 2. b) sämtliche Lieferungen an den jeweiligen Abnehmer umfassen, unabhängig davon, ob die konkrete Lieferung von diesem Abnehmer auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebracht wurde,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 19.06.2022 begangen hat, und zwar unter Angabe
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung nach der Domain (URL), der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei die geschuldeten Angaben zu I. 3. a) sämtliche Lieferungen an den jeweiligen Abnehmer umfassen, unabhängig davon, ob eine konkrete Lieferung von diesem Abnehmer auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebracht wurde,
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einer von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Nachfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die unter I. 1. bezeichneten, seit dem 19.05.2022 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
5. die im Inland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziffer I. 1. nach ihrer Wahl auf ihre Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 10. Mai 2022 durch die unter I.1. bezeichneten, begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird. -
Die Beklagten und ihre Streithelferin beantragen,
die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 21.07.2023 (Az. 4c O 34/22) zurückzuweisen,
hilfsweise
den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den gegen das Klagepatent (DE 10 2011 123 XXX XX) erhobenen Einspruch, derzeit anhängig beim Europäischen Patentamt, gemäß § 148 ZPO auszusetzen, -
Die Beklagten beantragen,
weiter hilfsweise
den Beklagten ab dem Tag der Verkündung des der Klage stattgebenden Urteils eine Aufbrauch- und Umstellungsfrist von wenigstens 12 Monaten zu gewähren, in der die Beklagten
1. bereits hergestellte, aber noch nicht ausgelieferte und/oder verkaufte Kraftfahrzeuge, die den angegriffenen Microchip enthalten, an Abnehmer ausliefern und
2. bereits bestellte Kraftfahrzeuge, die den angegriffenen Microchip enthalten, herstellen dürfen. -
Die Beklagten und ihre Streithelferin verteidigen das landgerichtliche Urteil und tragen unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags wie folgt vor:
Zutreffend habe das Landgericht die objektive Aufgabe des Klagepatents darin gesehen, einen Aufbau einer Halbleitervorrichtung zur Verfügung zu stellen, der eine Schwankung der Kanallänge unterdrücke. Nicht richtig sei demgegenüber die Auffassung der Klägerin, die objektive Aufgabe des Klagepatentanspruchs 1 sei die Verbesserung von Transistoren mit Stufen an der Waferoberfläche. Figur 16 des Klagepatents gehöre nicht zum Stand der Technik. Dieser werde vielmehr in den Figuren 1 bis 6 veranschaulicht. Dort gebe es gerade keine Stufen an der Waferoberfläche. Auch die Beschreibung erwähne an keiner Stelle, dass vorbekannte Halbleitervorrichtungen Stufen an der Waferoberfläche aufweisen würden. Die Stufen träten vielmehr erst in den Figuren 7 ff. auf, die jedoch bereits Lösungen für das Problem der Schwankung der Kanallänge veranschaulichten. Zur Lösung dieses Problems lehre die erfindungsgemäße Lehre die absichtliche Bildung einer wesentlichen Vertiefung in einem Abschnitt des Sourcebereichs. In dieser Vertiefung liege der Kern der erfindungsgemäßen Lehre und durch sie grenze sich das Klagepatent vom Stand der Technik ab. Durch die Vertiefung entstehe das Folgeproblem, dass die Waferoberfläche „Stufen“ aufweise, aufgrund derer die Inversionsschicht unter Umständen nicht zuverlässig gebildet werden könne. Der Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs sei deshalb untrennbar mit den Verfahren zu seiner Herstellung verknüpft und könne nicht ohne die zu diesen Verfahren gehörige Beschreibung ausgelegt werden.
Eine anspruchsgemäße „Vertiefung“ müsse sich räumlich-körperlich eindeutig von den übrigen Bereichen des Dotierungsimplantationsbereichs abgrenzen lassen und geeignet sein, an ihr Masken auszurichten. Die räumlich-körperliche Abgrenzung der Vertiefung werde anspruchsgemäß auch dadurch gekennzeichnet, dass der Endabschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs in einer Hakenform zur Deckfläche hin gebogen sei und so trennscharf von der Vertiefung abgegrenzt werden könne. Dabei müsse der Abstand der Gate-Elektrode zum Dotierungsimplantationsbereich im Abschnitt der Vertiefung größer sein als im „hakenförmigen Endabschnitt“. Dies zeige sich in der unterschiedlichen Dicke der Gateoxidschicht.
Zutreffend habe das Landgericht erkannt, dass die angegriffene Ausführungsform weder eine Vertiefung noch einen hakenförmigen Endabschnitt aufweise.
Jedenfalls aber sei der Rechtsstreit auszusetzen, da das Europäische Patentamt das Klagepatent widerrufen werde. -
Die Streithelferin der Beklagten macht geltend, dass im erstinstanzlichen Urteil eine Entscheidung zu den Kosten der Nebenintervention fehle. Sie beantragt daher im Wege der Anschlussberufung,
das landgerichtliche Urteil in Ziffer 2. des Tenors abzuändern und wie folgt neu zu fassen:
Die Kosten des Rechtsstreits sowie die Kosten der Nebenintervention werden der Klägerin auferlegt. -
Die Klägerin beantragt,
die Anschlussberufung als unzulässig zu verwerfen. - Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
-
B.
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.
Zu Recht hat das Landgericht eine Verletzung des Klagepatents verneint und die Klage aus diesem Grund abgewiesen. Da die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch macht, stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie auf Schadenersatz aus den §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i.V.m. §§ 242, 259 BGB – den allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen – nicht zu. -
I.
Das Klagepatent betrifft eine Halbleitervorrichtung mit einem Markenbereich und einem Sourcebereich (Anlage K17 Abs. [0001]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift).
Halbleiter sind Materialien, deren elektrische Leitfähigkeit zwischen der von Leitern (wie Metallen) und der von Nichtleitern (wie Glas) liegt. Das bekannteste Beispiel für einen Halbleiter ist Silizium. Silizium hat in seiner Ausgangsform ein relativ stabiles Elektronenvorkommen, welches im Wesentlichen in der Gitterstruktur des Siliziumkristalls gebunden ist. Es ist kein besonders guter Leiter, da es keine hohe Dichte verfügbarer beweglicher Ladungsträger hat. Um die Leitfähigkeit zu verbessern, wird die Siliziumschicht an bestimmten Stellen dotiert. Hierbei werden gezielt Atome im Halbleiter durch Atome eines anderen Elements ersetzt. Den spezifischen Bereich eines Halbleiterwafers, in den Dotierungsatome eingebracht werden, bezeichnet man als Dotierungsimplantationsbereich. Weisen die neuen Atome mehr Elektronen auf als das Halbleitermaterial, spricht man von einer n-Dotierung, weisen sie weniger Elektronen auf, nennt man dies p-Dotierung. Die Dotierung erfolgt unter Verwendung von Masken, die bestimmte Bereiche eines Halbleiterwafers abdecken oder freilegen.
Das Klagepatent schlägt eine Halbleitervorrichtung vor, die Siliziumcarbid verwendet (zu den hier nicht weiter relevanten Vorteilen ggü. Silizium vgl. Abs. [0002]) und verweist zunächst auf verschiedene im Stand der Technik bekannte Verfahren zur Herstellung von Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren, sog. MOSFETs (Abs. [0002]). Der Aufbau eines solchen im Stand der Technik bekannten Feldeffekttransistors ist in der Klagepatentschrift in Figur 1 dargestellt, wobei die Bezugsziffern 1 das N-SiC-Substrat, 2 die n-SiC-Epi-Schicht, 3 den Sourcebereich, 4 den Wannenbereich, 5 den Wannenkontaktbereich, 7 die Gateoxidschicht, 8 die Gatelektrode und 11 die Drainelektrode bezeichnen: - Mit Source (3) und Drain (11) werden die beiden Anschlüsse eines Transistors bezeichnet, durch die der Strom in den Transistor ein- bzw. aus diesem ausfließt. Sie werden durch den nicht leitenden, p-dotierten Wannenbereich (4) voneinander getrennt. Sobald an der Gateelektrode (8) eine Spannung angelegt wird, bewegen sich die freien Elektronen aus den n-dotierten Bereichen Richtung Gate. In der obersten Schicht, die der Gate-Elektrode am nächsten ist, entsteht mit zunehmender Spannung eine immer größere Elektronen-Konzentration. Dies führt an der Oberfläche des Wannenbereichs (4) zu einem leitenden Kanal (in der Figur 1 durch die Kanallänge Lch gekennzeichnet), durch den der Strom von Source (3) zu Drain (11) fließen kann; der Transistor ist eingeschaltet. Der Stromfluss durch den Transistor ist zum besseren Verständnis beispielhaft in der nachfolgenden Abbildung wiedergegeben, die der Klageerwiderung der Streithelferin der Beklagten vom 30.09.2022 (dort S. 13) entnommen ist:
-
Der hellblaue Sourcebereich (n+) und die hellblaue n-Epitaxieschicht sind durch den dunkelblauen Wannenbereich (p+) voneinander getrennt. Dieser Wannenbereich verhindert zunächst den Stromfluss zwischen Source und Drain. Erst wenn am Gate eine Spannung angelegt wird, entsteht in dem Wannenbereich unterhalb der Gateoxidschicht (violett) ein leitender Pfad (grün). Je höher die Spannung am Gate ist, desto dicker wird die leitende Schicht und umso mehr Strom kann von Source (3) nach Drain (11) fließen. Der Bereich, in dem sich die Ladungsträgerkonzentration durch die Gatespannung verändert, nennt man Inversionsschicht.
Eine solche Inversionsschicht wird nur direkt unterhalb der Gate-Elektrode und nur dann zuverlässig gebildet, wenn der Abstand der Gate-Elektrode zum Kanalgebiet über dessen gesamte Breite gleichmäßig ist. Denn die Stärke des Feldes, das durch die Spannung der Gate-Elektrode erzeugt wird, wird mit zunehmendem Abstand von der Gate-Elektrode schwächer. Ist der Abstand zwischen der Gate-Elektrode und dem Kanalgebiet also an bestimmten Stellen größer als an anderen Stellen, wird die Inversionsschicht an den Stellen mit größerem Abstand zur Gate-Elektrode möglicherweise unterbrochen.
Für die elektrische Leistungsfähigkeit des Transistors ist der Kanalwiderstand ein entscheidender Parameter, der wiederum – neben der Dicke der Inversionsschicht – durch die Kanallänge Lch bestimmt wird (Abs. [0003]). Wie in Figur 1 gut zu erkennen ist, wird die Kanallänge Lch maßgeblich bestimmt durch die Positionsbeziehung zwischen dem Sourcebereich 3 und dem Wannenbereich 4 (vgl. auch Abs. [0003]). Diese Positionsbeziehung wiederum hängt davon ab, an welchen Stellen bei der Implantation von Fremdatomen die Masken Öffnungen haben. Sind die verschiedenen Masken bei der Produktion nicht immer genau gleich, sondern leicht zueinander verschoben ausgerichtet, kommt es zu Schwankungen in der Kanallänge, die einer präzisen Steuerung des Chips entgegenstehen. Durch lokale Stromkonzentrationen in der Chipfläche kann ein Chip in einem solchen Fall schlimmstenfalls durchbrechen. Aus diesem Grund sind Schwankungen der Kanallänge Lch unbedingt zu vermeiden (Abs. [0003]).
Bei den im Stand der Technik bekannten Verfahren erfolgte die Ausrichtung der Masken nach den Angaben der Klagepatentschrift anhand eines sog. Markenbereichs, wobei verschiedene Masken benutzt wurden, um zunächst den p-Wannenbereich und im Anschluss den n-Sourcebereich zu bilden (Abs. [0004]). Das Klagepatent beschreibt einen im Stand der Technik bekannten Herstellungsprozess unter Verwendung eines solchen Markenbereichs in ihrem Abs. [0013] und verweist zur Verdeutlichung auf die Figuren 2 bis 6 der Klagepatentschrift. Bei diesem Verfahren wird zu Beginn des Herstellungsprozesses mittels einer ersten Maske ein Markenbereich in die SiC-Schicht geätzt, also die SiC-Schicht in einem nicht maskierten Bereich bis zu einer bestimmten Tiefe entfernt (vgl. Fig. 2). - An diesem Markenbereich werden im weiteren Verlauf nacheinander drei weitere verschiedene Masken ausgerichtet, mittels derer ein Wannenbereich, ein Sourcebereich und ein Wannenkontaktbereich gebildet werden (vgl. Fig. 3 bis 5):
- Anschließend wird auf dieselbe Weise eine Maskenausrichtung basierend auf dem Markenbereich durchgeführt, um einen Elektrodenaufbau zu bilden (Fig. 6):
-
An den bekannten Verfahren kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass durch die Verwendung und Ausrichtung mehrerer Masken jeweils basierend auf dem Markenbereich die Gefahr von Fehlausrichtungen besteht, die wiederum zu großen Schwankungen der Kanallänge Lch führen können (Abs. [0003], [0014]). Vor diesem Hintergrund formuliert die Klagepatentschrift in ihrem Abs. [0006] die Aufgabe, einen Aufbau einer Halbleitervorrichtung, der eine Schwankung der Kanallänge unterdrückt, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung bereitzustellen.
Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 des Klagepatents – in seiner in diesem Rechtsstreit eingeschränkt geltend gemachten Fassung – eine Halbleitervorrichtung mit folgenden Merkmalen vor: -
1. Halbleitervorrichtung mit
1.1 einer SiC-Halbleiterschicht (2),
1.2 einem Wannenbereich (4),
1.3 einem Dotierungsimplantationsbereich (3) und
1.4 einer Poly-Si-Gateelektrode.
2. Der Wannenbereich (4) ist
2.1 selektiv an einer Oberfläche der SiC-Halbleiterschicht (2)
2.2 durch Ionenimplantation
gebildet.
3. Der Dotierungsimplantationsbereich (3)
3.1 ist selektiv an einer Oberfläche des Wannenbereichs (4) gebildet,
3.2 weist eine Vertiefung auf, die in einem Abschnitt von ihm an einer Oberfläche des Dotierungsimplantationsbereichs (3) gebildet ist außer in einem Abschnitt nahe einem Endabschnitt.
3.2.1 Der Abschnitt nahe dem Endabschnitt hat eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht (2) hin gebogene Form.
4. Die Poly-Si-Gateelektrode erstreckt sich bis über den Abschnitt nahe dem Endabschnitt und über die Vertiefung. - Die klagepatentgemäße Erfindung beruht im Kern auf der Idee, den Markenbereich und den Sourcebereich unter Verwendung einer einzigen Maske zu ätzen und die hierdurch entstandenen Vertiefungen als Referenz für die weitere Maskenausrichtung zu nutzen, um so Schwankungen der Kanallänge Lch zu unterdrücken (Abs. [0015]).
-
II.
Die Klägerin kann, was die Beklagten mit Recht nicht in Zweifel ziehen, das Klagepatent im Umfang der vorstehend wiedergegebenen Merkmale geltend machen.
Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass es dem Inhaber eines Gebrauchsmusters freisteht, im Verletzungsstreit einen eingeschränkten Schutz geltend zu machen, selbst wenn er entsprechend beschränkte Schutzansprüche nicht zu den Akten des Gebrauchsmusters eingereicht hat. Die Beschränkung der Verletzungsklage hat zur Folge, dass sich die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Verletzungsrechtsstreit auf das Schutzrecht in seiner geltend gemachten Fassung beschränkt (BGH, GRUR 2003, 867 – Momentanpol I).
Auch im Patentverletzungsrechtsstreit steht es dem Kläger frei, durch entsprechende Formulierung der Klageanträge und des Klagegrundes den Streitgegenstand auf eine eingeschränkte Fassung des Patents zu beschränken (BGH, GRUR 2010, 904 Rn. 47–49 – Maschinensatz; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Auflage 2020, § 14 Rn. 49; Cepl/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage 2022, § 148 Rn. 153). Vor rechtskräftigem Abschluss des Rechtsbestandsverfahrens ist hierfür allerdings Voraussetzung, dass das Klagepatent im Rechtsbestandsverfahren entweder nur mit der eingeschränkten Fassung verteidigt wird oder bei Aufrechterhaltung der erteilten Fassung eine Verurteilung nach einem demgegenüber eingeschränkten Antrag bedenkenlos ist. Gleiches gilt, wenn bei mehreren Hilfsanträgen ein vorrangiger Hilfsantrag zum Erfolg führt, der die Anspruchskombination des Verletzungsprozesses vollständig abdeckt, was der Fall ist, wenn die Hilfsanträge so aufeinander aufbauen, dass jeder nachfolgende Antrag den Merkmalen des vorhergehenden ein weiteres hinzufügt (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Kap. E Rn. 1036).
Nach diesen Grundsätzen kann die Klägerin das Klagepatent im Umfang der vorstehend wiedergegebenen Merkmale geltend machen, weil der im Einspruchsverfahren verteidigte erteilte Patentanspruch 1 die in diesem Rechtsstreit geltend gemachte Anspruchskombination vollständig abdeckt. Durch eine entsprechende Ausgestaltung der Klageanträge und eine auf die beschränkte Fassung gestützte Klagebegründung wird der Streitgegenstand des Verletzungsrechtsstreits auf die Frage beschränkt, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage des Patents in der eingeschränkten Fassung zustehen. Eine solche Klage hat allerdings nur dann Erfolg, wenn die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Patentanspruchs in der geltend gemachten Fassung verwirklicht (BGH, GRUR 2010, 904 Rn. 48 – Maschinensatz). -
III.
Vor dem Hintergrund des Streits der Parteien bedürfen insbesondere die Merkmale 3.2 und 3.2.1 der vorstehenden Merkmalsgliederung näherer Erläuterung. -
1.
Merkmal 3.2 setzt das Vorliegen einer „Vertiefung“ voraus, die in einem Abschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs an einer Oberfläche von ihm gebildet ist.
a)
Der Begriff „Vertiefung“ wird weder in den Patentansprüchen noch in der Patentbeschreibung definiert. Der Wortlaut selbst besagt zunächst einmal nur, dass ein Abschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs tiefer ausgebildet ist als der übrige Bereich des Dotierungsimplantationsbereichs, womit zugleich die Anforderung verbunden ist, dass der vertiefte Abschnitt gegenüber den nicht vertieften Abschnitten des Dotierungsimplantationsbereichs in irgendeiner Weise abgrenzbar ist. Diese Abgrenzbarkeit wird erleichtert durch die Anforderung nach Merkmal 3.2.1, wonach ein Abschnitt am Ende des Dotierungsimplantationsbereichs eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin gebogene Form aufweist. Beide Bereiche – die Vertiefung und der nach oben gebogene Abschnitt – werden vom Klagepatent klar unterschieden und müssen deshalb in der anspruchsgemäßen Vorrichtung voneinander unterscheidbar vorhanden sein. Darüber hinaus enthält der Anspruchswortlaut keine Beschränkung auf eine bestimmte räumlich-körperliche Gestaltung. Insbesondere ergibt sich aus dem Anspruchswortlaut keine Mindesttiefe der Vertiefung. -
b)
Allerdings bleibt der Fachmann – ein Physiker oder Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Schwerpunkt Halbleitertechnik und/oder Mikroelektronik, der über einen Hochschulabschluss und mehrjährige praktische Erfahrung auf dem technischen Gebiet von Halbleitervorrichtungen verfügt (vgl. auch: BPatG, Anlage St11 S. 10, 3. Abs.) – nicht beim Wortlaut des Anspruchs stehen, sondern sucht dessen Wortsinn zu ermitteln. Selbst dann, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder dem Fachverständnis eindeutig zu sein scheint, ist stets eine Auslegung des Patentanspruchs geboten, in der es den technischen Sinngehalt des Patentanspruchs zu ermitteln gilt. Da für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe, sondern deren technischer Sinn maßgeblich ist, wie er sich unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung des Patents objektiv ergibt (vgl. BGH, GRUR 1975, 422, 424 – Streckwalze; GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; GRUR 2021, 574 Rn. 24 – Kranarm), stellt sich der Fachmann vorliegend die Frage, welcher technische Sinn nach der im Patentanspruch 1 niedergelegten und in der Patentbeschreibung erläuterten technischen Lehre damit verbunden ist, dass der Dotierungsimplantationsbereich eine „Vertiefung“ aufweist.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext prinzipiell eine zusammengehörige Einheit bilden, die der Durchschnittsfachmann demgemäß auch als sinnvolles Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widersprüche nicht ergeben (BGH, GRUR 2016, 361 – Fugenband; GRUR 2015, 875 – Rotorelemente; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Auf. 2024, Kap. A Rn. 12). Es verbietet sich, einzelne Merkmale unabhängig vom Gesamtzusammenhang der im Anspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre zu interpretieren. Vielmehr ist stets danach zu fragen, welcher technische Sinn den einzelnen Merkmalen in ihrer Gesamtheit zukommt und welcher Beitrag zum beabsichtigten Leistungsergebnis den einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs zugedacht ist (BGH, GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung; GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum).
Vor diesem Hintergrund darf der Fachmann vorliegend zwar nicht aus dem Blick verlieren, dass es sich bei Patentanspruch 1 um einen Vorrichtungs- und nicht um einen Verfahrensanspruch handelt. Allerdings ist der Vorrichtungsanspruch im Gesamtkontext des Klagepatents auszulegen, insbesondere sind die darin verwendeten Begrifflichkeiten unter Heranziehung der Beschreibung im Gesamtzusammenhang der unter Schutz gestellten technischen Lehre zu interpretieren. -
c)
Zwischen den Parteien besteht vor allem Streit über die Frage, welche objektive Aufgabe die Erfindung gemäß dem Klagepatent löst. Während die Beklagten und ihre Streithelferin die Auffassung vertreten, der unter Schutz gestellte Vorrichtungsanspruch löse – entsprechend der in der Klagepatentschrift angegebenen Aufgabenstellung (Abs. [0003]) – die objektive Aufgabe, Schwankungen in der Kanallänge Lch zu unterdrücken, meint die Klägerin, die objektive Aufgabe der klagepatentgemäßen Erfindung bestehe allein darin, die im Stand der Technik bekannten Feldeffekttransistoren dergestalt zu verbessern, dass eine gleichmäßige Bildung der Inversionsschicht auch dann sichergestellt werde, wenn die Waferoberfläche „Stu-fen“ aufweise. Insofern müsse die anspruchsgemäße Vorrichtung nicht zwingend durch ein in der Klagepatentschrift beschriebenes Verfahren hergestellt sein. Das Vorsehen eines hakenförmig nach oben hin gebogenen Endabschnitts des Dotierungsimplantationsbereichs mache bereits bei kleinsten Unebenheiten in der Waferoberfläche technisch Sinn, weil hierdurch die Leistungsfähigkeit des Transistors verbessert werden könne.
Die Auffassung der Klägerin überzeugt nicht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestimmt sich das von einer Schutzrechtslehre gelöste Problem danach, was die Erfindung objektiv leistet (vgl. BGH, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2011, 607 Rn. 12 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III GRUR 2012, 1130 Rn. 9 – Leflunomid; GRUR 2012, 1123 Rn. 22 – Palettenbehälter III; GRUR 2015, 352 Rn. 11 – Quetiapin; GRUR 2018, 390 Rn. 32 – Wärmeenergieverwaltung). Dies ist wiederum durch Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu entwickeln. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. In der Beschreibung enthaltene Angaben zur Aufgabenstellung können einen Hinweis auf das richtige Verständnis enthalten, entheben aber nicht davon, den Patentanspruch anhand der dafür maßgeblichen Kriterien auszulegen und aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen; auch eine in der Patentschrift angegebene Aufgabe stellt insoweit lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems dar. Die hiernach gebotene Auslegung ergibt im Streitfall, dass dem Klagepatentanspruch 1 – wie in Abs. [0006] angegeben – objektiv die Aufgabe zugrunde liegt, eine Halbleitervorrichtung mit einem Aufbau zur Verfügung zu stellen, der im Rahmen der Herstellung Schwankungen der Kanallänge unterdrückt.
So bezeichnet es die Klagepatentschrift bereits einleitend in Abs. [0003] als „bedeutendes Problem“, wie die Kanallänge Lch präzise gesteuert werden kann. Im An-schluss werden im Stand der Technik bekannte Verfahren zum Herstellen eines MOSFETs beschrieben (Abs. [0004]) und später anhand der Figuren 2 bis 6 näher erläutert (Abs. [0012] ff.). Hieran kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass durch die Verwendung und Ausrichtung mehrerer Masken jeweils basierend auf einem Markenbereich insbesondere bei der Bildung des p-Wannenbereichs und des Sourcebereichs die Gefahr von Fehlausrichtungen besteht. Die Klagepatentschrift beschreibt, dass diese Fehlausrichtungen Schwankungen der Kanallänge Lch und hierdurch bedingt lokale Stromkonzentrationen verursachen können, die schlimmstenfalls dazu führen können, dass der Chip durchbricht (Abs. [0003], [0014]). Solche nachteiligen Schwankungen der Kanallänge Lch will das Klagepatent vermeiden. Es bezeichnet es in Abs. [0006] als Aufgabe der Erfindung, einen Aufbau einer Halbleitervorrichtung, der eine Schwankung der Kanallänge unterdrückt, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung bereitzustellen. Diese Aufgabe wird ausweislich Abs. [0007] der Klagepatentschrift ausdrücklich gelöst durch eine Halbleitervorrichtung gemäß Anspruch 1.
Die so formulierte subjektive Aufgabe stellt zugleich auch die objektive Aufgabe des Klagepatents dar (genauso im Hinblick auf die DE ´XXX unter Verweis auf die dortigen Abs. [0006] und [0039] bis [0042] auch das BPatG in seinem Urteil vom 29.02.2024, Anlage St11 S. 19, 1. Abs.). Die Beschreibung erläutert die anspruchsgemäße Vorrichtung gerade auch anhand der Verfahren zu ihrer Herstellung, wozu sie etwa in den Figuren 7 bis 40 Vorrichtungen in unterschiedlichen Stadien der Herstellung zeigt.
Der Klagepatentbeschreibung entnimmt der Fachmann, dass die Kernidee des Klagepatents darin besteht, einen Markenbereich und einen Sourcebereich unter Verwendung einer einzigen Maske zu ätzen, und nachfolgende Maskenausrichtungen basierend auf einem geätzten Abschnitt des Markenbereichs oder des Sourcebereichs durchzuführen, um auf diese Weise eine Schwankung der Kanallänge Lch zu unterdrücken. Diese Idee durchzieht die Klagepatentschrift wie ein „roter Faden“. So heißt es beispielsweise in den nachfolgend zitierten Beschreibungsstellen: - „[0015] Daher werden bei einem Vorgang zum Herstellen eines MOSFET, der eine A, ein Markenbereich und ein Sourcebereich Fig. 3 unter Verwendung einer einzigen Maske geätzt, und nachfolgende Maskenausrichtungen werden durchgeführt basierend auf einem geätzten Abschnitt des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 (da die Größe der Maskenfehlausrichtung zwischen dem Markenbereich und dem Sourcebereich 3 Null ist, kann der Markenbereich oder der Sourcebereich 3 als Referenz dienen). Auf diese Weise wird eine Schwankung der Kanallänge Lch unterdrückt“
- „[0016] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden der Markenbereich und der Sourcebereich 3 gleichzeitig geformt durch Durchführen von Ätzen und Ionenimplantation unter Verwendung einer einzigen Maske, und daher ist ein geätzter Abschnitt des Sourcebereichs 3 ohne eine Fehlausrichtung gegenüber dem Referenzmarkenbereich gebildet. Wenn bei nachfolgenden Sourcebildungsschritten eine Maskenausrichtung durchgeführt wird unter Verwendung des geätzten Abschnitts des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3, kann eine Schwankung der Kanallänge Lch unterdrückt werden, weil der Sourcebereich 3 ohne Fehlausrichtung gegenüber dem Markenbereich gebildet ist.“
- „[0022] Durch gleichzeitiges Ätzen der Bereiche, in denen der Markenbereich und der Sourcebereich 3 gebildet werden sollen, kann verglichen mit dem Fall, in dem der Markenbereich und der Sourcebereich 3 getrennt gebildet werden, die Anzahl von Schritten verringert werden, und der Herstellungsvorgang kann vereinfacht werden. Demzufolge kann eine Arbeitszeitdauer verkürzt werden, und Kosten können verringert werden. Außerdem braucht durch das gleichzeitige Bilden des Markenbereichs und des Sourcebereichs 3 eine Maskenfehlausrichtung des Sourcebereichs 3 relativ zu einer Markenreferenz nicht in Betracht gezogen zu werden, und eine Positionsgenauigkeit des Sourcebereichs 3 relativ zu dem Wannenbereich 4 ist stark verbessert. Das kann eine Schwankung der Kanallänge Lch auf einen Minimalwert unterdrücken, und die Qualität eines Chips kann verbessert sein, weil verhindert werden kann, dass der Chip durch eine Stromkonzentration durchbricht, die durch eine Schwankung des EIN-Widerstands bewirkt wird.“
- „[0035] Durch Durchführen des Ätzens für den Sourcebereich 3 und den Markenbereich unter Verwendung der einzigen Maske kann der Sourcebereich 3 ohne eine Fehlausrichtung relativ zu dem Markenbereich gebildet werden, und daher kann eine Schwankung der Kanallänge unterdrückt werden. …“
-
Zur Lösung der in der Klagepatentschrift angegebenen Aufgabe beschreibt diese ein mögliches Verfahren zur Herstellung der unter Schutz gestellten Vorrichtung und erläutert dieses anhand der Figuren 7 bis 11.
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 7 der Klagepatentschrift zeigt beispielhaft, wie zunächst unter Verwendung einer einzigen Maske (30) sowohl der Markenbereich als auch der Sourcebereich auf der SiC-Halbleiterschicht geätzt werden, so dass zwei (gleich tiefe) Vertiefungen entstehen (vgl. auch Abs. ]0017]): - Unter Verwendung derselben Maske (30) wird dann außerdem der Sourcebereich (3) implantiert, wie in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 8 zu erkennen ist (vgl. auch Abs. [0018]):
- Im nächsten Schritt wird eine zweite Maske (31) verwendet, um den p-Wannenbereich (4) zu implantieren, wobei diese Maske (31) an dem Markenbereich und/oder dem Sourcebereich ausgerichtet werden kann, vgl. die nachfolgend wiedergegebene Figur 9 der Klagepatentschrift (vgl. auch Abs. [0019]):
- Im letzten Schritt wird mittels einer dritten Maske (32) ein Wannenkontaktbereich (5) implantiert, wie aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 10 ersichtlich ist (vgl. auch Abs. [0020]):
-
Durch diese Maßnahmen, welche jeweils das Ätzen von Bereichen der SiC-Halbleiterschicht, die als Dotierungsimplantationsbereich und als Markenbereich dienen, unter Verwendung einer einzigen Maske zum Bilden von Vertiefungen beinhalten, kann bei der Herstellung der A eine Schwankung der Kanallänge Lch (auf einen Minimalwert) unterdrückt werden. Die Qualität des Chips kann so verbessert werden, weil verhindert wird, dass der (fertige) Chip durch eine lokale Stromkonzentration durchbrechen kann (Abs. [0015]).
Hinsichtlich der beanspruchten A kommt es zwar nicht darauf an, ob im Rahmen ihrer Herstellung tatsächlich eine einzige Maske für das Ätzen des Marken- und des Sourcebereichs sowie das anschließende oder vorherige Implantieren des Sourcebereichs verwendet worden ist. Ebenso kommt es nicht darauf an, ob die im Anspruch erwähnte Vertiefung durch Ätzen erzeugt worden ist. Denn es handelt sich hierbei um Herstellungsschritte, welche in dem unter Schutz gestellten Vorrichtungsanspruchs keinen Niederschlag gefunden haben. Dieser ist auf eine (fertiggestellte) A gerichtet und beschreibt keine Herstellungsschritte, d.h. er weist keine entsprechenden Verfahrensmerkmale auf. Der Vorrichtungsanspruch setzt aber die im Rahmen der vorgeschlagenen Herstellungsprozesse zu bildende Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich gegenständlich voraus, welche bei der Herstellung der Vorrichtung zum Positionieren einer Maske und damit als Referenz für eine Maskenausrichtung dienen kann. Diese Vertiefung ist in der unter Schutz gestellten Halbleitervorrichtung weiterhin vorhanden und erkennbar; sie wird in Merkmal 3.2 explizit genannt.
Der vom Klagepatent vorgeschlagene, in den Figuren 7 bis 11 sowie 12 bis 16 dargestellte Herstellungsprozess führt – worauf die Klagepatentschrift ausdrücklich hinweist (vgl. Abs. [0026], [0027]) – zu einem „Folgeproblem“. Wird nämlich der Sourcebereich unter Verwendung nur einer einzigen Maske geätzt und implantiert, so befindet sich der gesamte Sourcebereich unterhalb der durch die Ätzung erzeugten Vertiefung. Dies hat zur Folge, dass die Gateoxidschicht im letzten Herstellungsschritt nicht nur auf der SiC-Halbleiterschicht, sondern auch auf einer Seitenfläche der Vertiefung gebildet wird (Abs. [0026]). Wird nun der Kanal entlang der (hakenförmigen) Gateoxidschicht (7) gebildet, führt dies nach den Angaben der Klagepatentschrift zu einem instabilen Kanalwiderstand, weil die Dicke der Gateoxidschicht (7) nicht gleichmäßig ist, sondern sich ändert (Abs. [0027]). Im Bereich des vertieften Abschnitts, in dem die Gateoxidschicht dicker ist, ist der Abstand des Kanalgebiets zur Gateelektrode größer als in dem nicht vertieften Endabschnitt des Wannenbereichs. Die Inversionsschicht bildet sich nur entlang der Oberfläche des p-dotierten Wannenbereichs und kann keine (elektrisch leitende) Verbindung zwischen dem Sourcebereich und der n-Sic-Epi-Schicht herstellen. Dies ist anschaulich in Figur 16 der Klagepatentschrift dargestellt, die nachfolgend ausschnittsweise in einer seitens der Streithelferin der Beklagten kolorierten und mit zusätzlichen Beschriftungen versehenen Fassung wiedergegeben wird (Klageerwiderung vom 30.09.2022, S. 21): -
Die Spannung am Gate ist hier zwar groß genug, um eine Inversionsschicht (grün) an der Oberfläche des nicht leitenden, p-dotierten Wannenbereichs zu bilden, diese Inversionsschicht ist aber – infolge des gegenüber der Oberfläche des Wannenbereichs in einer „Vertiefung“ gebildeten Sourcebereichs – nicht dick genug, um einen leitenden Kanal zwischen dem n-dotierten Sourcebereich (hellblau innen) und den n-dotierten, leitenden Bereichen des Wafers (hellblau außen) zu erzeugen. Eine entsprechend dicke Inversionsschicht, die die entstandene „Stufe“ zu überbrücken vermag, kann nur durch eine höhere Spannung erzielt werden.
Um das in Figur 16 gezeigte (Folge-)Problem zu lösen, schlägt das Klagepatent vor, den Sourcebereich (3) auch in einem Abschnitt der SiC-Epi-Schicht (2) an der Seitenfläche der Vertiefung zu bilden (Abs. [0029]). Der Abschnitt nahe dem Ende des Dotierungsimplantationsbereichs hat dabei in der anspruchsgemäßen Vorrichtung eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin gebogene Form (Merkmal 3.2.1). Durch diese veränderte Form des Sourcebereichs wird es ermöglicht, dass die an der Oberfläche des Wannenbereichs (dunkelblau) gebildete Inversionsschicht auch schon bei einer geringeren Dicke den Source- mit dem Drain-bereich verbindet (Abs. [0033]), weil das obere Ende des im Endabschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs ausgebildeten hakenförmigen Sourcebereichs auf einer Ebene mit der Oberfläche des Wannenbereichs liegt. Dies ist in Figur 22 erkennbar, die nachfolgend ausschnittsweise in einer seitens der Streithelferin kolorierten und zusätzlich beschrifteten Fassung wiedergegeben wird (Klageerwiderung vom 30.09.2022, S. 23 vgl. auch Figur 28): -
Durch das Merkmal 3.2.1 bzw. (genauer) durch die Kombination der Merkmale 3.2 und 3.2.1 wird somit erreicht, dass der dickere Bereich der Gateoxidschicht (7) nicht direkt an den p-Wannenbereich (4) angrenzt, sondern durch den nach oben gerichteten hakenförmigen Abschnitt des Dotierimplantationsbereichs von ihm beabstandet ist, was eine stabile und nicht schwankende Ausbildung der Inversionsschicht an der Waferoberfläche in der p-Wanne (4) unter dem Gateoxid (7) gewährleistet (Abs. [0028], [0029] und [0033]).
Das Klagepatent beschreibt das entsprechend angepasste Herstellungsverfahren in den Abs. [0030] bis [0032] mit Illustrationen in den Figuren 17 bis 22. Die Implantierung des Sourcebereichs erfolgt hierbei nicht ausschließlich senkrecht in der geätzten Vertiefung, sondern auch schräg, so dass der Sourcebereich auch an den Seitenflächen der geätzten Vertiefung implantiert wird. Dies ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 18 und 19 bildlich dargestellt: -
Erforderlich wird diese schräge Implantierung des Sourcebereichs erst dadurch, dass durch das gleichzeitige Ätzen der Bereiche, in denen der Markenbereich und der Sourcebereich gebildet werden sollen, im Dotierungsimplantationsbereich eine solche Vertiefung entsteht, die die gleichmäßige Bildung einer Inversionsschicht an der Oberfläche des Wannenbereichs behindert. In der Klagepatentschrift finden sich hingegen weder Hinweise darauf, dass auch vorbekannte Halbleiter „Stufungen“ aufgewiesen hätten, die die gleichmäßige Bildung einer Inversionsschicht an der Oberfläche des Wannenbereichs behindert hätten, noch bietet die Patentbeschreibung Anhaltspunkte dafür, dass solche Stufen auch anders als durch das im Klagepatent beschriebene Herstellungsverfahren entstehen könnten. In Abgrenzung zu dem erörterten Stand der Technik befasst sich die Klagepatentschrift vielmehr ausschließlich mit dem Problem, Schwankungen in der Kanallänge zu unterdrücken (vgl. Abs. [0006]). Die von der Klägerin in diesem Zusammenhang in Bezug genommene Figur 16 stellt keinen Stand der Technik dar, von dem das Klagepatent ausgeht. Diesen veranschaulicht die Klagepatentschrift vielmehr in den Figuren 1 bis 6. Soweit die Streithelferin der Beklagten zuletzt zur Figur 6 der Klagepatentschrift ausgeführt hat, dass bei dieser der Oberflächenbereich nicht komplett eben sei, sondern einen kurzen Abschnitt aufweise, der unterhalb der Waferoberfläche liege und somit nach der weiten Auslegung der Klägerin eine „Vertiefung“ wäre (Schriftsatz v. 13.08.2024, S. 6), steht dies der vorstehenden Beurteilung nicht entgegen. Zum einen handelt es sich bei der Figur 6 bloß um eine schematische Darstellung. Solche schematischen Darstellungen, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden sind, offenbaren in der Regel nur das Prinzip der betreffenden Vorrichtung, nicht aber exakte Abmessungen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1242 Rn. 9 – Steckverbindung; GRUR 2015, 365 Rn. 27 – Zwangsmischer; Urt. v. 20.03.2014 – X ZR 128/12, BeckRS 2014, 10780 Rn. 31). Zum anderen lässt sich in dieser schematischen Darstellung eine „Unebenheit“ allenfalls bei eingehender Betrachtung – quasi mit der Lupe – ausmachen. Jedenfalls lässt die Figur 6 auch nach dem Vorbringen der Streithelferin der Beklagten keine deutliche „Stufung“ erkennen.
Erst durch den Umstand, dass bei der Lösung der in der Klagepatentschrift formulierten Aufgabe (deutliche) Stufen in der Waferoberfläche entstehen, wird es überhaupt erforderlich, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die trotz dieser Stufen die Bildung einer gleichmäßigen Inversionsschicht an der Waferoberfläche gewährleisten, mittels derer eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Source und Drain vermittelt wird (vgl. Abs. [0029]: „Um diese Probleme zu lösen…“). Hierin liegt aber nicht die eigentliche Aufgabe des Klagepatents; diese besteht vielmehr in der Unterdrückung von Schwankungen in der Kanallänge.
Soweit die Klägerin hiergegen einwendet, für die fertige Halbleitervorrichtung könne das Vermeiden von Produktionsungenauigkeiten nicht den Kern der Erfindung darstellen, weil der Aufbau einer einzelnen Halbleitervorrichtung schon im Ansatz nicht geeignet sei, Abweichungen des Parameters Kanallänge zwischen verschiedenen im Produktionsprozess hergestellten Halbleitervorrichtungen zu vermeiden, überzeugt dies nicht. In der fertigen Halbleitervorrichtung hat der Kanal zwar eine bestimmte Länge. Diese ist nicht mehr beeinflussbar. Eine einzelne Halbleitervorrichtung kann aber durchaus einen Aufbau aufweisen, der geeignet ist, eine festgelegte Kanallänge sicher bereitzustellen, wodurch dann wiederum bei der Herstellung Schwankungen der Kanallänge im Vergleich mehrerer Halbleitervorrichtungen unterdrückt werden können. Hierdurch kann die Qualität eines Chips und damit der hergestellten Vorrichtung verbessert werden, weil verhindert werden kann, dass der Chip durch das Auftreten von lokalen Stromkonzentrationen durchbricht (Abs. [0003], [0015]). Dem Patentanspruch 1 liegt insoweit objektiv die Aufgabe zugrunde, eine Halbleitervorrichtung mit einem Aufbau zur Verfügung zu stellen, der im Rahmen der Herstellung Schwankungen der Kanallänge aufgrund einer Maskenfehlausrichtung unterdrückt. -
d)
Unter Berücksichtigung des vorstehend geschilderten technischen Hintergrunds der klagepatentgemäßen Erfindung erkennt der Fachmann, dass eine anspruchsgemäße Vertiefung räumlich-körperlich dergestalt ausgebildet sein muss, dass sie objektiv geeignet ist, im Herstellungsverfahren verwendeten Masken zuverlässig Orientierung bei der Ausrichtung zu geben, um solchermaßen Fehlausrichtungen zu vermeiden.
Dass die Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich im Rahmen der Herstellung der Vorrichtung eben hierfür dient, ergibt sich aus der das Herstellungsverfahren betreffenden allgemeinen Patentbeschreibung. So heißt es z.B. in den nachfolgend zitierten Beschreibungsstellen: - „[0015] Daher werden bei einem Vorgang zum Herstellen eines MOSFET, der eine A gemäß der vorliegenden Erfindung ist, ein Markenbereich und ein Sourcebereich 3 unter Verwendung einer einzigen Maske geätzt, und nachfolgende Maskenausrichtungen werden durchgeführt basierend auf einem geätzten Abschnitt des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 (da die Größe der Maskenfehlausrichtung zwischen dem Markenbereich und dem Sourcebereich 3 Null ist, kann der Markenbereich oder der Sourcebereich 3 als Referenz dienen). Auf diese Weise wird eine Schwankung der Kanallänge Lch unterdrückt.“
- „[0016] … Wenn bei nachfolgenden Sourcebildungsschritten eine Maskenausrichtung durchgeführt wird unter Verwendung des geätzten Abschnitts des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3, kann eine Schwankung der Kanallänge Lch unterdrückt werden, weil der Sourcebereich 3 ohne Fehlausrichtung gegenüber dem Markenbereich gebildet ist.“
- „[0019] Dann werden Al (Aluminium) oder B (Bor) ionenimplantiert unter Verwendung einer p-Wannen-Implantationsmaske 31, die basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 ausgerichtet wird, um einen p-Wannenbereich 4 zu bilden, der eine Tiefe von 1,0 µm aufweist (Fig. 9). …“
- „[0020] Anschließend wird unter Verwendung einer Wannenkontaktimplantationsmaske 32, die basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 ausgerichtet ist, Al oder B ionenimplantiert, um einen Wannenkontaktbereich 5 in der Mitte des Sourcebereichs 3 zu bilden (Fig. 10). …“
- „[0024]. … Zusätzlich wird unter erneuter Verwendung derselben Maske 30 ein Ätzen durchgeführt, um eine Vertiefung zu bilden (Fig. 13). Dann werden ähnlich dem oben mit Bezug auf Fig. 7-11 beschriebene Vorgang der p-Wannenbereich 4 (Fig. 14) und der Wannenkontaktbereich 5 (Fig. 15) gebildet basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3. …“
- „[0032] Dann wird Al oder B ionenimplantiert unter Verwendung einer p-Wannenimplantationsmaske 31, die basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 ausgerichtet ist, um einen p-Wannenbereich 4 mit einer Tiefe von 1,0 µm zu bilden (Fig. 20). In einem nachfolgenden Schritt wird ähnlich wie in dem in Fig. 10 gezeigten Schritt der Wannenkontaktbereich 5 gebildet unter Verwendung einer Wannenkontaktimplantationsmaske 32, die basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3 ausgerichtet ist (Fig. 21).“
- „[0034] … und (c) Ausrichten einer weiteren Maske basierend auf zumindest der Vertiefung, die als Dotierungsimplantationsbereich dient, und Durchführen einer Wannenimplantation in einem Bereich, der den Dotierungsimplantationsbereich enthält.“
- „[0039] Dann wird unter Wiederverwendung derselben Maske 30 Ätzen durchgeführt, um eine Vertiefung zu bilden (Fig. 25). Anschließend werden ähnlich den mit Bezug auf Fig. 14 und Fig. 15 beschriebenen Schritten der p-Wannenbereich 4 (Fig. 26) und der Wannenkontaktbereich 5 (Fig. 27) gebildet basierend auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs 3. …“
-
Auch wenn der Fokus der Erfindung auf der Verwendung einer einzigen Maske für das Ätzen des Markenbereichs und des Sourcebereichs liegt, um dergestalt sicher eine Maskenfehlausrichtung zwischen den beiden vorgenannten Bereichen auszuschließen (vgl. Abs. [0027]), geht die Klagepatentschrift im Weiteren davon aus, dass aufgrund des gemeinsamen Ätzens und der dabei entstehenden Vertiefungen zur Bildung sowohl des Marken- als auch des Sourcebereichs in der Folge sowohl der Marken- als auch der Sourcebereich als Referenz für die Ausrichtung weiterer Masken verwendet werden können (vgl. Abs. [0028]). Der angesprochene Fachmann schließt hieraus, dass eine patentgemäße Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich (d.h. im Sourcebereich) räumlich-körperlich so ausgebildet sein muss, dass sie objektiv geeignet ist, im Herstellungsverfahren als (zuverlässige) Referenz für eine Maskenausrichtung zu dienen. Insofern soll die anspruchsgemäße Vertiefung dieselbe Eignung haben wie der aus dem Stand der Technik bekannte Markenbereich.
Soweit die Klägerin demgegenüber geltend macht, technisch-funktional sei ein zweiter Markenbereich nicht erforderlich und die weiteren Masken könnten nach der erfindungsgemäßen Lehre entweder am Markenbereich oder an der Vertiefung des Sourcebereichs ausgerichtet werden (vgl. Abs. [0015], [0016], [0019], [0020], [0024], [0032], [0039]), steht dies nicht der Annahme entgegen, dass die anspruchsgemäße Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich (Sourcebereich) objektiv geeignet sein muss, an ihr Masken auszurichten. Ob die Vertiefung im Dotierungsimplantationsbereich hierzu im Herstellungsverfahren tatsächlich genutzt wird, ist nach der erfindungsgemäßen Lehre zwar optional, nicht optional ist aber die räumlich-körperliche Gestaltung der anspruchsgemäßen Vertiefung, die die objektive Eignung begründet. Dazu gehören insbesondere klar definierte Grenzen und eine gewisse Mindesttiefe. Soweit es im Klagepatent heißt, dass die Maske basierend „auf der Vertiefung des Markenbereichs oder des Sourcebereichs“ ausgerichtet wird, versteht der Fachmann dies mithin dahin, dass beide Vertiefungen für die Positionierung/Ausrichtung einer Maske geeignet sind.
In der Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung benennt die Klagepatentschrift beispielhaft Vertiefungen von 0,2 m, die in einem Wannenbereich mit einer Tiefe von 1,0 m gebildet werden (Abs. [0017], [0019], [0031], [0032]). Der implantierte Sourcebereich weist in diesem Fall eine Tiefe von 0,4 m auf. Auf diese Werte ist die erfindungsgemäße Lehre mangels ihrer konkreten Benennung im Anspruch zwar nicht beschränkt, sie vermitteln dem Fachmann aber zumindest Anhaltspunkte dafür, welche Höhenunterschiede in dem hier relevanten technischen Umfeld funktional von Bedeutung sind. Von diesem Verständnis geht prinzipiell auch das BPatG in seinem Urteil vom 29.02.2024 zur DE ´XXX (Anlage St11 S. 18/19) aus, wenn es im Hinblick auf die NK 7 ausführt, eine Vertiefung von 0,1 bis 0,2 m stimme mit der Lehre des Klagepatents überein. Auch wenn im Patentanspruch selbst keine Mindesttiefe der Vertiefung angegeben ist, liefert der in der Beschreibung angegebene Tiefenwert dem Fachmann insoweit doch eine gewisse Orientierung.
Soweit das BPatG in seinem das parallele Patent DE ´XXX betreffenden Urteil (Anlage St11 S. 22) Vertiefungen im Bereich von (lediglich) 10 bis 20 nm (entspricht 0,01 bis 0,02 m) als vom Schutzbereich des Klagepatents umfasst angesehen hat, betrifft diese Einschätzung zum einen nicht das Klagepatent, zum anderen ist die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ohnehin Rechtserkenntnis und vom Verletzungsgericht eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, GRUR 2015, 972 Rn. 20 – Kreuzgestänge, m.w.N.; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – 2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 76 – Rohrbearbeitungsvorrichtung). In seinem Urteil vom 29.02.2024 äußert sich das BPatG weder im Detail zu dem aus seiner Sicht zutreffenden räumlich-körperlichen Verständnis des Begriffs der Vertiefung, noch finden sich dort Ausführungen zum technischen Hintergrund der Merkmale 3.2 und 3.2.1. Das BPatG argumentiert ausschließlich mit dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 der DE ´XXX, der – ebenso wie der Wortlaut des hier geltend gemachten Patentanspruchs 1 des Klagepatents – keine Beschränkung auf eine bestimmte Mindesttiefe der anspruchsgemäßen Vertiefung enthält. Mit dem technisch-funktionalen Sinngehalt des Merkmals setzt sich das BPatG nicht näher auseinander.
Die Ausführungen des BPatG geben vor diesem Hintergrund keinen Anlass, jede noch so kleine Unebenheit in der Waferoberfläche als vom Schutzbereich des Klagepatents umfasst anzusehen. Die Klagepatentschrift selbst enthält keine Anhaltspunkte dafür, dass schon „Vertiefungen“ mit einer Tiefe von z.B. 10 bis 20 nm ausreichend sind. Insbesondere ist der Patentschrift nicht zu entnehmen, dass bereits derartige geringe „Vertiefungen“ (Unebenheiten) objektiv geeignet sind, als Referenz für eine Maskenausrichtung in einem fotomechanischen Prozess zu dienen.
Soweit die Klägerin geltend macht, dass aufgrund abnehmender Toleranzen im Fertigungsbereich durch zunehmenden technischen Fortschritt heutzutage geringere Abweichungen von Relevanz seien, kann es hierauf im Rahmen der Auslegung des Begriffs der Vertiefung nicht ankommen. Denn bei der Auslegung eines Patentanspruchs ist grundsätzlich danach zu fragen, wie der Durchschnittsfachmann im Patentanspruch enthaltene Begriffe am Anmelde- bzw. (bei in Anspruch genommenem Zeitrang) Prioritätstag des Klagepatents verstanden hat. Erkenntnisse, die erst später in die Fachwelt gedrungen sind, haben grundsätzlich außer Betracht zu bleiben (Senat, GRUR-Prax 2024, 103 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Auflage, Kap. A Rn. 144; vgl. auch die ausführliche Darstellung von Schröler, Mitt 2019, 386 ff. m.w.N.). Eine im Laufe der Zeit eintretende Veränderung, beispielsweise durch das Auffinden besserer Produktionsverfahren, darf weder zu einer Einschränkung noch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen; denn ein sich über die Zeit verändernder Schutzbereich wäre mit dem Gebot der Rechtssicherheit nicht vereinbar (Senat, GRUR-Prax 2024, 103 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid; vgl. auch: Senat, Urt. v. 29.07.2010, I-2 U 139/09, Rn. 17 – Traktionshilfe; LG Düsseldorf, Urt. v. 22.01.2015, 4c O 16/14, Rn. 142 ff, zitiert nach juris). Im Übrigen zeigt die Klägerin auch nicht auf, dass infolge des technischen Fortschritts heute bereits „Vertiefungen“ mit einer Tiefe im Bereich von 10 bis 20 nm oder z.B. auch bis zu 50 nm für eine zuverlässige Maskenausrichtung ausreichen. -
2.
In Merkmal 3.2.1 beansprucht der Klagepatentanspruch 1 einen Abschnitt, der nahe dem Endabschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin gebogene Form aufweist. Dieser Abschnitt schließt sich unmittelbar an die erfindungsgemäße Vertiefung gemäß Merkmal 3.2 an und wirkt räumlich-körperlich in dem Sinne mit dieser zusammen, dass sich an den vertieften Bereich ein Abschnitt anschließt, der sich von der Vertiefung ausgehend wieder zur Oberfläche hin „erhebt“. Dabei ist für die anspruchsgemäße „Biegung“ zur Oberfläche hin ein konkreter Winkel nicht vorgegeben. Der Klagepatentanspruch 1 verlangt allerdings über die gebogene Form hinausgehend eine „Hakenform“. Das setzt – entgegen der Auffassung der Beklagten – zwar nicht unbedingt voraus, dass der nach oben zur Waferoberfläche gerichtete Abschnitt in einem Winkel von bis zu 90° von der Vertiefung abknickt. Bei dem in Figur 22 dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Ende des Dotierungsimplantationsbereichs (3) zwar senkrecht nach oben geführt, so dass die gebogene Form im Querschnitt L-förmig ist (nachfolgend wird eine seitens der Streithelferin der Beklagten kolorierten Fassung wiedergegeben, in der der hakenförmig gebogene Abschnitt rot umrandet ist, vgl. Klageerwiderung vom 30.09.2022, S. 44): - Bei der in dieser Figur gezeigten Ausführungsform handelt es sich aber nur um ein Ausführungsbeispiel, auf das die Lehre des Klagepatents nicht beschränkt werden kann. Schon die nachfolgend wiedergegebene Figur 34 (und ebenso auch Figur 40) verdeutlicht, dass der hakenförmig gebogene Abschnitt auch deutlich flacher ausgestaltet sein kann (nachfolgend wiedergegeben ist zum besseren Verständnis eine von der Klägerin kolorierte Fassung von Figur 34, in der der Sourcebereich grün und der Wannenbereich lila eingefärbt sind):
-
Auch in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 34 lässt sich der gebogene Abschnitt aber klar von dem vertieften Bereich abgrenzen; der Winkel, in dem der gebogene Abschnitt von der Vertiefung abknickt, ist deutlich ungleich 180°, nämlich ca. 135°. Demgemäß stellt auch die Klägerin in ihrer Replik vom 10.02.2023 (dort S. 14) auf einen Winkel von 45° ab, womit sie den Supplementärwinkel zu 135° bezeichnet.
Nach der Lehre des Klagepatents erforderlich ist folglich, dass der nach oben zur Waferoberfläche hin gerichtete Abschnitt deutlich abgrenzbar ist zu der sich parallel zur Waferoberfläche erstreckenden Vertiefung und damit in einem Winkel deutlich ungleich 180° von der Vertiefung abknickt. Dabei muss er zudem eine gewisse Mindestlänge aufweisen, die ihn als Haken erkenntlich macht und eine horizontale Begrenzung schafft.
Hierin zeigt sich wiederum das Zusammenspiel der Merkmale 3.2 und 3.2.1: Nur wenn eine anspruchsgemäße Vertiefung gemäß Merkmal 3.2 an einer Oberfläche des Wannenbereichs gebildet ist, bedarf es funktional eines Abschnitts, der sich von dieser Vertiefung ausgehend hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin erstreckt und auf diese Weise – trotz der vorhandenen Vertiefung – für eine elektrische Verbindung zwischen Source und Drain sorgt, wenn an der Oberfläche des Wannenbereichs eine Inversionsschicht gebildet wird. Weist die Vertiefung anspruchsgemäß eine gewisse Mindesttiefe auf (s.o.), geht hiermit zwingend einher, dass sich der hakenförmig gebogene Abschnitt in einem (Abknick-) Winkel von deutlich ungleich 180° nach oben zur Deckfläche der Halbleiterschicht hin erstreckt.
Unterstützt wird dieses Verständnis durch die Beschreibungsstellen, die sich mit der Bildung des Sourcebereichs (3) an der Seitenfläche der Vertiefung befassen (Abs. [0029], [0031]). Dies setzt zum einen voraus, dass überhaupt eine abgrenzbare Seitenfläche der Vertiefung vorhanden ist, zum anderen bedingt das geschilderte Durchführen der Ionenimplantation aus einer schrägen Richtung, dass sich der hakenförmig gebogene Abschnitt in deutlichem Maße nach oben erstreckt und sich nicht in einem Winkel nahe 180° in horizontaler Richtung fortsetzt. -
IV.
Unter Berücksichtigung des vorgenannten Verständnisses von der Lehre des Klagepatents vermag auch der Senat nicht festzustellen, dass die angegriffene Ausführungsform im Dotierungsimplantationsbereich eine erfindungsgemäße Vertiefung aufweist, die in einem Abschnitt von ihm an einer Oberfläche des Dotierungsimplantationsbereichs gebildet außer in einem Abschnitt nahe einem Endabschnitt (Merkmal 3.2), und der Abschnitt nahe dem Endabschnitt eine hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche der Halbleiterschicht hin gebogene Form aufweist (Merkmal 3.2.1).
Die Klägerin stützt ihren Verletzungsvorwurf auf Mikroskopuntersuchungen eines Chips, der einem mit dem Markenzeichen der Streithelferin versehenen Inverter entnommen wurde. Ungeachtet dessen, ob die in der Klageschrift abgebildeten Feldeffekttransistoren tatsächlich aus den Mikrochips der Streithelferin stammen, kann diese als Herstellerin der angegriffenen Halbleitervorrichtungen deren tatsächliche Ausgestaltung jedenfalls nicht mit Nichtwissen bestreiten. Hat die klagende Partei ihren Vortrag nämlich durch Vorlage von Privatgutachten oder anderweitigen Untersuchungsergebnissen betreffend die angegriffene Ausführungsform hinreichend konkretisiert, so muss die beklagte Partei dieses Vorbringen ebenso qualifiziert bestreiten. Dies erfordert eine konkrete Erwiderung, indem sich die beklagte Partei aktiv an der Sachverhaltsaufklärung beteiligt, zu den einzelnen relevanten Behauptungen der klagenden Partei Stellung nimmt und eine eigene Darstellung dazu liefert, dass und weshalb diese Behauptung unzutreffend ist (OLG Düsseldorf [15. ZS], GRUR-RR 2021, 421 Rn. 63 – Montagegrube; Senat, Urt. v. 09.12.2021 – I-2 U 1/21, GRUR-RS 2021, 39600 Rn 65 – Rasierapparat; GRUR 2022, 1510 Rn. 102 – Abdeckungsentfernungsvorrichtung).
Die Klägerin hat vorliegend anhand der untersuchten Chips eine Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) Aufnahme erstellt, die diesen im Querschnitt wie folgt zeigt (Klageschrift vom 22.04.2022, S. 38): - Zu erkennen sind mehrere Feldeffekttransistoren sowie ein darunterliegender wannenförmiger Bereich. Die nachfolgend wiedergegebene rasterelektronische Querschnittsaufnahme zeigt vergrößert nur einen der Feldeffekttransistoren. Sie wird zum besseren Verständnis in einer seitens der Klägerin kolorierten und beschrifteten Fassung (Klageschrift vom 22.04.2022, S. 41) wiedergegeben:
- Dass der Aufbau der angegriffenen Ausführungsform demjenigen aus der vorstehend wiedergegebenen Abbildung grundsätzlich entspricht, haben die Beklagten und deren Streithelferin nicht bestritten. Allerdings vermögen die Untersuchungen der Chips im bildgebenden Verfahren die Verwirklichung der Merkmale 3.2 und 3.2.1 nicht zu belegen. Die Klägerin begründet den Verletzungsvorwurf anhand der nachfolgend wiedergegebenen, von ihr kolorierten und beschrifteten Mikroskopaufnahmen (Klageschrift vom 22.04.2022, S. 42):
-
Sie will an den beiden gelb markierten Dotierungsimplantationsbereichen jeweils links und rechts einen Bereich erkennen, der gegenüber den anderen Bereichen geringfügig erhöht ist. Diesen Bereich hat sie gelb schraffiert dargestellt; er soll den erfindungsgemäß hakenförmig nach oben gebogenen Abschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs darstellen. Den daneben befindlichen niedrigeren Bereich will die Klägerin als anspruchsgemäße Vertiefung verstanden wissen. Das überzeugt nicht.
Zu den oben dargestellten Mikroskopaufnahmen trägt die Klägerin vor, dass der von ihr als anspruchsgemäße Vertiefung identifizierte Bereich 0,75 m von der Kante des Wannenimplantationsbereichs und 0,25 m von der Kante des Sourcebereichs entfernt liege und eine Tiefe von 0,05 m aufweise. Die Beklagten wiederum haben unbestritten vorgetragen, dass der Feldeffekttransistor insgesamt eine Dicke von 4-5 m aufweise, wobei die Dicke der Implantationsbereiche weniger als 1 m betrage. Damit sind die für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre relevanten Bereiche – der Wannenbereich, der Dotierungsimplantationsbereich und der Sourcebereich – in der angegriffenen Ausführungsform jedenfalls nicht wesentlich kleiner als bei den in der Klagepatentschrift beispielhaft beschriebenen bevorzugten Ausführungsbeispielen ausgestaltet (vgl. Abs. [0030] bis [0032]). Die für die vermeintliche „Vertiefung“ in der angegriffenen Ausführungsform seitens der Klägerin angegebene Tiefe von 0,05 m hingegen liegt um das Vierfache unter dem in der Klagepatentschrift beispielhaft für eine anspruchsgemäße Vertiefung angegebenem Wert von 0,2 m.
Winkelangaben zu dem – nach dem Verständnis der Klägerin – hakenförmig nach oben gebogenen Abschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs fehlen. Die Klägerin selbst spricht in ihrer Replik insoweit von einer „abgeflachten Hakenstruktur“. Die in der Klagepatentschrift in den bevorzugten Ausführungsformen dargestellten Winkel von 90° bzw. 135° werden jedenfalls nicht ansatzweise erreicht. Der Winkel, in dem sich der gebogene Abschnitt des Dotierungsimplantationsbereichs von der „Vertiefung“ nach oben erstreckt, liegt in der angegriffenen Ausführungsform eher nahe 180°. Dies korrespondiert mit der geringen Tiefe des seitens der Klägerin als erfindungsgemäße „Vertiefung“ identifizierten Bereichs.
Dazu, ob es sich bei der von ihr identifizierten „Vertiefung“ um eine solche handelt, die als Referenz für eine Maskenausrichtung – z.B. in einem fotomechanischen Prozess (vgl. Abs. [0004]) – dienen kann, trägt die Klägerin auch im Berufungsverfahren nichts vor. Es fehlen insbesondere jegliche Ausführungen dazu, ab welcher Mindesttiefe eine Vertiefung objektiv geeignet ist, an ihr Masken auszurichten. Die Klägerin zieht sich vielmehr auf die Annahme zurück, dass bereits minimale Unebenheiten in der Waferoberfläche eine Vertiefung im Sinne von Merkmal 3.2 darstellen. In der Berufungsbegründung vom 23.11.2023 (dort S. 24) macht sie in funktionaler Hinsicht geltend, dass die klagepatentgemäße Ausgestaltung des Sourcebereichs insbesondere mit den hakenförmig nach oben zu einer Deckfläche hin gebogenen Endabschnitten Nachteile bei der Bildung einer gleichmäßigen Inversionsschicht auch schon bei minimalen Unebenheiten ausschließe und sich deshalb stets als vorteilhaft darstelle. Dies genügt nach der oben dargetanen Auslegung des Patentanspruchs 1 indes nicht, um das Vorliegen einer anspruchsgemäßen Vertiefung mit daran anschließenden hakenförmig nach oben gebogenen Abschnitten des Dotierungsimplantationsbereichs im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre zu begründen.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten (Anlage K18/18a S. 4). Soweit der Privatgutachter der Klägerin darin behauptet, dass „jeder, der sich mit Halbleitermaterialien und -geräten auskennt, ein solches Merkmal als Aussparung erkennen würde“ (Anlage K18/18a S. 4), bleibt diese Aussage pauschal und ohne jede nachvollziehbare technische Erläuterung. Zudem bleibt unberücksichtigt, dass – wie bereits dargetan – nicht jede „Aussparung“ als Vertiefung im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre zu qualifizieren ist. Der Gutachter der Klägerin geht in keiner Weise auf die Funktionen der anspruchsgemäßen Vertiefung und des hakenförmig nach oben hin gebogenen Abschnitts des Dotierungsimplantationsbereichs ein. Vielmehr lässt er ausdrücklich offen, ob die festgestellte Aussparung für die Funktion des Bauelements förderlich oder hinderlich ist (Anlage K18/18a S. 4). -
C.
Die Anschlussberufung der Streithelferin, die als solche der Beklagten zu gelten hat (vgl. Wulf in BeckOK ZPO, 53. Ed. Stand 01.07.2024, § 524 Rn 4; Ball in Musielak/Voit, ZPO, 21. Aufl. 2024, § 524 Rn 6), ist zulässig und begründet. -
I.
Die Anschlussberufung der Streithelferin ist entgegen der Auffassung der Klägerin zulässig, insbesondere muss sie sich nicht auf die Ergänzung des Urteils nach § 321 Abs. 1 ZPO verweisen lassen, die wegen Ablaufs der Frist des § 321 Abs. 2 ZPO im vorliegenden Fall nicht mehr möglich war.
Zwar kann ein Rechtsmittel im Grundsatz nur dann erfolgreich eingelegt werden, wenn das anzufechtende Urteil inhaltlich falsch ist (Musielak in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 321 Rn. 12), was nicht der Fall ist, wenn über die geltend gemachten Ansprüche ganz oder teilweise (überhaupt) nicht entschieden wurde (BGH, NJW-RR 2010, 19, 20 Rn. 11), etwas anderes gilt jedoch, wenn im Urteil versehentlich Nebenentscheidungen nicht getroffen worden sind, beispielsweise nicht über die vorläufige Vollstreckbarkeit, die Kosten oder einen erforderlichen Vorbehalt entschieden worden ist. In diesem Fall ist das Urteil inhaltlich falsch und kann deshalb angefochten werden (BGH, NJW-RR 1996, 1238; BGH, NJW 2006, 1351, 1352; BGH, NJW 2010, 19 Rn. 13; OLG Schleswig, MDR 2005, 350; OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.07.2018 – 19 U 10/18, BeckRS 2018, 16236). § 99 ZPO steht der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung im Rahmen der Anschlussberufung nicht entgegen, wenn – wie vorliegend – gleichzeitig eine Berufung gegen die Hauptsache anhängig ist (Elmer in BeckOK ZPO, 53. Ed. Stand 01.07.2024, § 321 Rn 53).
Im Übrigen hätte der Senat die Entscheidung über die Kosten der Nebenintervention in erster Instanz auch von Amts wegen treffen können, ohne dass es der Anschlussberufung der Beklagten bedurft hätte. Denn auch das Rechtsmittelgericht hat ohne Rücksicht auf Parteianträge eine unterbliebene Kostenentscheidung nach § 308 Abs. 2 ZPO nachzuholen (BAG, BB 1975, 231), wobei diese Vorschrift auch für die Kosten der Streithilfe gilt (OLG Karlsruhe, Urt. v. 22.11.2019 – 15 U 73/19, BeckRS 2019, 63215 Rn. 73 m.w.N.). Das Verbot, die angefochtene Entscheidung zulasten des Rechtsmittelführers abzuändern (reformatio in peius), steht dem nicht entgegen (BGH, NJW 2021, 1018 Rn. 32 – Musterfeststellungsklage).
Die Befugnis des Rechtsmittelgerichts, über die Kosten des Rechtsstreits auch für die erste Instanz von Amts wegen zu entscheiden (§ 308 Abs. 2 ZPO), steht dem Rechtsschutzbedürfnis für die Anschlussberufung nicht entgegen. Denn es kann dem Rechtsmittelführer nicht verwehrt werden, durch ein eigenes Rechtsmittel auf die Korrektur der zu seinen Lasten fehlerhaft ergangenen Kostenentscheidung hinzuwirken; er muss sich nicht darauf verlassen, dass diese Entscheidung durch das Rechtsmittelgericht von Amts wegen korrigiert wird. -
II.
In der Sache hat die Klägerin gemäß § 101 Abs. 1 ZPO auch die Kosten der Nebenintervention zu tragen, da ihr als unterliegende Partei gemäß § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen sind. -
D.
Die Kostenentscheidung für die Berufungsinstanz folgt aus den §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.