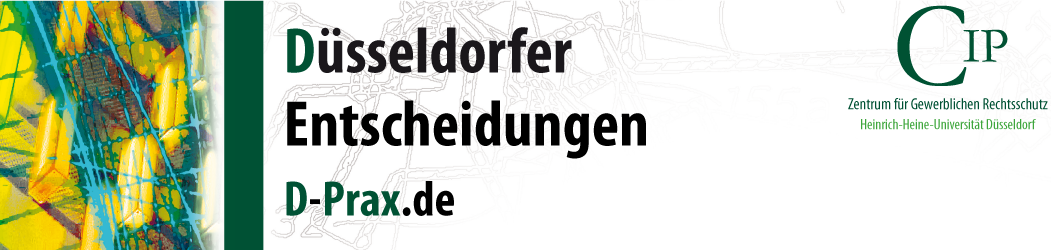Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3411
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 19. Dezember 2024, I-2 U 89/22
Vorinstanz: 4b O 9/19
- I. Die Berufung gegen das am 08.06.2022 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen,
– dass es in Ziffer I. des Tenors des landgerichtlichen Urteils statt „die Beklagte wird verurteilt“ „die Beklagten werden verurteilt“ heißt;
– dass sich die Auskunftsverpflichtung des Beklagten zu 4) gemäß Ziffer I.2. des Tenors des landgerichtlichen Urteils auf Handlungen bis zum 07.09.2022 beschränkt;
– dass sich die Verpflichtung des Beklagten zu 4) zur Rechnungslegung gemäß Ziffer I.3 des Tenors des landgerichtlichen Urteils auf Handlungen bis zum 07.09.2022 beschränkt und
– dass die Schadensersatzverpflichtung des Beklagten zu 4) gemäß Ziffer II.2. des Tenors des landgerichtlichen Urteils nur Handlungen bis zum 07.09.2022 umfasst.
II. Die Beklagten haben auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.
Die Beklagten dürfen die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000 EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
V. Der Streitwert wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt. - Gründe:
-
I.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 1 933 XXX (nachfolgend: Klagepatent, Anlage HL 4). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf der angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz und zur Entschädigung in Anspruch.
Das Klagepatent wurde am 08.12.2004 angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 14.07.2010 im Patentblatt bekannt gemacht. Nachdem die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts das Klagepatent auf einen von einem Dritten eingelegten Einspruch mit Entscheidung vom 05.11.2012 (Anlage HL 6) unverändert aufrechterhalten hat, hat das Bundespatentgericht (nachfolgend: BPatG) auf eine von der Beklagten zu 1) erhobene Nichtigkeitsklage durch Urteil vom 08.10.2021 (Anlage HL 26 / Anlage rop 24, nachfolgend: BPatGU) das Klagepatent (nur) eingeschränkt aufrechterhalten. Die Berufung der Beklagten zu 1) gegen das Urteil des BPatG hat der Bundesgerichtshof (nachfolgend: BGH) durch Urteil vom 16.04.2024 (Az.: X ZR 28/22, GRUR 2024, 1005; Anlage HL 32; nachfolgend: BGHU) zurückgewiesen.
Das Klagepatent betrifft einen Pulsationsdämpfer sowie ein Verfahren zur Herstellung und die Verwendung eines Pulsationsdämpfers. Der Wortlaut der hier geltend gemachten Ansprüche 1, 10 und 12 in der im Nichtigkeitsverfahren eingeschränkt aufrechterhaltenen Fassung lautet wie folgt (Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung wurden durch Durch- bzw. Unterstreichung markiert):
1. „Pulsationsdämpfer, umfassend einen Grundkörper (1), wobei der Grundkörper (1) eine integral ausgebildete Ausgleichkammer (8) umfasst, wobei die Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) zumindest teilweise spanlos gefertigt ist, wobei ein Kolben (13) zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer (8) bewegbar ist, wobei der Kolben (13) auf der der Ausgleichkammer (8) abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar ist und wobei die Ausgleichkammer (8) als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass wobei dem Kolben (13) mindestens ein Führungsring (14) zur Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) und mindestens ein Dichtring (16) zur dichtenden Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) zugeordnet ist, wobei dem Kolben (13) ein Stützring (17) zugeordnet ist und wobei der Führungsring(14) und der Dichtring (16) in Nuten angeordnet sind, welche im Kolben (13) ausgebildet sind.“
10. „Verfahren zur Herstellung von Pulsationsdämpfern umfassend einen Grundkörper (1), wobei der Grundkörper (1) eine Ausgleichkammer (8) umfasst, wobei ein Kolben (13) zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer (8) bewegbar ist, wobei der Kolben (13) auf der der Ausgleichkammer (8) abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar ist und wobei die Ausgleichkammer (8) als abgeschlossener Raum nach einem der vorstehenden Ansprüche ohne Zuleitung ausgebildet ist, wobei dem Kolben (13) mindestens ein Führungsring (14) zur Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) und mindestens ein Dichtring (16) zur dichtenden Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) zugeordnet ist, wobei dem Kolben (13) ein Stützring (17) zugeordnet ist, wobei zumindest die Bauteile des Pulsationsdämpfers, welche zur Herstellung einer abgeschlossenen Ausgleichkammer (8) ohne Zuleitung benötigt werden, in einem Arbeitsraum positioniert werden, wobei die Bauteile zur abschließenden Herstellung der Ausgleichkammer (8) zusammengefügt werden und wobei der Arbeitsraum mit dem gleichen Druck beaufschlagt wird, welcher in der fertiggestellten Ausgleichkammer (8) herrscht.“
12. „Verwendung eines Pulsationsdämpfers nach einem der Ansprüche 1 bis 14 9 in hydraulischen Versorgungssystemen von Kraftfahrzeugen.“ - Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 der Klagepatentschrift verdeutlicht den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Sie zeigt die Schnittzeichnung eines erfindungsgemäßen Pulsationsdämpfers:
Dieser umfasst einen Grundkörper (1), eine von diesem umfasste Ausgleichkammer (8) sowie einen Kolben (13), der zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer bewegbar ist. Auf der der Ausgleichkammer (8) abgewandten Seite ist der Kolben mit Druck beaufschlagbar. Dem Kolben sind ein Führungsring (14), ein Dichtring (16) und ein Stützring (17) zugeordnet.
Die Klägerin gehört zum A-Konzern, einer global agierenden Unternehmensgruppe unter anderem im Bereich der Dichtungs- und Schwingungstechnik. Die Beklagte zu 1) ist als Zulieferer von Motor- und Getriebekomponenten eine Wettbewerberin. Sie produziert u.a. rotationssymmetrische Motorkomponenten sowie Kraftstoffmodule für Verbrennungs- und Hybridantriebe. Die Beklagte zu 2) ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Beklagten zu 1). Der Beklagte zu 3) war bis zum 15.12.2021, der Beklagte zu 4) bis zum 07.09.2022 Geschäftsführer der Beklagten zu 2).
Die Beklagte zu 1) stellt her und vertreibt die nachfolgend dargestellten Kolbenspeicher (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform, vgl. Anlage HL 16, die Bezugsziffern wurden von der Klägerin hinzugefügt), die in dem Doppelkupplungsgetriebe C des Herstellers B zum Einsatz kommen: -
Die angegriffene Ausführungsform weist ein einstückiges Gehäuse (1) sowie einen darin bewegbaren Kolben (13) auf. Dem Kolben sind diverse Dichtringe (14, 16, 17) zugeordnet. In dem Getriebe von B findet die angegriffene Ausführungsform als Kolbenspeicher Verwendung. Hinsichtlich ihrer konstruktiven Ausgestaltung wird ergänzend auf die als Anlage HL 15 vorgelegten Fotografien Bezug genommen.
Die Klägerin sieht in der Herstellung, im Angebot und im Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents. Die Beklagten, die erstinstanzlich Klageabweisung beantragt haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und geltend gemacht:
Die angegriffene Ausführungsform stelle bereits keinen anspruchsgemäßen Pulsationsdämpfer dar, weil etwa auftretende Pulsationen aufgrund der „harten“ Vorspannung nicht in der Lage seien, den Kolben in dem Kolbenspeicher zu bewegen. Mangels einer solchen Bewegung könnten Pulsationen nicht gedämpft werden. Die angegriffene Ausführungsform sei daher weder dafür vorgesehen noch geeignet, in dem Getriebe C von B, für das sie speziell entwickelt und ausschließlich einsetzbar sei, Pulsationen zu dämpfen.
Mit dem Merkmal „integral ausgebildete Ausgleichkammer“ werde keine Festlegung getroffen, ob der Grundkörper ein- oder mehrstückig aufgebaut sein müsse. Wolle man aber der insofern fehlerhaften Auffassung des BPatG folgen, wonach der Grundkörper einstückig ausgebildet sein müsse, so verstehe das Klagepatent unter einem „einstückigen Grundkörper“ nur einen solchen Grundkörper, der im Tiefziehverfahren hergestellt worden sei. Das sei bei der angegriffenen Ausführungsform – unstreitig – nicht der Fall.
Schließlich sei auch der geltend gemachte Verfahrensanspruch nicht verwirklicht, da der Arbeitsraum bei der angegriffenen Ausführungsform nicht mit dem gleichen Druck beaufschlagt werde, der in der fertiggestellten Ausgleichkammer herrsche. Vielmehr liege der Druck in der fertiggestellten Ausgleichkammer mehr als 10% über dem Druck im Arbeitsraum.
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht eine wortsinngemäße Patentverletzung bejaht und der Klage wie folgt stattgegeben:
„I. Die Beklagte wird verurteilt,
1. es bei Meldung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1) und 2) an ihren jeweiligen gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist, zu unterlassen,
a) Pulsationsdämpfer, umfassend einen Grundkörper, wobei der Grundkörper eine integral ausgebildete Ausgleichkammer umfasst, wobei die Innenwandung der Ausgleichkammer zumindest teilweise spanlos gefertigt ist, wobei ein Kolben zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer bewegbar ist, wobei der Kolben auf der der Ausgleichkammer abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar ist, und wobei die Ausgleichkammer als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet ist, wobei dem Kolben mindestens ein Führungsring zur Anlage an der Innenwandung der Ausgleichkammer und mindestens ein Dichtring zur dichtenden Anlage an der Innenwandung der Ausgleichkammer zugeordnet ist, wobei dem Kolben ein Stützring zugeordnet ist, und wobei der Führungsring und der Dichtring in Nuten angeordnet sind, welche im Kolben ausgebildet sind;
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
b) ein Verfahren zur Herstellung von Pulsationsdämpfern umfassend einen Grundkörper, wobei der Grundkörper eine Ausgleichkammer umfasst, wobei ein Kolben zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer (8) bewegbar ist, wobei der Kolben auf der der Ausgleichkammer abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar ist, und wobei die Ausgleichkammer als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet ist, wobei dem Kolben mindestens ein Führungsring zur Anlage an der Innenwandung der Ausgleichkammer und mindestens ein Dichtring zur dichtenden Anlage an der Innenwandung der Ausgleichkammer zugeordnet ist, wobei dem Kolben ein Stützring zugeordnet ist, wobei zumindest die Bauteile des Pulsationsdämpfers, welche zur Herstellung einer abgeschlossenen Ausgleichkammer ohne Zuleitung benötigt werden, in einem Arbeitsraum positioniert werden, wobei die Bauteile zur abschließenden Herstellung der Ausgleichkammer zusammengefügt werden, und wobei der Arbeitsraum mit dem gleichen Druck beaufschlagt wird, welcher in der fertiggestellten Ausgleichkammer herrscht;
in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden oder anzubieten;
c) einen Pulsationsdämpfer mit den Merkmalen wie oben zu a) zur Verwendung in hydraulischen Versorgungssystemen von Kraftfahrzeugen
in der Bundesrepublik Deutschland sinnfällig herzurichten oder solchermaßen hergerichtete Pulsationsdämpfer anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
d) Pulsationsdämpfer mit den Merkmalen wie oben zu a), die durch ein Verfahren wie oben zu b) hergestellt sind,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.
2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie – die Beklagten – die zu I. 1. a) und I. 1. d) bezeichneten Handlungen seit dem 14. Juli 2010 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzern (insbesondere Transport- und Lagerunternehmen),
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei die Verkaufsstellen, Einkaufspreise und Verkaufspreise nur für die Zeit seit dem 14. Juli 2010 anzugeben sind und die Auskunftsverpflichtung des Beklagten zu 3) Auskunft nur für Handlungen bis zum 15. Dezember 2021 umfasst;
3. ihr darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 18. Juli 2008 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) von Ort und Zeit der Verfahrensanwendung hinsichtlich der Handlungen zu Ziffer I.1.b),
b) der Herstellungsmengen und -zeiten,
c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, zeiten und -preisen und gegebenenfalls Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, zeiten und -preisen und gegebenenfalls Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
– es den Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht gewerblichen Abnehmern statt ihr (der Klägerin) einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, ihr (der Klägerin) auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist,
– die Beklagten hinsichtlich der Angaben zu lit. b) und c) Bestellscheine, hilfsweise Lieferscheine, hilfsweise Rechnungen (in Kopie) vorzulegen haben, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
– von den Beklagten zu 2) bis 4) sämtliche Angaben und von den Beklagten zu 1) bis 4) die Angaben zu lit. f nur für die Zeit seit dem 14. August 2010 zu machen sind und der Beklagte zu 3) die Angaben nur für Handlungen bis zum 15. Dezember 2021 zu machen hat;
4. nur die Beklagte zu 1): die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter I. 1. a) bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben oder nach ihrer Wahl selbst zu vernichten;
5. nur die Beklagte zu 1): die vorstehend zu I. 1. a) bezeichneten in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den durch das Urteil der Kammer gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen.
II. Es wird festgestellt, dass
1. die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin für die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 18. Juli 2008 bis 13. August 2010 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;
2. die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 14. August 2010 begangenen Handlungen bereits entstanden ist und noch entstehen wird, wobei die Schadensersatzverpflichtung des Beklagten zu 3) nur Handlungen bis zum 15. Dezember 2021 umfasst.“ - Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihr Klageabweisungsbegehren weiterverfolgen. Sie halten daran fest, dass bei zutreffender Auslegung des Klagepatents keine Patentverletzung vorliege, und ergänzen und vertiefen ihr erstinstanzliches Vorbringen wie folgt:
Eine Vorrichtung sei nur dann als patentgemäßer Pulsationsdämpfer einzuordnen, wenn sie konkret geeignet sei, Pulsationen zu dämpfen. Hierzu müsse die Auslegung der angegriffenen Vorrichtung insgesamt auf die Größenordnung der zu dämpfenden und zu unterdrückenden Pulse und Schockwellen ausgerichtet sein. Dass das Klagepatent auch die Möglichkeit kenne, Pulsationsdämpfer als Kolbenspeicher zu verwenden, ändere hieran nichts. Denn auch im Falle der Verwendung als Kolbenspeicher wolle das Klagepatent nur solche Pulsationsdämpfer als patentgemäß verstanden wissen, die in dem konkreten Anwendungssystem Druckstöße dämpfen können. Vorrichtungen, die zwar ihrem Aufbau nach dem Aufbau eines Pulsationsdämpfers entsprächen, tatsächlich aber nicht zur Dämpfung von Pulsationen geeignet seien, etwa aufgrund ihrer Vorspannung und ihrer Trägheit und Elastizität, würden vom Klagepatent nicht umfasst.
Hiernach sei die angegriffene Ausführungsform nicht patentgemäß. Denn sie sei speziell für das Doppelkupplungsgetriebe C von B entwickelt und konzipiert, in dem es aufgrund des Volumens, der Vorspannung und der Trägheit der Dichtungen ausgeschlossen sei, mit der angegriffenen Ausführungsform Pulsationen zu dämpfen. Die angegriffene Ausführungsform könne vielmehr ausschließlich als Kolbenspeicher eingesetzt werden.
Verstehe man das Erfordernis der integralen Ausbildung der Ausgleichkammer mit dem BPatG dahingehend, dass ein einstückiger Grundkörper gefordert werde, müsse dieser im Tiefziehverfahren hergestellt sein; etwas Anderes offenbare das Klagepatent nicht. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig nicht der Fall.
Des Weiteren müsse die Innenwandung der Ausgleichkammer nach der klagepatentgemäßen Lehre zumindest teilweise spanlos gefertigt sein. Nach dem Urteil des BGH im Nichtigkeitsverfahren sei dies dahingehend zu verstehen, dass nicht nur die Oberfläche diejenigen Eigenschaften aufweisen müsse, wie sie sich bei einer spanlosen Herstellung einstellen, sondern auch die Materialstruktur unterhalb der Oberfläche derjenigen entsprechen müsse, wie sie für eine spanlose Herstellung typisch sei. Zu dem letztgenannten Punkt fehle es im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform an substantiiertem Vortrag der Klägerin.
Soweit das Landgericht schließlich angenommen habe, es sei ausreichend, dass der Druck in der Ausgleichkammer nur im Wesentlichen der gleiche Druck sei wie derjenige in der Arbeitskammer, stehe dies in Widerspruch zu den Ausführungen des BPatG. Denn dieses habe den Verfahrensanspruch 10 gegenüber der D11 gerade deshalb als neu angesehen, weil die D11 nicht offenbare, wie sich der Druck im Arbeitsraum während des Einschiebens des Kolbens verhalte. Daher setze der Klagepatentanspruch 10 exakt den gleichen Druck im Arbeitsraum und in der Ausgleichkammer voraus.
Die Beklagten beantragen,
das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 08.06.2022, Az. 4b O 9/19, abzuändern und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und tritt den Ausführungen der Beklagten wie folgt entgegen:
Die Einordnung des Begriffs „Pulsationsdämpfer“ als Zweckangabe bedeute, dass eine patentgemäß aufgebaute Vorrichtung (nur) objektiv dazu geeignet sein müsse, den angegebenen Zweck – hier: Dämpfung von Pulsationen in einem hydraulischen System – zu erfüllen. Das entgegenstehende einschränkende Verständnis der Beklagten werde von der Beschreibung nicht gestützt. Durch eine Bezugnahme auf Pulsationsdämpfer einerseits und Kolbenspeicher andererseits unterscheide das Klagepatent diese eben nicht in der Weise voneinander, dass die eine Funktion im System die jeweils andere ausschließe. Im Gegenteil: Mit der Klarstellung, dass Pulsationsdämpfer auch als Kolbenspeicher verwendet werden können, erkenne das Klagepatent ausdrücklich an, dass patentgemäß aufgebaute Vorrichtungen beiden Funktionen – Pulsationsdämpfung und Druckspeicherung – dienen könnten, selbst wenn je nach konkret vorgesehenem Einsatz im System eine dieser Funktionen im Vordergrund stehe. Im Übrigen wirke der angegriffene Kolbenspeicher auch als Pulsationsdämpfer. Sie – die Klägerin – habe in zwei Versuchen eindeutig nachgewiesen, dass der Kolbenspeicher in seiner konkreten Ausgestaltung und Anwendung dazu geeignet sei, in einem Hydrauliksystem und eben auch in dem Getriebe von B Pulsationen zu dämpfen.
Für die integrale Ausbildung der Ausgleichkammer innerhalb des Grundkörpers könne jedes geeignete Herstellungsverfahren der Integralbauweise eingesetzt werden. Das Klagepatent enthalte diesbezüglich – wie im BPatGU (S. 20) zutreffend festgestellt – keine Beschränkung auf das sog. Tiefziehverfahren. Die angegriffene Ausführungsform sei – insoweit unstreitig – im Wege des „Drückwalzens“ und damit in Integralbauweise hergestellt. Zugleich handele es sich – auch insoweit unstreitig – um ein spanloses Herstellungsverfahren; damit sei auch das Erfordernis einer (zumindest teilweise) spanlosen Fertigung der Innenwandung der Ausgleichkammer erfüllt.
Der Verfahrensanspruch 10 setze nicht voraus, dass während der gesamten Durchführung des Verfahrens exakt derselbe Druck in Arbeitsraum und Ausgleichkammer herrsche. Dies ergebe sich – worauf das Landgericht zu Recht abgestellt habe – sowohl aus der Patentbeschreibung als auch aus der gebotenen funktionalen Betrachtungsweise. Der Druckunterschied bei der angegriffenen Ausführungsform bewege sich innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs. Der Fülldruck der angegriffenen Ausführungsform betrage 16 bar. Nach den Vorgaben von B werde eine Toleranz von -2 bar akzeptiert. Folglich seien Druckabweichungen von bis zu 12,5% hinzunehmen und könnten nicht aus dem Schutzbereich des Verfahrensanspruchs 10 hinausführen.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen. - II.
Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht in der Herstellung, dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine wortsinngemäße Benutzung des Klagepatents gesehen und die Beklagten wegen unmittelbarer Verletzung der Klagepatentansprüche 1 und 12 sowie mittelbarer Verletzung des Klagepatentanspruchs 10 antragsgemäß verurteilt. - 1.
Das Klagepatent betrifft einen Pulsationsdämpfer, ein Verfahren zur Herstellung und die Verwendung eines Pulsationsdämpfers.
Patentanspruch 1 beschreibt den beanspruchten Pulsationsdämpfer als eine Vorrichtung, die einen Grundkörper mit einer Ausgleichkammer umfasst, wobei in dieser Ausgleichkammer ein bewegbarer Kolben angeordnet ist. Dieser ist auf der der Ausgleichkammer abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar. Die Größe der Ausgleichkammer variiert je nach der Stellung des Kolbens. Wird der Kolben auf der der Ausgleichkammer abgewandten Seite mit Druck beaufschlagt, führt dies zu einer Bewegung des Kolbens, was eine entsprechende Komprimierung des Gases in der Ausgleichkammer zur Folge hat (vgl. BPatGU, S. 19 f., 21 f.; BGHU Rn. 13).
In seiner Beschreibung beschreibt das Klagepatent zwei – bereits aus dem Stand der Technik bekannte – Einsatzmöglichkeiten eines solchen Pulsationsdämpfers: Zum einen kann der Pulsationsdämpfer zur Glättung bzw. Reduzierung von Pulsationen in hydraulischen Leitungen verwendet werden (Anlage HL 4 Abs. [0003]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die Klagepatentschrift). Zum anderen kann er als Kolbenspeicher verwendet werden (Abs. [0004]), und zwar insbesondere in Fahrwerken von Kraftfahrzeugen (Abs. [0004]).
Die im Stand der Technik bekannten Pulsationsdämpfer (vgl. hierzu Abs. [0002]) weisen zumeist komplexe Einrichtungen auf, mittels derer die Ausgleichkammern mit Druck beaufschlagt werden können. Die erforderlichen Zuleitungen zur Ausgleichkammer verursachen ausweislich den Erläuterungen in der Klagepatentschrift einen hohen Aufwand hinsichtlich einer zufriedenstellenden Abdichtung. Die Probleme bei der Abdichtung der Zuleitungen führen in der Folge häufig dazu, dass nach einiger Zeit nicht mehr genug Druck in den Ausgleichkammern vorhanden ist. Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, müssen die Pulsationsdämpfer einer ständigen Wartung unterzogen werden. Dabei muss zunächst der Druck innerhalb der Ausgleichkammer überprüft und sodann der Solldruck angepasst werden (Abs. [0005], [0006]).
Ausgehend von dieser Problemlage bezeichnet es das Klagepatent als seine Aufgabe, einen Pulsationsdämpfer der eingangs genannten Art derart auszugestalten und weiterzubilden, dass eine spielfreie und abgedichtete Bewegung des Kolbens innerhalb der Ausgleichkammer realisiert ist, bei der keine Verkippungen auftreten (Abs. [0007]). Aber nicht nur der Kolben soll gegenüber der Ausgleichkammer erfindungsgemäß optimal abgedichtet werden, es soll auch verhindert werden, dass an anderer Stelle ein Druckverlust auftritt. Der Druck in der Ausgleichkammer soll nach einmaliger Befüllung dauerhaft aufrechterhalten und damit ein optimaler Betrieb des Pulsationsdämpfers ohne besonderen Wartungsaufwand gewährleistet werden (Abs. [0011]). Darüber hinaus soll der Pulsationsdämpfer konstruktiv einfach und kostengünstig herstellbar sein (Abs. [0011], vgl. auch BGHU Rn.9).
Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 einen Pulsationsdämpfer mit folgenden Merkmalen vor:
1. Pulsationsdämpfer, umfassend einen Grundkörper (1).
2. Der Grundkörper (1) umfasst eine integral ausgebildete Ausgleichkammer (8).
2.1 Die Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) ist zumindest teilweise spanlos gefertigt.
2.2 Die Ausgleichkammer (8) ist als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet.
3. Ein Kolben (13) ist
3.1 zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer (8) bewegbar und
3.2 auf der der Ausgleichkammer (8) abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar.
4. Dem Kolben (13) ist zugeordnet
4.1 mindestens ein Führungsring (14) zur Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8),
4.2 mindestens ein Dichtring (16) zur dichtenden Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) und
4.3 ein Stützring (17).
5. Der Führungsring (14) und der Dichtring (16) sind in Nuten angeordnet, welche im Kolben (13) ausgebildet sind. - Anspruch 10 schlägt ferner ein Verfahren zur Herstellung eines Pulsationsdämpfers mit folgenden Merkmalen vor:
1. Verfahren zur Herstellung von Pulsationsdämpfern, umfassend einen Grundkörper (1).
2. Der Grundkörper (1) umfasst eine Ausgleichkammer (8).
2.1 Die Ausgleichkammer ist als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet.
2.2 Zumindest die Bauteile des Pulsationsdämpfers, welche zur Herstellung einer abgeschlossenen Ausgleichkammer (8) ohne Zuleitung benötigt werden, werden in einem Arbeitsraum positioniert.
2.3 Die Bauteile werden zur abschließenden Herstellung der Ausgleichkammer zusammengefügt.
2.4 Der Arbeitsraum wird mit dem gleichen Druck beaufschlagt, welcher in der fertiggestellten Ausgleichkammer (8) herrscht.
3. Ein Kolben (13) ist
3.1 zumindest teilweise innerhalb der Ausgleichkammer (8) bewegbar und
3.2 auf der der Ausgleichkammer (8) abgewandten Seite mit Druck beaufschlagbar.
4. Dem Kolben (13) ist zugeordnet
4.1 mindestens ein Führungsring (14) zur Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8),
4.2 mindestens ein Dichtring (16) zur dichtenden Anlage an der Innenwandung (15) der Ausgleichkammer (8) und
4.3 ein Stützring (17).
5. Der Führungsring (14) und der Dichtring (16) sind in Nuten angeordnet, welche im Kolben (13) ausgebildet sind. - Die Abs. [0010] bis [0014] fassen die Vorteile der Erfindung und die ihnen zugrundeliegenden technischen Zusammenhänge in allgemeiner Form zusammen:
Neben den besonderen Maßnahmen, die eine spielfreie und abgedichtete Bewegung des Kolbens innerhalb der Ausgleichkammer ermöglichen, bei der keine Verkippungen auftreten (Merkmalsgruppe 4, Merkmal 5, Abs. [0012] bis [0014]), liegt der Kern der Erfindung in der Ausgestaltung der Ausgleichkammer als abgeschlossener Raum ohne Zuleitungen. Hierdurch nämlich entfällt das Erfordernis einer aufwändigen Abdichtung von Zuleitungen (vgl. auch die Einspruchsentscheidung vom 19.09.2012, Anlage HL 6 S. 7 Ziffer 4.1) und die Dichtungsvorkehrungen können insgesamt minimiert werden (Abs. [0010], [0011]). Einrichtungen zur nachträglichen Befüllung der Ausgleichkammer sind nicht notwendig, weil der anspruchsgemäße Pulsationsdämpfer nach einmaliger Befüllung der Ausgleichkammer den in ihr vorherrschenden Druck bewahrt (Abs. [0011]). Wie eine unter Druck befüllte Ausgleichkammer ohne Zuleitung hergestellt werden kann, beantwortet der Verfahrensanspruch 10. - 2.
Zwischen den Parteien stehen im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch 1 und den Verwendungsanspruch 12 der Begriff des „Pulsationsdämpfers“ (Merkmal 1, s. nachfolgend unter a.) sowie im Hinblick auf den Vorrichtungsanspruch darüber hinaus die integrale Ausbildung der Ausgleichkammer sowie die spanlose Fertigung der Innenwandung der Ausgleichkammer (Merkmale 2.2 und 2.1, s. nachfolgend unter b.) im Streit. Hinsichtlich des Verfahrensanspruches 10 vertreten die Parteien zudem unterschiedliche Auffassungen dazu, in welchem Maße sich der Druck in der fertiggestellten Ausgleichkammer und der Druck im Arbeitsraum entsprechen müssen (Merkmal 2.4, s. nachfolgend unter c.).
Wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat, entspricht die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß der technischen Lehre des Klagepatents; insbesondere ist auch hinsichtlich der vorstehend genannten streitigen Merkmale der Klagepatentansprüche 1, 10 und 12 eine dem Wortsinn entsprechende Benutzung festzustellen. - a.
Die Ansprüche 1 und 12 setzen in ihrem Merkmal 1 jeweils einen „Pulsationsdämpfer“ voraus; Anspruch 10 schützt das Verfahren zur Herstellung eines Pulsationsdämpfers.
Der Durchschnittsfachmann – ein Maschinenbauingenieur mit Hochschulabschluss oder einem vergleichbaren akademischen Grad, der über mehrjährige Erfahrung im Bereich der Ölhydraulik bei Versorgungssystemen von Kraftfahrzeugen verfügt (vgl. BPatGU S. 19 erster Abs.) – erkennt, dass die Klagepatentschrift unter einem Pulsationsdämpfer – anknüpfend an den bekannten Stand der Technik – eine Vorrichtung versteht, die – entsprechend den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 – einen Grundkörper mit einer Ausgleichkammer sowie einen darin bewegbaren Kolben umfasst (vgl. BPatGU S. 19).
In ihren Absätzen [0003] und [0004] beschreibt die Klagepatentschrift zwei – bereits aus dem Stand der Technik bekannte – Einsatzmöglichkeiten eines anspruchsgemäßen Pulsationsdämpfers, nämlich zum einen die Glättung bzw. Reduzierung von Pulsationen in hydraulischen Leitungen und zum anderen die Verwendung als Kolbenspeicher. Weder durch die Bezeichnung der geschützten Vorrichtung als „Pulsationsdämpfer“ noch durch die Bezugnahme auf den Stand der Technik in Abs. [0002] der Klagepatentschrift wird der Schutzbereich des Klagepatents auf die Verwendung der Vorrichtung zur Glättung bzw. Reduzierung von Pulsationen beschränkt. Einer solchen Beschränkung steht bereits die Tatsache entgegen, dass es sich bei Patentanspruch 1 um einen Vorrichtungsanspruch handelt, nicht hingegen um einen Verwendungsanspruch, der auf die Verwendung eines Pulsationsdämpfers zur Glättung bzw. Reduzierung von Pulsationen in hydraulischen Leitungen gerichtet ist.
In Bezug auf Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch ist anerkannt, dass diese dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion beschränken. Sie definieren den durch das Patent geschützten Gegenstand lediglich dahin, dass er geeignet sein muss, für den im Patentanspruch genannten Zweck bzw. die dort genannte Funktion verwendet zu werden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2006, 923 Rn. 15 – Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2008, 896 Rn. 17 – Tintenpatrone; GRUR 2009, 837 Rn. 15 – Bauschalungsstütze; GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer; GRUR 2020, 961 Rn. 31 – FRAND-Einwand; GRUR 2021, 462 Rn. 49 – Fensterflügel; Urt. v. 07.09.2021 – X ZR 77/19, GRUR-RS 2021, 30741 Rn. 13 – Laserablationsvorrichtung; GRUR 2022, 982 Rn. 51 – SRS-Zuordnung; GRUR 2023, 246 Rn. 29 – Verbindungsleitung; Urt. v. 12.12.2023 – X ZR 127/21, GRUR-RS 2023, 46125 Rn. 27 – Trägerelement). Er muss mithin objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (vgl. BGH, GRUR 2012, 475 Rn. 17 – Elektronenstrahltherapiesystem; GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer). Mit der Konkretisierung des Patentgegenstands anhand einer mit der Zweck- oder Funktionsangabe zum Ausdruck gebrachten objektiven Eignung bleibt der auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch ein Sachanspruch. Es kommt weder auf die tatsächliche Verwendung einer Sache an, noch welcher Verwendung sie „dient“ (BGH, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer).
Was die Bezeichnung der von Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Vorrichtung als „Pulsationsdämpfer“ anbelangt, gilt nichts Anderes. Der Pulsationsdämpfer muss nur objektiv geeignet sein, in einer hydraulischen Leitung Pulsationen zu glätten oder zu reduzieren. Bei der hydraulischen Leitung kann es sich hierbei um irgendeine (technisch und wirtschaftlich sinnvoll denkbare) hydraulische Leitung handeln. Es kommt nicht einmal darauf an, ob es eine entsprechende Leitung am Markt tatsächlich gibt. Der beanspruchte Pulsationsdämpfer wird damit unabhängig davon geschützt, ob er tatsächlich in einer hydraulischen Leitung zur Glättung bzw. Reduzierung von Pulsationen eingesetzt wird. Er kann ebenso auch nur (ausschließlich) als Kolbenspeicher verwendet werden.
In diesem Verständnis sieht sich der Fachmann dadurch bestätigt, dass die Klagepatentschrift – wie bereits erwähnt – in ihrer einleitenden Beschreibung (Abs. [0004]) ausdrücklich darauf hinweist, dass Pulsationsdämpfer auch als Kolbenspeicher verwendet werden können. Wie sich aus der besonderen Patentbeschreibung ergibt (Abs. [0045]), gilt dies auch für den erfindungsgemäßen Pulsationsdämpfer.
Dass diese Verwendungsmöglichkeit auf einen Pulsationsdämpfer beschränkt wäre, wie er in der in Abs. [0002] als Stand der Technik benannten DE 33 33 597 A1 beschrieben wird, lässt sich der Klagepatentschrift nicht entnehmen. Insbesondere verfängt die diesbezügliche Argumentation der Beklagten nicht, wonach jeder Kolbenspeicher – entsprechend dem in der DE 33 33 597 A1 gezeigten – zugleich auch der Dämpfung von Pulsationen dienen müsse, um als anspruchsgemäßer Pulsationsdämpfer im Sinne des Klagepatents eingeordnet zu werden. Solches gibt die Klagepatentschrift an keiner Stelle vor. Dem Fachmann ist vielmehr bekannt, dass Pulsationsdämpfer und Kolbenspeicher grundsätzlich identisch aufgebaut sind. Sie bestehen – vereinfacht beschrieben – aus einem druckfesten Gehäuse, das mit einem Medium, z.B. Gas gefüllt ist, und einem Trennelement, beispielsweise einem Kolben, das/der beweglich in dem Gehäuse angeordnet ist. Die solchermaßen aufgebaute Vorrichtung kann über eine Bewegung des Kolbens im Gehäuse Druck aufbauen und bei Bedarf wieder abgeben. Bei geringerem Druck innerhalb des Gehäuse (der Ausgleichkammer) können Pulsationen effektiver gedämpft werden, bei höherem Druck im Gehäuseinnenraum (der Ausgleichkammer) findet demgegenüber eine größere Energiespeicherung statt, während die Fähigkeit zur Pulsationsdämpfung vermindert ist. Das ist dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens klar und hiervon geht er auch in Bezug auf den beanspruchten Pulsationsdämpfer aus.
Figur 2 der Klagepatentschrift zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Pulsationsdämpfers, zu dem in der zugehörigen Patentbeschreibung in Abs. [0045] angegeben ist, dass dieser Pulsationsdämpfer als „Kolbenspeicher“ verwendet werden kann. Davon, dass der gezeigte Pulsationsdämpfer in dem jeweiligen konkreten Hydrauliksystem auch als Pulsationsdämpfer im eigentlichen Sinne, d.h. zur Dämpfung von Pulsationen verwendet wird, ist in der Beschreibung nicht die Rede. Der Fachmann hat daher keinen Anlass anzunehmen, dass Patentanspruch 1 ausschließlich einen Pulsationsdämpfer schützt, der in dem jeweiligen konkreten System auch als Pulsationsdämpfer zur Dämpfung von Pulsationen verwendet wird, d.h. der dort Pulsationen wirkungsvoll zu dämpfen vermag. Dagegen spricht auch, dass Patentanspruch 1 eine hydraulische Leitung bzw. ein Hydrauliksystem überhaupt nicht erwähnt.
Gegenteiliges hat – entgegen der Auffassung der Beklagten – auch das BPatG in seinem das Klagepatent betreffenden Urteil vom 08.10.2021 nicht festgestellt. Insbesondere ist mit dem dortigen Hinweis darauf, dass mit dem grundlegend bekannten Aufbauprinzip von Pulsationsdämpfern pulsierende Druckschwankungen in hydraulischen Systemen wirkungsvoll gedämpft werden können (BPatGU S. 21 oben), nicht die Eignung der Vorrichtung in einem konkreten hydraulischen System angesprochen, sondern vielmehr die grundsätzliche objektive Eignung der Vorrichtung zur Dämpfung von Pulsationen allein durch die Verwirklichung des bekannten Aufbauprinzips. Damit aber bestätigt das BPatG zugleich die objektive Eignung eines jeden dergestalt konstruktiv aufgebauten Pulsationsdämpfers zur Dämpfung von Pulsationen. Ob der Pulsationsdämpfer tatsächlich zum Zwecke der Dämpfung von Pulsationen eingesetzt wird, ist demgegenüber ohne Relevanz.
Diesem Verständnis steht auch das im Nichtigkeitsberufungsverfahren ergangene Urteil des BGH vom 16.04.2024 nicht entgegen. Vielmehr hat der BGH dort ausgeführt, dass mit den Merkmalen 1 bis 3 ein „Kolbenspeicher“ definiert ist, bei dem ein Kolben auf einer Seite einen mit Gas gefüllten Raum (die Ausgleichkammer) verschließt und auf der anderen Seite mit Druck beaufschlagt werden kann. Auch der BGH geht damit davon aus, dass der patentgemäße Pulsationsdämpfer wie ein Kolbenspeicher aufgebaut ist. Außerdem hat auch der BGH betont, dass Figur 2 der Klagepatentschrift einen (patentgemäßen) Pulsationsdämpfer zeigt, der als „Kolbenspeicher“ verwendet werden kann (BGHU Rn. 20). Dass der gezeigte Pulsationsdämpfer in diesem Falle in dem jeweiligen Hydrauliksystem auch Pulsationen wirkungsvoll dämpfen können muss, hat der BGH nicht zum Ausdruck gebracht. Für ein dahingehendes Verständnis lässt sich auch seinen weiteren Ausführungen nichts entnehmen.
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist das Landgericht mit Recht zu der Auffassung gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform einen anspruchsgemäßen Pulsationsdämpfer darstellt. Sie verfügt nach dem grundsätzlich bekannten Aufbauprinzip über ein druckfestes Gehäuse, eine Füllung und einen Kolben, der beweglich in dem Gehäuse gelagert ist. Damit ist sie objektiv geeignet, Pulsationen zu dämpfen. Dies stellen auch die Beklagten nicht in Abrede. Dass die angegriffene Ausführungsform speziell für das Doppelkupplungsgetriebe D von B entwickelt und konzipiert ist, hindert eine wortsinngemäße Verletzung nicht. Insbesondere ist für die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre – wie ausgeführt – ohne Belang, ob die angegriffene Ausführungsform in diesem konkreten Getriebe Pulsationen wirkungsvoll zu dämpfen vermag.
Entsprechendes gilt auch für den Klagepatentanspruch 12. Zwar handelt es sich hierbei um einen Verwendungsanspruch, dieser ist aber nicht etwa auf die Verwendung der Vorrichtung als Pulsationsdämpfer oder Kolbenspeicher bezogen. Vielmehr ist allein eine Verwendung der klagepatentgemäßen Vorrichtung in hydraulischen Versorgungssystemen von Kraftfahrzeugen unter Schutz gestellt. Diese Voraussetzung ist im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform unstreitig verwirklicht. - b.
Die Merkmalsgruppe 2 verlangt eine integral ausgebildete Ausgleichkammer (Merkmal 2), die als abgeschlossener Raum ohne Zuleitung ausgebildet ist (Merkmal 2.2).
Hierzu heißt es in Abs. [0010] der Klagepatentschrift:
„Erfindungsgemäß ist zunächst erkannt worden, dass die gattungbildenden Pulsationsdämpfer in konstruktiver Hinsicht wenig gebrauchstauglich ausgebildet sind. In einem nächsten Schritt ist erkannt worden, dass die bekannten Pulsationsdämpfer im Hinblick auf die Abdichtung der Ausgleichkammer erhebliche Nachteile aufweisen. Schließlich ist erkannt worden, dass eine integrale Ausbildung der Ausgleichkammer, welche als abgeschlossener Raum ausgebildet ist, nur in geringem Maße Dichtungsvorkehrungen erfordert.“
Die erfindungsgemäße Lehre verzichtet damit ganz bewusst auf die im Stand der Technik vorhandenen Zuleitungen zur Ausgleichkammer, um damit verbundene Dichtigkeitsprobleme zu umgehen. Der Druck in der Ausgleichkammer soll vielmehr nach einmaliger Befüllung dauerhaft aufrechterhalten werden; eine Nach- bzw. Wiederbefüllung der Ausgleichkammer mit einem druckerzeugenden Medium ist nicht vorgesehen (vgl. Abs. [0011] und BPatGU S. 21).
Dabei wird die Ausgleichkammer im Wesentlichen durch den Grundkörper gebildet. Entsprechend formuliert das Klagepatent in seinem Anspruch 1, dass der Grundkörper die Ausgleichkammer „umfasst“. Der Grundkörper als solcher wird in der Klagepatentschrift zwar nicht definiert, anhand seiner Funktion, die Ausgleichkammer zu „umfassen“, erkennt der Fachmann aber, dass hiermit dasjenige Bauteil gemeint ist, das (im Wesentlichen) die Ausgleichkammer umschließt und sie hierdurch maßgeblich definiert.
Das BPatG hat in seinem Urteil vom 08.10.2022 aus diesem räumlichen Zusammenhang zwischen dem Grundkörper und der Ausgleichkammer den Schluss gezogen, das Klagepatent verlange mit der „integral ausgebildeten Ausgleichkammer“ einen Grundkörper, der durch eine sog. Integralbauweise aus einem Stück, beispielsweise durch einen Umformprozess hergestellt ist (vgl. BPatGU S. 20). Dem ist der BGH in seinem Urteil vom 16.04.2024 (dort Rn.14 ff.) entgegengetreten. Insbesondere aus Figur 3 der Klagepatenschrift ergebe sich, dass der Grundkörper nicht zwingend einstückig ausgebildet sein müsse; denn diese Figur zeige einen Grundkörper (1) mit einem separaten Deckel (21), welcher zusammen mit dem Kolben (13) die Ausgleichkammer (8) begrenze. Dem schließt der Senat sich – nach der stets gebotenen eigenen Prüfung des fachmännischen Verständnisses der Merkmale des Patentanspruchs (vgl. BGH, GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge) – an.
Das Klagepatent unterscheidet – sowohl in der allgemeinen Beschreibung als auch in der Darstellung bevorzugter Ausführungsbeispiele – ausdrücklich zwischen dem Grundkörper und der Ausgleichkammer. Während die Ausgleichkammer nach dem Anspruchswortlaut „integral“ ausgebildet ist (vgl. auch Abs. [0010]), kann der Grundkörper „einstückig“ ausgeführt sein (Abs. [0020], [0047]). Diese Unterscheidung hält die Klagepatentschrift durchgängig und konsequent bei. Für den Fachmann ist sie auch deshalb geboten, weil die Ausgleichkammer als Raum nicht einstückig ausgebildet sein kann.
„Integral“ und „einstückig“ werden von der Klagepatentschrift auch funktional nicht gleichgesetzt. Als vorteilhaft im Hinblick auf die Einstückigkeit des Grundkörpers bezeichnet es die Klagepatentschrift in Abs. [0020], dass diese die Fertigung eines Pulsationsdämpfers erlaube, der aus wenigen Teilen zusammensetzbar ist. Angesprochen ist damit ein erleichterter und damit kostengünstiger Herstellungsaufwand. Demgegenüber besteht der Vorteil der erfindungsgemäß ausgestalteten Ausgleichkammer als abgeschlossener Raum ohne Zuleitungen darin, dass auf aufwendige Abdichtungsmaßnahmen weitgehend verzichtet werden kann (vgl. Abs. [0010]).
Die Klagepatentschrift unterscheidet zwischen dem Ausführungsbeispiel nach Figur 2, das ausweislich Abs. [0047] einen einstückig als Tiefziehteil ausgebildeten Grundkörper zeigt, und dem Ausführungsbeispiel nach Figur 3, dessen Grundkörper zwar die Ausgleichkammer dergestalt umschließt, dass ein abgeschlossener Raum ohne Zuleitungen entsteht, der aber nicht einstückig ausgebildet ist, sondern vielmehr einen separaten Deckel (21) aufweist (vgl. Abs. [0048]). Dass Figur 3 nach den im Nichtigkeitsverfahren vorgenommenen Einschränkungen insbesondere des Klagepatentanspruchs 1 nicht mehr patentgemäß wäre, ist nicht ersichtlich (so auch: BGHU Rn. 23). Insbesondere ergibt sich dies nicht allein aus dem Umstand, dass die auf Figur 3 bezogenen ursprünglich erteilten Ansprüche 10 bis 13 im Nichtigkeitsverfahren gestrichen wurden. Eine Änderung der Klagepatentschrift dahingehend, dass Figur 3 nunmehr explizit als nicht erfindungsgemäß bezeichnet wird – wie dies im Hinblick auf Figur 1 der Fall ist – ist nicht erfolgt. In einem solchen Fall aber hat die Auslegung des Hauptanspruchs in der Regel so zu erfolgen, dass die in der Patentbeschreibung enthaltenen, nicht ausdrücklich als „nicht erfindungsgemäß bezeichneten Ausführungsbeispiele von ihm erfasst werden.
Für die Frage der Verletzung des Klagepatents bleibt die vorstehend diskutierte Frage der Auslegung von Merkmal 2 im Ergebnis ohne Bedeutung. Denn unstreitig ist bei der angegriffenen Ausführungsform der Grundkörper einstückig ausgebildet. Dass er nicht im Wege des Tiefziehverfahrens – sondern nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Klägerin mittels „Drückwalzen“ – hergestellt wurde, ist für die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre ohne Belang. Auf ein bestimmtes Herstellungsverfahren ist Patentanspruch 1 nicht beschränkt. Soweit die Beklagten entsprechendes aus dem Erfordernis einer einstückigen Bauweise des Grundkörpers abzuleiten versuchen, verfängt dies nach der vom Senat – in Übereinstimmung mit dem BGH – vertretenen Auslegung des Merkmals 2 bereits im Ansatz nicht, weil dieses Merkmal eine einstückige Bauweise des Grundkörpers nicht erfordert.
Die – unstreitig gebliebene – Herstellung der angegriffenen Ausführungsform mittels „Drückwalzen“ führt zugleich zu einer Verwirklichung des Merkmals 2.1. Hiernach ist die Innenwandung der Ausgleichkammer zumindest teilweise spanlos gefertigt. Eine spanlose Fertigung im Sinne dieses Merkmals ist ein Verfahren, bei dem kein Materialabtrag stattfindet (BGHU Rn. 30). Neben dem (lediglich) in der Beschreibung des Klagepatents hervorgehobenen Tiefziehen kommen hierfür auch andere Verfahren in Betracht. Der BGH benennt hier beispielhaft das Glattwalzen (BGHU Rn. 31). Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung am 05.12.2024 darauf abgestellt hat, der BGH verlange für die Verwirklichung des Merkmals 2.1, dass die Innenwandung der Ausgleichkammer auch unterhalb der Oberfläche die für eine spanlose Herstellung typische Materialstruktur aufweise (vgl. BGHU Rn 36 ff.), ist dies für die Entscheidung des Streitfalls ohne Belang. Denn unstreitig handelt es sich bei der Herstellung mittels Drückwalzen um ein spanloses Herstellungsverfahren, so dass die solchermaßen hergestellte Vorrichtung nicht nur an der Oberfläche der Innenwandung der Ausgleichkammer, sondern auch unterhalb dieser Oberfläche die für eine spanlose Herstellung typische Materialstruktur aufweist. Die vom BGH vorgenommene Differenzierung zwischen der Oberfläche der Innenwandung und dem Bereich unterhalb dieser Oberfläche erlangt überhaupt nur dann Bedeutung, wenn eine (angegriffene) Vorrichtung nicht durch ein spanloses Verfahren hergestellt ist und sich die Frage stellt, ob die Vorrichtung dennoch im Hinblick auf die Innenwandung der Ausgleichkammer Eigenschaften aufweist, die mit einem solchen Verfahren erzeugt werden können (vgl. BGHU Rn 32). - c.
Patentanspruch 10 sieht vor, einen Pulsationsdämpfer mit den Merkmalen von Anspruch 1 (unter optionaler Verwirklichung der Merkmale 2.1 und 5) herzustellen, indem die Bauteile zur Herstellung der Ausgleichkammer in einem Arbeitsraum zusammengefügt werden, der mit dem gleichen Druck beaufschlagt wird, der in der fertiggestellten Ausgleichkammer herrscht (Merkmal 2.4). Diese Vorgehensweise macht es möglich, in der Ausgleichkammer den gewünschten Druck zu erzeugen, ohne dass Gas über eine Zuleitung zugeführt werden muss (BGHU Rn. 14).
Aus Merkmal 2.4 folgt nicht, dass sich der Druck in der fertiggestellten Ausgleichkammer und der Druck in dem Arbeitsraum exakt entsprechen müssen. Maßgeblich für den Wortsinn eines Anspruchs ist nämlich der technische Sinn der verwendeten Begriffe, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2016, 169 Rn. 16 – Luftkappensystem; GRUR 2009, 655 – Trägerplatte; GRUR 2020, 159 Rn. 18 – Lenkergetriebe; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung, m.w.N.). Bei der Auslegung eines patentgemäßen Begriffs kommt es deshalb nicht auf das allgemeine Sprachverständnis an (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.12.2019 – I-15 U 97/16, GRUR-RS 2019, 54492 Rn. 39 – Einrichtung zum Installieren von Versorgungsleitungen; Urt. v. 29.04.2021 – I-15 U 4/20, GRUR-RS 2021, 16129 Rn. 70 – Endoskopievorrichtung; Urt. v. 24.05.2024 – I-2 U 67/23, GRUR-RS 2024, 16189 Rn. 63 – Kinderreisesitz). Es stellt vielmehr einen festen Grundsatz der Patentauslegung dar, dass jede Patentschrift ihr eigenes Lexikon für die in ihr gebrauchten Begrifflichkeiten darstellt und deswegen nur unter Heranziehung der Beschreibung und Zeichnungen Aufschluss darüber gewonnen werden kann, was der Anspruch mit einer bestimmten Formulierung meint. Das Auslegungsgebot gilt dabei generell und somit auch für Begriffe, die von der Formulierung her scheinbar eindeutig sind (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente, m.w.N.; GRUR 2021, 942 Rn. 21 – Anhängerkupplung II). Maßgeblich ist dabei die objektive Problemstellung der Erfindung, für deren Ermittlung zu klären ist, welche – nicht nur bevorzugten, sondern zwingenden – Vorteile mit dem Merkmal erzielt und welche Nachteile des vorbekannten Standes der Technik – nicht nur bevorzugt, sondern zwingend – mit dem Merkmal beseitigt werden sollen (OLG Düsseldorf, GRUR 2000, 599, 601 ff. – Staubsaugerfilter).
Merkmal 2.4 soll – im Zusammenspiel mit den Merkmalen 2.2 und 2.3 – die Herstellung einer Ausgleichkammer ermöglichen, die einen abgeschlossenen Raum ohne Zuleitungen bildet. Im Unterschied zu den im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen werden damit die mit Zuleitungen verbundenen Abdichtungsprobleme vermieden und eine Ausgleichkammer realisiert, in der nach einmaliger Befüllung der Druck dauerhaft aufrechterhalten wird, so dass auf aufwändige Wartungsmaßnahmen verzichtet werden kann. Soll bereits im Herstellungsverfahren vollständig auf Zuleitungen verzichtet werden, setzt dies eine Herstellung voraus, die bereits bei dem Zusammenfügen der Bauteile, die zur Ausbildung der Ausgleichkammer erforderlich sind, den in dieser erforderlichen Druck bereitstellt. Dies wird dadurch erreicht, dass gemäß Merkmal 2.2 zumindest die Bauteile des Pulsationsdämpfers, welche zur Herstellung der Ausgleichkammer benötigt werden, in einem Arbeitsraum positioniert werden. Weist der Arbeitsraum den in der Ausgleichkammer benötigten Druck auf, so kann dieser Druck durch ein Zusammenfügen der Bauteile in dem Arbeitsraum auch in der fertiggestellten Ausgleichkammer erreicht werden (vgl. hierzu auch Abs. [0027]). Die Ausgleichkammer ist dabei nach der erfindungsgemäßen Lehre in dem Moment fertiggestellt, in dem sie einen abgeschlossenen Raum bildet.
Der Fachmann erkennt anhand der Figur 2, dass der Kolben nach der abdichtenden Ausbildung der Ausgleichkammer noch ein Stück weiter in den Grundkörper eingeschoben werden kann, bis er seine Betriebsposition im Grundkörper erreicht hat und mit dem Sprengring gesichert ist. Notwendigerweise erhöht sich durch das Einschieben des Kolbens in den Grundkörper der Druck in der Ausgleichkammer, weil das darin befindliche Medium durch die Verkleinerung der Ausgleichkammer komprimiert wird. Soweit das BPatG in seinem Urteil vom 08.10.2021 (dort in Bezug auf die D11, S. 47) annimmt, dass in diesem Fall zur Verwirklichung von Merkmal 2.4 des Patentanspruchs 10 eine Erhöhung des Drucks im Arbeitsraum zu erfolgen habe, um die Druckverhältnisse anzugleichen, überzeugt den Senat dies nicht. Obwohl sich nämlich für den Fachmann hinsichtlich des in Figur 2 gezeigten Pulsationsdämpfers ein Herstellungsverfahren aufdrängt, bei dem die Ausgleichkammer in einfacher Weise durch ein Einschieben des Kolbens in den Grundkörper verschlossen wird, enthält die Klagepatentschrift keinen Hinweis darauf, dass in einem solchen Fall der im Arbeitsraum herrschende Druck zwingend erhöht und damit dem in der fertiggestellten Ausgleichkammer herrschenden Druck exakt angepasst werden muss.
Der Fachmann wird dies auch unter funktionalen Aspekten nicht für erforderlich halten. Denn der technische Zweck des Merkmals 2.4, die Herstellung eines Pulsationsdämpfers ohne Zuleitungen zur Ausgleichkammer zu ermöglichen (vgl. auch BGHU Rn 62), wird bereits erreicht, wenn im Arbeitsraum durch das Verschließen der Ausgleichkammer mittels des Kolbens der in der Ausgleichkammer gewünschte Druck erzeugt werden kann. Funktional unerheblich ist, ob dieser Druck durch die Komprimierung des in der Ausgleichkammer befindlichen Mediums ggf. geringfügig höher ist als der Druck, der in dem die Ausgleichkammer umgebenden Arbeitsraum herrscht. Der Fachmann begreift eine solche etwaige geringfügige Druckerhöhung als von der technischen Lehre des Patentanspruchs 10 umfasst. Für ihn gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass ein solcher Druckunterschied aus der Lehre des Klagepatents hinausführt bzw. dass es nach dem Klagepatent zwingend ist, in einem solchen Fall den Druck im Arbeitsraum an den (geringfügig) höheren Druck in der fertiggestellten Ausgleichkammer anzupassen. Letzteres ergibt für den Fachmann schon deshalb funktional keinen Sinn, weil die anspruchsgemäße Ausgleichkammer in diesem Moment bereits hergestellt ist.
Soweit die D5 (DE 37 44 179 A1) eine Möglichkeit offenbart, auch beim Einschieben des Kolbens in den Grundkörper eine Druckdifferenz zwischen der Ausgleichkammer und dem Arbeitsraum zu vermeiden, findet diese Schrift und damit die dort beschriebene Möglichkeit eines Ausgleichs entstehender Druckdifferenzen in der Klagepatentschrift keine Erwähnung. Die D5 gehört nicht zum gewürdigten Stand der Technik und ist damit nicht auslegungsrelevant. In dem vorstehend dargetanen Verständnis sieht sich der Senat durch die Ausführungen des BGH in seinem Nichtigkeitsberufungsurteil vom 16.04.2024 bestätigt. Dort hat der BGH festgestellt, dass „durch den in D5 vorgeschlagenen Stößel … sogar sichergestellt“ werde, „dass auch beim Einschieben des Kolbens keine Druckdifferenz entsteht“ (Unterstreichung durch den Senat). Der BGH versteht diesen Ausgleich der Druckdifferenz mithin als etwas, das über den Gegenstand der erfindungsgemäßen Lehre hinausgeht.
Unstreitig ist die angegriffene Ausführungsform nach dem zuvor beschriebenen Verfahren durch Einschieben des Kolbens in den Grundkörper hergestellt worden, wobei der Arbeitsraum mit dem gleichen Medium befüllt ist wie die Ausgleichkammer. Dass in der Folge innerhalb der fertiggestellten Ausgleichkammer ein höherer Druck herrscht als in dem sie umgebenden Arbeitsraum, steht der Verletzung des Klagepatents nach den vorstehenden Ausführungen nicht entgegen. Der von den Beklagten behauptete Druckunterschied von „mehr als 10%“ bewegt sich jedenfalls innerhalb der Toleranzgrenzen der erfindungsgemäßen Lehre. Diese werden in der Klagepatentschrift nicht beziffert; die Patentbeschreibung enthält überhaupt keine Hinweise auf ein bestimmtes Maß der erfindungsgemäßen Druckverhältnisse in der Ausgleichkammer und im Arbeitsraum. Welche Druckunterschiede im Einzelfall innerhalb der Toleranzgrenzen liegen, ist deshalb mit Blick auf die jeweils vorherrschenden Druckverhältnisse im konkreten Anwendungsfall zu beurteilen. Nach den insoweit unbestrittenen Behauptungen der Klägerin beträgt der Fülldruck der angegriffenen Ausführungsform 16 bar; toleriert wird von B eine Druckabweichung von -2 bar, mithin von 12,5%. Hiernach bewegt sich der von der Beklagten eingewandte Druckunterschied zwischen der fertiggestellten Ausgleichkammer und dem Arbeitsraum im zulässigen Toleranzbereich; Merkmal 2.4 ist verwirklicht. - 3.
Aufgrund des festgestellten Verletzungstatbestandes hat das Landgericht die Beklagten mit Recht zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung, zur Vernichtung und zum Rückruf verurteilt sowie die Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung bzw. von Schadensersatz festgestellt. Wegen der Begründung kann auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts (Umdruck S. 29 ff., Bl. 33 ff. eA) verwiesen werden, gegen die die Beklagten keinen konkreten Berufungsangriff richten. Hinsichtlich des Beklagten zu 4) war im Tenor sein Ausscheiden aus der Geschäftsführung der Beklagten zu 2) zum 07.09.2022 zu berücksichtigen. - III.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung zur Patentauslegung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung (§ 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Der Streitfall kann vielmehr auf der Grundlage gesicherter höchstrichterlicher Rechtsprechung entschieden werden.
Den Streitwert für die Berufungsinstanz hat der Senat auf 1.000.000 Euro festgesetzt. Die ergänzenden Ausführungen der Klägerin zu den die angegriffene Ausführungsform betreffenden Umsatzzahlen in der mündlichen Verhandlung am 05.12.2024 geben keinen Anlass, von der erstinstanzlichen Streitwertangabe der Klägerin, der das Landgericht in seinem Urteil vom 08.06.2022 – unbeanstandet – gefolgt ist, abzuweichen.