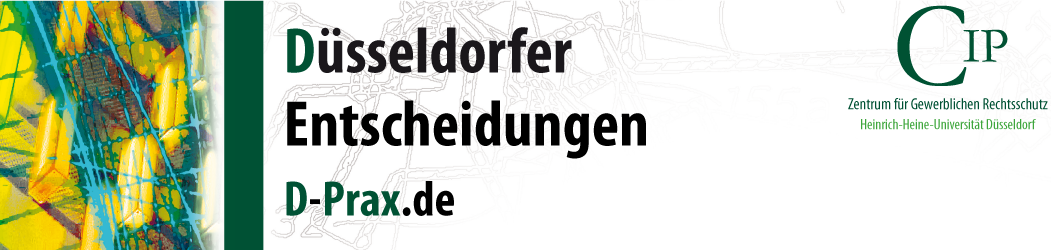Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3410
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 28. November 2024, I-2 U 31/24
Vorinstanz: 4b O 1/22
- I. Die Berufung der Klägerin gegen das am 30.06.2023 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
- III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind für die Beklagten wegen ihrer Kosten vorläufig vollstreckbar.
- Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.
- IV. Die Revision wird nicht zugelassen.
- V. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 9.850.000,- EUR festgesetzt.
- Gründe :
- I.
- Die Klägerin macht gegen die Beklagten patent- bzw. gebrauchsmusterrechtliche Vindikationsansprüche geltend und verlangt in diesem Zusammenhang ferner Auskunftserteilung, Abtretung von Schadensersatzansprüchen und die Feststellung einer Schadensersatzpflicht.
- Die Klägerin ist eine Tochtergesellschaft der A S.A. mit Sitz in der Schweiz. Der A-Konzern ist über Tochtergesellschaften auf dem Markt für Kaffeekapseln tätig.
-
Die Beklagte zu 1) stellt Kaffeekapseln her und verkauft diese sowie entsprechende Kaffeekapselmaschinen weltweit. Sie bietet in Deutschland ein eigenes Kaffee- und Getränkekapselsystem unter der Marke „B“ an. Die Beklagte zu 2) ist die Muttergesellschaft der Beklagten zu 1). Beide gehören zur Unternehmensgruppe der C GmbH & Co. KG. Einer der Geschäftsführer der Beklagten ist D, der in einer Vielzahl der streitgegenständlichen Schutzrechte der Beklagten als (Mit-)
Erfinder genannt ist. - Im Einzelnen ist die Beklagte zu 1) eingetragene Inhaberin der europäischen Patente EP 3 023 XXX, EP 3 521 XXX, EP 3 521 XXX sowie EP 3 521 XXX. Die Beklagte zu 2) ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents EP 3 521 XXX.
- Die Beklagte zu 1) ist ferner Inhaberin der europäischen Patentanmeldung EP 3 872 XXX und die Beklagte zu 2) ist Inhaberin der europäischen Patentanmeldung EP 3 533 XXX. Die Beklagte zu 1) ist auch Inhaberin der deutschen Patentanmeldungen DE 10 2010 031 XXX XX, DE 10 2010 044 XXX XX und DE 10 2011 010 XXX XX sowie der Euro PCT-Anmeldung WO 2012/010XXX XX.
- Ferner ist die Beklagte zu 1) Inhaberin der US-amerikanischen Patente US 11,554,XXX XX, US 10,858,XXX XX, US 10,858,XXX XX, US 10,870,XXX XX, US 10,994,XXX XX, US 11,254,XXX XX, US 11,230,XXX XX, US 11,542,XXX XX, US 11,465,XXX XX, US 11,465,XXX XX, US 11,548,XXX XX, US 11,667,XXX XX (während des Berufungsverfahrens hervorgegangen aus der Anmeldung US 17/324,XXX), US 11,820,XXX XX (während des Berufungsverfahrens hervorgegangen aus der Anmeldung US 17/108,XXX) und US 11,919,XXX XX (während des Berufungsverfahrens hervorgegangen aus der Anmeldung US 17/330,XXX). Sie ist außerdem Inhaberin der US-amerikanischen Patentanmeldung US 17/963,XXX, aus der ein Patent hervorgehen wird.
- Schließlich ist die Beklagte zu 1) eingetragene Inhaberin der deutschen Gebrauchsmuster DE 20 2011 111 XXX, DE 20 2011 111 XXX, DE 20 2011 111 XXX, DE 20 2011 111 XXX und DE 20 2011 111 XXX.
- Alle vorgenannten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen werden nachfolgend gemeinsam als „Streitschutzrechte“ und einzeln nach den letzten drei Ziffern ihrer Anmelde- bzw. Erteilungsnummer bezeichnet. Die früheste Priorität aller Streitschutzrechte datiert auf den 22.07.2010.
- Die Klägerin entwickelte unter dem Namen „C“ ein neues Heißgetränkesystem. Aus dem „C“ ging das sogenannte „D“-System hervor, welches der A-Konzern seit dem Jahr 2014 vermarktet.
- Die E AG (nachfolgend: E) ist eine in der Schweiz ansässige, international tätige Herstellerin von Haushalts- und Semiprofigeräten. Insbesondere entwickelt und produziert E Kaffeemaschinen für verschiedene Unternehmen, so auch für die G-Gruppe und die Beklagte zu 1).
- Die F AG (nachfolgend: F) ist ein Tochterunternehmen der Schweizer F Holding AG, die im Bereich der Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen tätig ist.
- Die Klägerin hat gegen die Beklagte zu 1) in der Schweiz u.a. Vindikationsansprüche betreffend die Schweizer/Liechtensteiner Teile der europäischen Patente EP ‘XXX, EP ‘XXX und EP ‘XXX geltend gemacht. Nach Erstellung eines Votums des zuständigen Fachrichters vom 19.04.2023 (Anlage AR 18; nachfolgend: Fachrichtervotum) hat das Schweizer Bundespatentgericht mit Urteil vom 02.08.2023 (Anlage K 23; nachfolgend: Urteil Bundespatentgericht Schweiz) die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde hat das Schweizer Bundesgericht mit Urteil vom 16.01.2024 abgewiesen (Anlage K 44; nachfolgend: Urteil Bundesgericht Schweiz).
- Die Klägerin hat erstinstanzlich geltend gemacht, die A G S.A. habe nach der Grundsteinlegung für das „D“-System F herangezogen und mit dieser am 20.07.2007 einen Rahmenvertrag für Forschung und Entwicklung (Anlage K E2) abgeschlossen. Nachdem ein Stadium erreicht gewesen sei, in dem eine Serienproduktion der Kaffeemaschinen und der zugehörigen Kapseln näher gerückt sei, habe sie zusätzlich E herangezogen. Vor der Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte am 22.07.2010 hätten zwei Treffen mit E im Rahmen des „C“ stattgefunden, nämlich am 02.06.2010 und ein weiteres „Kick off“-Meeting am 24.06.2010. H, ein damaliger Mitarbeiter der A G S.A., habe die Treffen geleitet und über den technischen Entwicklungsstand hinsichtlich der Kennung von Portionskapseln informiert. Sie, die Klägerin, habe Erfindungsbesitz an den Streitschutzrechten gehabt und dieser sei ihr widerrechtlich entnommen worden. Sie sei an allen Erfindungen sachlich berechtigt gewesen. Es sei aufgrund einer Vielzahl von Anhaltspunkten davon auszugehen, dass ein Wissenstransfer zwischen E und den Beklagten stattgefunden habe. Sofern kein Anspruch auf vollständige Übertragung der Streitschutzrechte bestehe, sei ihr, der Klägerin, zumindest eine Mitberechtigung einzuräumen. Bereits in erster Instanz hat die Klägerin u.a. die Vorlage der zwischen E und den Beklagten abgeschlossenen Kooperationsverträge verlangt und argumentiert, die Zusammenarbeit zwischen E und den Beklagten sei für sie eine „Blackbox“.
- Die Beklagten haben bereits vor dem Landgericht eine widerrechtliche Entnahme bestritten. Sie haben geltend gemacht, die Klägerin habe bereits nicht belegt, dass sie Erfindungsbesitz gehabt habe, da die von ihr vorgelegten Dokumente allein Ideen aufzeigten, deren Überlegungen zu den technischen Lösungen noch nicht abgeschlossen gewesen seien und deren konkrete Umsetzung noch ausgestanden habe. Vor allem aber habe die Klägerin nicht dargelegt und bewiesen, dass ein möglicher Erfindungsbesitz von ihr auf die E und von dieser auf sie, die Beklagten, übergegangen sei. Tatsächlich beruhten die Streitschutzrechte auf der eigenen Erfindungstätigkeit insbesondere ihres Geschäftsführers D. Die Beklagten haben ferner die Einrede der Verjährung erhoben und sich darauf berufen, die Geltendmachung der Ansprüche sei verwirkt und erfolge rechtsmissbräuchlich.
- Mit Urteil vom 30.06.2023 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt:
- Mangels ausreichender Bestimmtheit der Klageanträge unzulässig sei die Klage, soweit die Klägerin mit bestimmten Anträgen Bezug nehme auf Patente, „die auf der internationalen Anmeldung WO 2012/010XXX XX beruhen“. Im Übrigen sei die Klage zulässig, insbesondere sei die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte nach Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 EuGVVO gegeben.
- Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an den Streitschutzrechten richte sich nach deutschem Recht und sei nach den §§ 8 S. 2, 6 S. 2 PatG bzw. § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. §§ 8 S. 2, 6 S. 2 PatG zu beurteilen, da die Parteien im Sinne von Art. 14 Abs. 1 a) Rom II-VO in der mündlichen Verhandlung die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart hätten.
- Soweit es den Erfindungsbesitz angehe, fehle es teilweise bereits an dessen ausreichend substantiierter Darlegung. Dies gelte insoweit als die Streitschutzrechte – über das Vorhandensein einer Kennung in Form eines Barcodes auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselrandes hinaus – weitere, teilweise spezielle technische Merkmale aufwiesen und betreffe die US ‘XXX, die US ‘XXX, die US ‘XXX, die US ‘XXX, die US ‘XXX, die US ‘XXX sowie die Patente, die aus den US-amerikanischen Patentanmeldungen US ‘XXX und US ‘XXX hervorgegangen seien. Die pauschale und nicht näher konkretisierte Angabe, dass die eigenen Entwicklungen bestimmte, teilweise umfangreiche und/oder spezielle technische Merkmale vorgesehen hätten, reiche nicht aus. Es fehle insofern an einem konkreten Verweis auf eigene Entwicklungsunterlagen; zumindest aber hätte die Klägerin näher zu dem Kontext ausführen müssen, in dem ihre Entwicklungen gerade diese technischen Merkmale hätten vorsehen sollen. Ob und inwiefern die Klägerin im Übrigen ihren Erfindungsbesitz an den Streitschutzrechten dargelegt habe, insbesondere ob dieser von den Mitarbeitern von F auf sie übertragen worden sei, könne dahinstehen. Zumindest einen Wissenstransfer, für den sie darlegungs- und beweisbelastet sei, habe die Klägerin nicht aufzeigen können.
- Einen Wissenstransfer an E hinsichtlich der Kennung in Form eines Barcodes habe die Klägerin nicht dargetan. Die nach ihrem Vorbringen bei dem ersten Treffen mit E am 02.06.2010 gezeigte Präsentation „I“ (Anlage K E14, nachfolgend auch: I) weise zwar auf der Folie 15 mit einem Satz darauf hin, dass die Kapsel von der Maschine erkannt werden solle. Einen Hinweis auf die genaue Art und Weise – insbesondere auf die Anbringung eines Barcodes auf der der Membran abgewandten Seite – gebe die Präsentation jedoch nicht. Gleiches gelte für die in weiten Teilen mit der Präsentation I übereinstimmende Präsentation „J“ (Anlage K E15, nachfolgend auch: J).
- Im Hinblick auf die Kennung in Form eines Bitcodes, worauf die Klägerin hilfsweise abstelle, sei der Wissenstransfer zumindest fraglich. Zunächst sei ein Bitcode, bei dem es allein auf den Wechsel der Streifen ankomme, von einem Barcode, bei dem unterschiedlich breiten Strichen eine unterschiedliche Bedeutung zukomme, zu unterscheiden. Dies sei bereits durch ausländische Gerichte in parallelen Verletzungsverfahren bestätigt und in den dortigen Verfahren auch von der Klägerin selbst so vertreten worden. Im Übrigen lasse sich den Präsentationen I und 2 kein Bitcode auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselrandes entnehmen. Diese seien erst in den Figuren der Anlagen K E12a und K E13a zu sehen, bei denen es sich um eine Präsentation von F sowie um Figuren der ersten Prioritätsanmeldung der Klägerin vom 12.05.2010 handele. Diesen Anlagen könne jedoch nicht unmittelbar entnommen werden, dass sie im Rahmen der Treffen mit E gezeigt worden seien. Sofern die Klägerin vortrage, dass Herr K im Rahmen der Treffen auch die Anlagen K E12a und K E13a herangezogen und daran die Ausgestaltung der Kapseln gezeigt habe, bleibe dennoch offen, inwiefern den Mitarbeitern von E konkret mitgeteilt worden sei, welches System umgesetzt werden solle. Der Vortrag der Klägerin vermittele den Eindruck, dass diese sich im Juni 2010 noch nicht auf ein bestimmtes System festgelegt gehabt habe und gegenüber E allenfalls im Rahmen eines Brainstormings verschiedene Möglichkeiten einer Kapselkennung aufgezeigt habe.
- Jedenfalls fehle es aber an der Darlegung jeglichen Wissenstransfers von E auf die Beklagten, und damit auch in Bezug auf die Barcode- und Bitcode-Lösung. Allein die von der Klägerin behauptete enge Verbindung zwischen den Beklagten und E im Jahr 2010 besage nichts darüber, dass es zwischen beiden Unternehmen zu einem Wissenstransfer konkret im Hinblick auf die Lehren der Streitschutzrechte gekommen sei. Auch die Zusammenarbeit mit der gleichen Patentanwaltskanzlei begründe kein Verdachtsmoment für einen Wissenstransfer. Gleiches gelte für den Umstand, dass die Beklagte zu 1) und E am selben Tag Patentanmeldungen vorgenommen hätten. Es reiche auch nicht der Umstand aus, dass Herr L als Mitarbeiter von E sowohl an Projekten der Klägerin als auch an Projekten der Beklagten mitgearbeitet habe. Zum einen habe die Klägerin nicht aufgezeigt, dass Herr L überhaupt an dem Treffen teilgenommen habe, bei dem die Präsentationen I und 2 gezeigt worden seien. Zum anderen trage die Klägerin selbst vor, dass die Mitarbeiter von E an diversen Projekten mit ihren, der Klägerin, Wettbewerbern beteiligt gewesen seien. Offensichtlich sei es dabei noch nie zu einer unerlaubten Weitergabe von Informationen gekommen, so dass auch in dieser Hinsicht keine Vermutung dahingehend bestehe, dass E nicht vertraulich mit Kundeninformationen umgehe. Das Joint Venture (M AG) zwischen E und den Beklagten lasse eine Wissensweitergabe ebenfalls nicht als naheliegend erscheinen; ebenso wenig spreche die von der Klägerin vorgenommene Gegenüberstellung ihrer Entwicklungsdokumente mit der Patentanmeldung (Anlage K 5) für einen Wissenstransfer. Es spiele auch keine Rolle, dass die Beklagten die Barcode-Lösung selbst nicht nutzten. Schließlich sei es kein zulässiger Einwand, wenn die Klägerin geltend mache, die Beklagten hätten bei den Streitschutzrechten auf ein willkürliches Konglomerat trivialer Merkmale einer Portionskapsel zurückgegriffen. Diese Argumentation laufe dem generellen und damit auch für Einwände der Klägerseite geltenden Rechtsgedanken zuwider, wonach die Schutzfähigkeit der begehrten Anmeldung oder des Patents nicht mit Erfolg eingewendet werden könne. Insgesamt handele es sich bei der Behauptung der Klägerin, dass es im Hinblick auf die Barcode-Lösung zu einem irgendwie gearteten Wissenstransfer zwischen ihr und E einerseits sowie zwischen E und den Beklagten andererseits gekommen sei, um eine bloße Mutmaßung. Die Klägerin zeige keinen einzigen konkreten Anhaltspunkt dafür auf, zu welcher Gelegenheit es von welchen Personen zu einem konkreten Wissensaustausch in Bezug auf die erfindungsgemäßen Lehren gekommen sein könnte. Dies gelte vor allem deshalb, weil die Klägerin selbst davon ausgehe, dass dies nur „versehentlich“ geschehen sein könnte.
- Den Beklagten obliege auch keine sekundäre Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf ihre eigene Erfindungstätigkeit. Die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Schleppfahrzeug“ entwickelten Grundsätze, wonach der Patentanmelder die Umstände, aus denen er eine Doppelerfindung ableite, eingehend zu substantiieren habe, fänden keine Anwendung. Denn diese setzten voraus, dass feststehe, dass der auf Abtretung der Rechte Klagende im Besitz der streitigen Erfindung gewesen sei, zwischen den Parteien Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden hätten und der Anmelder im Anschluss daran die Erfindung zum Patent angemeldet habe. Hierzu reiche es aus, wenn der Kläger darlege und beweise, dass er die in Anspruch genommene Lehre entwickelt und dem späteren Anmelder vor dessen Anmeldung mitgeteilt habe. Da die Klägerin jedoch bereits nicht behauptet habe, den Beklagten oder einer der Beklagten die in Anspruch genommene Lehre unmittelbar mitgeteilt zu haben, obliege es diesen nicht, zu dem Entstehen ihrer Erfindungen vorzutragen. Dies entspreche auch den allgemeinen und vom Bundesgerichtshof zuletzt in der Entscheidung „Brustimplantat“ bestätigten Grundsätzen zur Beweislastumkehr, wonach sich der Gegner nicht auf ein substanzloses Bestreiten zurückziehen dürfe, wenn ihm nach Lage der Dinge ein substantiiertes Bestreiten möglich und zumutbar sei, sofern ein substantiierter Vortrag der darlegungspflichtigen Partei vorliege. Die Klägerin habe hinsichtlich des außerhalb ihrer eigenen Wahrnehmung stehenden Wissenstransfers von E auf die Beklagten bereits keine ausreichenden Anstrengungen unternommen, sich das Wissen von E zu verschaffen. Soweit die Klägerin hierzu erklärt habe, dass sie aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht weiter gegen E vorgegangen sei, sei zwar nachvollziehbar, dass sie den Ansatz nicht weiterverfolge und keinen der Mitarbeiter als Zeugen benannt habe. Es könne aber nicht zu Lasten der Beklagten gehen.
- Im Übrigen hätten sich die Beklagten – soweit es ihnen möglich sei – erklärt, indem sie plausibel dargelegt hätten, dass sie das Wissen um die erfindungsgemäße Lehre nicht von E erhalten hätten und dass die Erfindungen im Wesentlichen von D getätigt worden seien. Insofern hätten sie sogar zu einer Doppelerfindung vorgetragen. Es erscheine plausibel, dass der genaue Hergang der Erfindungen nach mehr als zehn Jahren nicht mehr im Detail nachvollzogen werden könne. Jedenfalls hätten sie mit ihrem Vorbringen ihrer sekundären Darlegungs- und Beweislast genügt und es hätte der Klägerin oblegen, nunmehr näher vorzutragen und ggf. Beweis zu erbringen. Sofern die Klägerin auf Aufbewahrungspflichten des Patentanwalts N verweise, sei das nicht ausreichend, zumal dieser erklärt habe, dass die entsprechenden Handakten im Rahmen eines Umzugs vernichtet worden und nunmehr jedenfalls nicht mehr vorhanden seien. Soweit Patentanwalt N im Erteilungsverfahren betreffend das EP ‘XXX Unterlagen (erneut) eingereicht habe, lasse sich daraus nicht herleiten, dass auch noch weitere Dokumente – wie handschriftliche Notizen oder Skizzen – vorhanden seien. Schließlich gehe es nicht zu Lasten der Beklagten, dass sie ihren in einem parallelen Verfahren in der Schweiz gehaltenen Vortrag zu einer Offenbarung der technischen Lösung der Kapselsysteme der Prioritätsanmeldungen der Streitschutzrechte durch D gegenüber Patentanwalt N hätten „abschwächen“ müssen und dass sie lediglich einen Kalendereintrag zu einem Treffen von D mit Patentanwalt N vom 04.12.2009 ohne nähere Informationen hätten.
- Auch die Vorlage von Urkunden könne die Klägerin nicht verlangen. Eine Anordnung nach § 142 Abs. 1, 1. Var. ZPO scheitere daran, dass die Klägerin zu den Voraussetzungen einer widerrechtlichen Entnahme durch die Beklagten nicht hinreichend vorgetragen habe und es sich daher bei dem Begehren um reine Ausforschung handele. Allein der Hinweis, dass das Verhältnis zwischen E und den Beklagten für sie eine „Blackbox“ sei, stelle keinen Grund für die Anordnung der Vorlage von Urkunden dar. Es hätte vielmehr der Darlegung konkreter Anhaltspunkte für einen Wissenstransfer bedurft. Auch die Voraussetzungen der § 142 Abs. 1, 2. Var., Abs. 2 ZPO, der §§ 421 Abs. 1, 2. Var., Abs. 2 ZPO, des § 140c Abs. 1 S. 1, 1. Var. PatG oder der §§ 809, 810 BGB seien nicht gegeben.
- Es finde überdies die in § 8 S. 3 PatG normierte Ausschlussfrist von zwei Jahren Anwendung auf die Patente EP ‘XXX und EP ‘XXX sowie über § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 3 PatG auch auf die Gebrauchsmuster DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX und DE ‘XXX, so dass etwaige Vindikationsansprüche auch aus diesem Grund ausgeschlossen seien. Die Ausnahme nach § 8 S. 5 PatG, wonach die Frist nicht gelte, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben gewesen sei, sei nicht anwendbar. Zur Bösgläubigkeit der Beklagten habe die Klägerin nicht hinreichend vorgetragen, vielmehr habe sie im Zusammenhang mit dem Wissenstransfer geltend gemacht, dass es sich dabei auch um einen versehentlichen Transfer gehandelt haben könnte. Dann fehle es aber gerade an der Bösgläubigkeit, die voraussetze, dass die Beklagten um den Erfindungsbesitz der Klägerin gewusst und die Streitschutzrechte in Kenntnis dessen angemeldet hätten.
- Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf Verurteilung der Beklagten weiterverfolgt. Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen, wobei sie insbesondere geltend macht:
- Das Landgericht habe zu Unrecht den Vindikationsanspruch im Hinblick auf die Streitschutzrechte auf Grundlage einer unzutreffenden Tatsachen- und Beweiswürdigung sowie einer fehlerhaften Rechtsanwendung verneint.
- Die Anwendung von § 8 PatG sei rechtsfehlerhaft, weil mit Art. II § 5 IntPatÜG im deutschen Recht eine Spezialregelung für europäische Patentanmeldungen und Patente existiere.
- Alle Rechte an den Erfindungen im Rahmen des D-Projekts lägen bei ihr, der Klägerin. Die technische Lehre der Streitschutzrechte sei im Rahmen des D-Projekts durch ihre Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmer ihrer Rechtsvorgänger und Schwesterunternehmen sowie Arbeitnehmer von F gemacht worden, die ihre Rechte als Erfinder an den jeweiligen Arbeitgeber kraft Gesetzes, d.h. gemäß Art. 332 Abs. 1 OR (Schweizerisches Obligationenrecht), abgetreten hätten. Die Arbeitnehmer hätten die Erfindungen im Rahmen des D-Projekts während ihrer Arbeitszeit gemacht, womit es sich um Diensterfindungen handele. Alle Entwicklungen sowie die daraus resultierenden Erfindungen seien aufgrund von Überleitungsverträgen bei der O S.A. (nachfolgend: O) zusammengelaufen. Auch F als Entwicklungspartner habe die von ihren Mitarbeitern erworbenen Rechte aus dem D-Projekt an O abgetreten. Im Rahmen ihrer Fusion mit O seien sämtliche Aktiva auf sie, die Klägerin, übergegangen, insbesondere sämtliche Schutzrechte und Rechte an Erfindungen.
- In der Berufungsinstanz trägt die Klägerin weiter zu den Anstellungsverhältnissen der Erfinder und weiterer Mitwirkender im D-Projekt vor und legt verschiedene arbeitsvertragliche Unterlagen vor. Sie macht ferner geltend, soweit die Beklagten erstmals in der Berufungserwiderung argumentierten, dass im Hinblick auf die Erfinder des D-Systems keine Arbeitsverträge gemäß Art. 319 ff. OR sowie keine Diensterfindungen gemäß Art. 332 OR vorlägen, sei dieses Bestreiten verspätet.
- Sie, die Klägerin, sei schon im Januar 2010 und erst recht im Mai 2010 im Besitz aller Merkmale der Streitschutzrechte als fertige und ausführbare Erfindung gewesen, insbesondere sämtlicher Merkmale des EP ‘XXX betreffend eine Portionskapsel mit Barcode auf der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs. Soweit das Landgericht annehme, sie, die Klägerin, habe sich im Juni 2010 noch nicht auf ein bestimmtes System festgelegt und gegenüber E allenfalls im Rahmen eines Brainstormings verschiedene Möglichkeiten einer Kapselkennung aufgezeigt, sei das unrichtig. Die Technologie, auf der das D-System basiere, sei zu diesem Zeitpunkt bis auf den Ort der Anbringung des optischen Codes bereits fertig konzipiert gewesen. Für die Anbringung des optischen Codes habe es lediglich noch zwei Optionen gegeben habe, nämlich auf der Flanschunterseite oder der Membran.
- Ihr Erfindungsbesitz ergebe sich insbesondere aus den folgenden Unterlagen:
- Wie der technische Richter des Schweizer Bundespatentgerichts bestätigt habe, ergebe sich dieser aus der folgenden Darstellung auf Seite 491, Ziffer 6 der Anlage K E9 („Erfindungsbesitz I“):
- Ferner ergebe sich der Erfindungsbesitz für eine Kapsel mit Code auf der Flanschrückseite aus den Minutes des Entwicklertreffens vom 14.04.2010 (Anlage K E12b), wo es unter anderem auf Seite 6 heiße: „Optical design for reading … on rim bottom is done“ („Erfindungsbesitz II“). Lediglich das Merkmal, wonach ein Barcode verwendet werde, sei nicht ausdrücklich offenbart.
- Darüber hinaus zeigten die nachfolgend eingeblendeten Darstellungen gemäß Anlage K E12a vom 15.04.2010 (Folien 4, 5, 8 und 9) sowie Anlage K E14a vom 08.06.2010 (Folie 19) jeweils alle Merkmale von Patentanspruch 1 des EP ‘XXX einschließlich der Anordnung eines optisch auslesbaren Codes auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches („Erfindungsbesitz III“):
- Allein das Merkmal, wonach der optische Code ein Barcode sei, finde sich auch hier nicht ausdrücklich.
- Schließlich ergebe sich ihr Erfindungsbesitz auch aus ihren am 12.05.2010 und 13.07.2010 eingereichten Prioritätsanmeldungen, deren Figuren samt Beschreibung sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 des EP ‘XXX einschließlich der Anordnung eines optisch auslesbaren Codes auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches zeigten („Erfindungsbesitz IV“). Lediglich das Merkmal, wonach ein Barcode verwendet werde, werde auch hier nicht ausdrücklich offenbart. Veranschaulichen lasse sich dies anhand der nachfolgend eingeblendeten Abbildung der Figuren 5 und 6 gemäß Anlage K E13a, die identisch auch im zweiten Prioritätsdokument vom 13.07.2010 sowie in den WO ‘XXX und WO ‘XXX enthalten seien:
- Auch das Protokoll eines Entwicklertreffens im Rahmen des „C“ vom 02.06.2010 (Anlage K E14c) bestätige ihren Erfindungsbesitz, insbesondere die Anordnung eines optischen Codes auf der Unterseite des Randbereichs einer Kapsel („Erfindungsbesitz V“).
- Dass sie, die Klägerin, Erfindungsbesitz im Hinblick auf einen Barcode gehabt habe, werde auch durch zwei kürzlich ergangene Entscheidungen des Patent Trial and Appeal Board des U.S. Patent and Trademark Office (PTAB) gestützt, in denen sämtliche Ansprüche der Streitschutzrechte US ‘XXX und US ‘XXX als nicht patentfähig eingestuft worden seien, weil bereits zwei Anmeldungen der A-Gruppe zusammen einen Barcode auf der Unterseite des Kapselflansches offenbarten.
- Selbst wenn man annehmen sollte, dass sie, die Klägerin, lediglich Erfindungsbesitz im Hinblick auf einen Bitcode auf der Unterseite des Flansches/Randbereichs einer Kaffeeportionskapsel gehabt habe, wäre die Abwandlung eines Bitcodes in einen an derselben Stelle angeordneten Barcode eine nicht-schöpferische Modifikation im Rahmen des Könnens des Fachmanns. Der Fachmann habe verschiedene Codes zur Erkennung einer Portionskapsel für die automatische Parametereinstellung gekannt, wozu auch Bitcodes und Barcodes gehörten. Soweit die Beklagten argumentierten, dass verschiedene Orte der Anbringung eines Codes auf der Kapsel, nämlich auf der Membran oder auf der ihr abgewandten Seite am Kapselrand, in der Umsetzung völlig unterschiedliche Systeme voraussetzten, greife dies nicht durch. Die meisten Streitschutzrechte beschränkten sich allein auf die Kapsel, so dass das System, mit dem die Extraktion dieser Kapsel erfolge, aus rechtlichen Gründen unerheblich sei. Auch der Ort der Anbringung des Codes mache gemäß der Lehre der Streitschutzrechte keinen erheblichen Unterschied, zumal diese explizit beide Positionen benannten, ohne unterschiedliche Extraktionssysteme zu zeigen.
- Soweit das Landgericht davon ausgehe, dass die Lehren der Streitschutzrechte zum Teil technische Merkmale beanspruchten, hinsichtlich derer sie, die Klägerin, den Erfindungsbesitz nicht ausreichend dargelegt und substantiiert habe, sei dies unrichtig. Das Landgericht habe nicht berücksichtigt, dass sie vorgetragen habe, dass einige Merkmale keinen technischen Effekt hätten oder dass es sich bei diesen Merkmalen um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns handele, die den Kern der Erfindung unberührt lasse.
- Zu Unrecht habe das Landgericht auch den Wissenstransfer von ihr, der Klägerin, auf ihre Kooperationspartnerin E („Wissenstransfer I“) und von dieser auf die Beklagten („Wissenstransfer II“) verneint.
- Sie, die Klägerin, habe E vor der Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte (22.07.2010) sämtliche Merkmale der Streitschutzrechte offenbart („Wissenstransfer I“). Die vom Landgericht vorgenommene Differenzierung zwischen einem Barcode und einem Bitcode sei zwar grundsätzlich richtig, in diesem Zusammenhang aber nicht relevant, da sie, die Klägerin, die Vertreter von E über einen optischen Code auf der Unterseite des Kapselrandes informiert habe. Der Barcode sei der bekannteste Vertreter eines optischen Codes und daher jedermann geläufig, wenn man von einem optischen Code spreche. Den Wissenstransfer II habe das Landgericht ohne Beweiserhebung verneint, obwohl sie Beweis dafür angeboten habe, dass Herr K E bei dem Treffen am 02.06.2010 die Merkmale der Streitschutzrechte offenbart habe.
- Bereits im ersten Treffen vom 02.06.2010 seien die Teilnehmer von Seiten von E – P, Q und R – umfassend über die Details der Technologie hinter dem D-Projekt informiert worden. Ihnen sei die Präsentation gemäß Anlage K E14 gezeigt und sie seien zusätzlich mündlich informiert worden. Herr K habe den Teilnehmern in dem Treffen sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 von EP ‘XXX mitgeteilt; er sei sich allerdings nicht sicher, ob er auch ausdrücklich von einem „Barcode“ als optischem Code gesprochen habe. Er habe die Teilnehmer von E auch darüber informiert, dass für die Anbringung des Codes zwei mögliche Orte denkbar seien, nämlich entweder auf der Membran oder auf der Unterseite des Flansches/Randbereichs, und dass dieser Code von einem Codelesegerät gelesen werde. Den Beteiligten sei klar gewesen, dass als Code neben einem Bitcode auch ein Barcode als bekanntester Vertreter eines optischen Codes, der per Lesegerät ausgelesen werde, infrage komme.
- Die Beklagten hätten in dem relevanten Zeitraum 2009 bis 2010 eine sehr enge technische und wirtschaftliche Kooperation mit E unterhalten, die dazu geführt habe, dass die Beklagte zu 1) nur wenige Wochen nach dem ersten Treffen zwischen ihr, der Klägerin, und E die ersten Anmeldungen gemäß den Streitschutzrechten eingereicht habe. Die Zusammenarbeit habe genau denselben technischen Bereich betroffen wie ihre, der Klägerin, Zusammenarbeit mit E. Erwähnenswert sei auch, dass das erste Patent im Register des Europäischen Patentamts, bei dem D als Erfinder benannt sei, am 19.10.2010 von E unter Inanspruchnahme von zwei Prioritätsanmeldungen aus der Unternehmensgruppe der Beklagten vom 19.10.2009 angemeldet worden sei, was ein weiterer Beleg für die enge Zusammenarbeit sei. Überdies habe es unstreitig eine Absprache gegeben, wie etwaige aus der Zusammenarbeit hervorgehende Schutzrechte zwischen den Beklagten (kaffeekapselbezogene Erfindungen) und E (kaffeemaschinenbezogene Erfindungen) aufgeteilt werden sollten. Entsprechend sei auch unstreitig D als Erfinder von Patentanmeldungen benannt, die allein im Namen von E für Kaffeemaschinen eingereicht worden seien. Darüber hinaus seien die Beklagten und E unstreitig auch bereits in den Jahren 2009 und 2010 von derselben Patentanwaltskanzlei (S) vertreten worden. Die Prioritätsanmeldungen und damit alle Streitschutzrechte stammten – wie anhand der Anmeldung der DE ‘XXX (betreffend eine Kaffeemaschine) durch E und der DE ‘XXX (betreffend Kaffeekapseln) durch die Beklagten am selben Tag und unter Verwendung teils identischer Figuren deutlich werde – aus der Zusammenarbeit der Beklagten mit E, was zudem durch eine Erklärung von D in einem US-Verfahren bestätigt werde. Im Jahr 2010 sowie in den Folgejahren seien Mitarbeiter von E, die am D-Projekt gearbeitet hätten, auch in Projekten der Beklagten zu 1) eingesetzt worden. Dies gelte insbesondere für den im Jahr 2010 als „Leiter Vorentwicklung R&D“ bei E angestellten T, der überdies in mindestens einem Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt zugunsten der Beklagten und zu Lasten der Klägerin ausgesagt habe. Schließlich sei als Beleg für die enge Verbundenheit zwischen den Unternehmensgruppen E und C das im Jahr 2016 von P, Gründer und CEO von E, und D gegründete Joint Venture M AG zu nennen.
- E habe die technischen Informationen aus dem D-Projekt – versehentlich oder willentlich – in dem Zeitraum zwischen dem ersten Treffen mit der Klägerin am 02.06.2010 und der ersten Prioritätsanmeldung der Beklagten vom 22.07.2010 an diese weitergegeben. Hierfür spreche eine Vielzahl an Anhaltspunkten, die das Landgericht entgegen § 286 ZPO entweder gar nicht oder jedenfalls nicht in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt habe:
- Neben der bereits ausgeführten engen Verbindung zwischen E und den Beklagten sei zu berücksichtigen, dass die Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nur sechs Wochen nach dem ersten Treffen durch die bereits erwähnte Patentanwaltskanzlei S erfolgt sei. Ferner seien nicht nur einige wenige, sondern sämtliche Ideen aus den Anmeldungen der Streitschutzrechte bereits in ihren Entwicklungsdokumenten – insbesondere den Anlagen K E7 und K E9 – enthalten gewesen. D verfüge zudem über keinerlei technische Ausbildung und sei auch erst im Jahr 2009 zur C-Gruppe gestoßen, um dort die Kaffeekapselsparte überhaupt aufzubauen. Die Beklagten nutzten ferner die Barcode-Lösung der Streitschutzrechte selbst nicht und sie könnten nicht einmal im Ansatz eine eigene Entwicklungsgeschichte präsentieren. Im Übrigen erkenne das Landgericht in seinem den Tatbestandsberichtigungsantrag zurückweisenden Beschluss selbst an, dass Kaffeekapsel und Maschine aufeinander bezogen sein müssten und eine getrennte Entwicklung ausscheide, was als weiterer Anhaltspunkt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten spreche.
- Jüngste Erkenntnisse aus dem US-Verfahren – von denen ihre deutschen Prozessbevollmächtigten erstmals im Zusammenhang mit einem am 23.08.2024 eingereichten Schriftsatz (Anlage K 56/K 56a) erfahren hätten – belegten, dass Informationen im Hinblick auf die Erfinderschaft an den Streitpatenten von E an die Beklagten weitergegeben worden seien. Die dortigen Fakten zeigten, dass T relevante Merkmale der Streitschutzrechte – beispielsweise hinsichtlich Rillen an der Kapselwand – an die Beklagten weitergegeben habe und belegten damit den Wissenstransfer II. Dies werde sich ferner aller Voraussicht nach aus den Dokumenten aus der U.S. Discovery ergeben, die in den redigierten Passagen von Anlage K 56 vermutlich besprochen würden. Jedoch hätten weder sie selbst noch ihre hiesigen Prozessbevollmächtigte aufgrund der U.S. Protective Order hierauf Zugriff.
- Schließlich habe das Landgericht den Beklagten zu Unrecht nicht die sekundäre Darlegungs- und Beweislast in Bezug auf die eigene Erfindungstätigkeit auferlegt. Die vielen Anhaltspunkte für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten hätte das Landgericht dahingehend würdigen müssen, dass es nunmehr an den Beklagten gewesen wäre, ihre angebliche Erfindungstätigkeit darzulegen und ggf. zu beweisen. Zudem habe das Landgericht den überaus dürftigen und widersprüchlichen Vortrag der Beklagten zur eigenen Erfindungstätigkeit sowie die Abwesenheit jeglicher schriftlicher Unterlagen trotz noch bestehender berufsrechtlicher Aufbewahrungspflichten durch den Patentanwalt, der die den Streitschutzrechten zugrundeliegenden Anmeldungen ausgearbeitet und eingereicht habe, unzutreffend gewürdigt. Neben der Konstellation, in der es Erörterungen über die Auswertung der Erfindung gegeben habe, könne es auch andere Fallgestaltungen geben, in denen eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast eingreife. So müsse eine sekundäre Darlegungslast gerade auch in solchen Fällen greifen, in denen eine Vielzahl an Anhaltspunkten dafür spreche, dass ein Wissenstransfer stattgefunden habe, und dem Entnehmer die Offenlegung der eigenen Erfindungstätigkeit ohne Weiteres möglich und zumutbar sei. Dies gelte insbesondere in Fällen, in denen ein Mittelsmann involviert und – wie hier – dargelegt worden sei, dass dem Mittelsmann sämtliche Erfindungsgedanken mitgeteilt worden seien, wobei der Mittelsmann unstreitig mit den Beklagten in demselben technischen Gebiet kooperiere. Entgegen der Darstellung des Landgerichts habe sie, die Klägerin, zudem durchaus Anstrengungen unternommen, sich das Wissen betreffend einen möglichen Wissenstransfer von E zu verschaffen, diese insbesondere mehrfach kontaktiert.
- Soweit das Landgericht angenommen habe, dass die Beklagten im Rahmen ihrer Möglichkeiten Vortrag geleistet hätten, sei dies unzutreffend. Der Vortrag der Beklagten beziehe sich ausschließlich auf Randaspekte und habe mit der eigentlichen Entwicklungsgeschichte nicht zu tun. Im Hinblick auf die Anspruchsmerkmale sei das Vorbringen der Beklagten oberflächlich, lückenhaft und ohne Substanz.
- Soweit die Beklagten in der Berufungserwiderung erstmals geltend machten, dass D den Barcode auf der Unterseite des Randbereichs der Portionskapsel platziert habe, weil er dort nicht verschmutze und das Risiko von physischen Beschädigungen kleiner sei, sei der Vortrag verspätet und werde dieser bestritten. Wäre dies entscheidend gewesen, wäre es in die Streitschutzrechte aufgenommen worden. Tatsächlich werde die Anbringung des Codes auf der Unterseite des Kapselflansches in den Streitschutzrechten nicht einmal als vorzugswürdig beschrieben, sondern nur als eine von mehreren, gleichwertigen Orten der Anbringung des Barcodes genannt. Auch die Vorlage des angeblichen Kalenderauszugs von D aus Juli 2019 (Anlage AR 20) – der im Übrigen Fragen aufwerfe – sei als verspätet zurückzuweisen. Gleiches gelte für den Kalendereintrag von D vom 04.12.2009 (Anlage AR 21), der ihr, der Klägerin, entgegen der Darstellung der Beklagten nicht bekannt gewesen sei, sowie für die gänzlich unergiebige „Rechnungsübersicht“ der Patentanwälte S (Anlage AR 22).
- Das Urteil des Landgerichts sei auch deshalb fehlerhaft, weil darin ausschließlich die Alleinerfinderstellung geprüft und verneint worden sei, nicht hingegen auch eine Miterfinderstellung. Dies gelte insbesondere mit Blick auf den Umstand, dass sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 von EP ‘XXX – ggf. bis auf das Merkmal betreffend den Barcode – gegenüber E offenbart worden seien.
- Entgegen der Auffassung des Landgerichts seien die Ansprüche auch nicht hinsichtlich der Patente EP ‘XXX und EP ‘XXX sowie der Gebrauchsmuster DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX und DE ‘XXX gemäß § 8 S. 3 PatG ausgeschlossen. § 8 PatG sei auf die Patente EP ‘XXX und EP ‘XXX schon nicht anwendbar, da insoweit Art. II § 5 IntPatÜG als spezialgesetzliche Regel für europäische Patente vorgehe. Die somit einschlägige zweijährige Ausschlussfrist gemäß Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜG sei jedenfalls für das EP ‘XXX gewahrt. Für die EP ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX, DE ‘XXX und DE ‘XXX sowie die weiteren Streitschutzrechte greife die zweijährige Ausschlussfrist ebenfalls nicht ein, weil die Beklagten bei der Anmeldung der Streitschutzrechte gewusst hätten, dass die Erfindungen, auf denen diese basierten, von der Klägerin stammten, sie also bei der Anmeldung im Sinne von § 8 S. 5 PatG bzw. Art. II § 5 Abs. 2, Hs. 2 IntPatÜG bösgläubig gewesen seien. Soweit das Landgericht darauf abstelle, dass sie, die Klägerin, vorgetragen habe, es könne sich um einen versehentlichen Wissenstransfer gehandelt haben, verkenne es, dass zwar der Wissenstransfer versehentlich erfolgt sein könne, die Beklagten aber gewusst hätten, dass die Erfindungsgedanken von ihr, der Klägerin, stammten.
- Die geltend gemachten Ansprüche seien schließlich auch nicht verjährt, zumal sie erst Ende 2021 eine ausreichende Informationsbasis hinsichtlich der den Vindikationsanspruch begründenden Umstände gehabt habe.
- Die Anordnung einer Urkundenvorlage habe das Landgericht ebenfalls zu Unrecht und unter Zugrundelegung eines falschen rechtlichen Maßstabes abgelehnt. Darüber hinaus seien ihre in der Berufungsinstanz im Anschluss an die Erkenntnisse aus dem US-Verfahren präzisierten und neu gestellten Vorlageanträge begründet.
- Die Klägerin beantragt,
- A. das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 30.06.2023 (Az.: 4b O 1/22) abzuändern;
- B. die Beklagte zu 1) zu verurteilen,
- I. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an den Europäischen Patenten
-
– Nr. 3 023 XXX mit dem Titel „Portionskapsel mit Kennung“ (mit Ausnahme des schweizerischen/liechtensteinischen nationalen Teils, nationale Veröffentlichungsnummer: EP3023XXX),
– Nr. 3 521 XXX mit dem Titel „Portionskapsel mit Barcode“ (mit Ausnahme des schweizerischen/liechtensteinischen nationalen Teils, nationale Veröffentlichungsnummer: EP3521XXX),
– Nr. 3 521 XXX mit dem Titel „Portionskapsel mit Barcode“ (mit Ausnahme des schweizerischen/liechtensteinischen nationalen Teils, nationale Veröffentlichungsnummer: EP3521XXX) und
– Nr. 3 521 XXX mit dem Titel „Portionskapsel mit Barcode“ - für alle benannten Vertragsstaaten einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern in die entsprechende Umschreibung des jeweiligen Patents einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin in den jeweiligen Patentregistern jeweils als Inhaberin geführt wird;
- II. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an den Europäischen Patentanmeldungen
- – Nr. 3 872 XXX mit dem Titel „U“
- für alle benannten Vertragsstaaten einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern in die entsprechende Umschreibung des jeweiligen Patents einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin in den jeweiligen Patentregistern jeweils als Inhaberin geführt wird;
- III. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an den deutschen Patentanmeldungen
-
– DE 10 2010 031 XXX mit dem Titel „V“,
– DE 10 2010 044 XXX mit dem Titel „W“ und
– DE 10 2011 010 XXX mit dem Titel „AA“ - einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die entsprechende Umschreibung der Patentanmeldungen einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin im deutschen Patentregister als Inhaberin geführt wird;
- hilfsweise
- festzustellen, dass die Beklagte zu 1) seit Anmeldung der deutschen Patentanmeldungen
-
– DE 10 2010 031 XXX mit dem Titel „XXX“,
– DE 10 2010 044 XXX mit dem Titel „XXX“ und
– DE 10 2011 010 XXX mit dem Titel „XXX“ - keine Berechtigung an der Inhaberschaft dieser deutschen Patentanmeldungen hatte;
- IV. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an den deutschen Gebrauchsmustern
-
– Nr. DE 20 2011 111 XXX mit dem Titel „XXX“
– Nr. DE 20 2011 111 XXX mit dem Titel „XXX“,
– Nr. DE 20 2011 111 XXX mit dem Titel „XXX“,
– Nr. DE 20 2011 111 XXX mit dem Titel „XXX“ und
– Nr. DE 20 2011 111 XXX mit dem Titel „XXX“ - einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die entsprechende Umschreibung der Gebrauchsmuster einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin im deutschen Patentregister als Inhaberin geführt wird;
- V. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an der PCT-Anmeldung
- – Nr. WO 2012 010XXX XX mit dem Titel „Portionskapsel mit Kennung“,
- einzuräumen und durch Erklärung gegenüber der Weltorganisation für geistiges Eigentum in die entsprechende Umschreibung der PCT-Anmeldung einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin im Patentregister als Inhaberin geführt wird;
- VI. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an den US-amerikanischen Patenten
-
– Nr. US 11,554,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 10,858,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 10,858,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 10,870,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 10,994,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 11,254,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 11,230,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 11,542,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 11,465,XXX XX mit dem Titel „AB“,
– Nr. US 11,465,XXX XX mit dem Titel „AB“
– Nr. US 11,548,XXX XX mit dem Titel „AB“
– Nr. US 11,919,XXX XX mit dem Titel „AB“
– Nr. US 11,820,XXX XX mit dem Titel „AB“
– Nr. US 11,667,XXX XX mit dem Titel „AB“
– das US-Patent, das aus der Anmeldung Nr. US 17/963,XXX mit dem Titel „AB” hervorgehen wird - einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem United States Patent and Trademark Office in die entsprechende Umschreibung der Patente einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin im US-amerikanischen Patentregister als Inhaberin geführt wird;
- VII. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, inwieweit weitere parallele ausländische Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen zu den unter Ziffer B.I.-B.VII. genannten Schutzrechten, die die deutschen Patentanmeldungen DE 10 2010 031 XXX, DE 10 2010 044 XXX und/oder DE 10 2011 010 XXX als Priorität beanspruchen, bestehen, und zwar unter Angabe der entsprechenden Länder, amtlichen Kennzeichen, Anmelder bzw. Inhaber, den zugehörigen anwaltlichen Vertretern sowie dem Status des Erteilungsverfahrens;
- VIII. der Klägerin die Schadensersatzansprüche abzutreten, die aus den unter Ziffern B.I.–B.VII. bezeichneten Schutzrechten entstanden sind bzw. im Hinblick auf diese entstanden sind, wobei für das unter Ziffer C.I. bezeichnete Patent die Ansprüche bis einschließlich zum 24.05.2021 erfasst sind;
- IX. festzustellen, dass die Beklagte zu 1) verpflichtet ist, der Klägerin den aufgrund der Vorenthaltung der in Ziffern B.I.–B.VII. genannten Schutzrechten entstandenen und zukünftig entstehenden Schaden zu ersetzen;
- C. die Beklagte zu 2) zu verurteilen
- I. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an dem europäischen Patent
- – Nr. 3 521 XXX mit dem Titel „XXX“
- für alle benannten Vertragsstaaten einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern in die entsprechende Umschreibung des Patents einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin in den jeweiligen Patentregistern jeweils als Inhaberin geführt wird;
- II. der Klägerin die ihr zustehende Inhaberschaft an der Europäischen Patentanmeldung
- – Nr. 3 533 XXX mit dem Titel „XXX“
- für alle benannten Vertragsstaaten einzuräumen und durch Erklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt und den jeweiligen nationalen Patentämtern in die entsprechende Umschreibung des Patents einzuwilligen mit der Maßgabe, dass die Klägerin in den jeweiligen Patentregistern jeweils als Inhaberin geführt wird;
- III. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, inwieweit weitere parallele ausländische Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen zu den unter Ziffer C.I. und C.II. genannten Schutzrechten, die die deutschen Patentanmeldungen DE 10 2010 031 XXX, DE 10 2010 044 XXX und/oder DE 10 2011 010 XXX als Priorität beanspruchen, bestehen, und zwar unter Angabe der entsprechenden Länder, amtlichen Kennzeichen, Anmelder bzw. Inhaber, den zugehörigen anwaltlichen Vertretern sowie dem Status des Erteilungsverfahrens;
- IV. der Klägerin die Schadensersatzansprüche und Entschädigungsleistungsansprüche abzutreten, die aus den unter Ziffern C.I. und C.II. bezeichneten Schutzrechten entstanden sind bzw. im Hinblick auf diese entstanden sind, wobei für das unter Ziffer C.I. bezeichnete Patent die Ansprüche seit dem 25.05.2021 und für die unter Ziffer C.II. bezeichnete Patentanmeldung die Ansprüche seit dem 20.01.2022 erfasst sind;
- V. es wird festgestellt, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerin den aufgrund der Vorenthaltung der in Ziffern C.I. und C.II. genannten Schutzrechte entstandenen und zukünftig entstehenden Schaden zu ersetzen;
- D. Urkundenvorlage
-
I. gemäß § 142 Abs. 1 Var. 1 ZPO und §§ 421, 422, 425, 427 ZPO anzuordnen, dass die Beklagten die folgenden, in ihrem Besitz befindlichen Dokumente vorlegen:
Entwicklungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von März 2010;
Herstellungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von Oktober 2010;
E-Mails, Schriftstücke und sonstige Dokumente zwischen den Beklagten und Herrn D einerseits sowie Herrn T und der E AG andererseits im Zeitraum vom April 2009 bis zum 07.02.2011; -
II. gemäß § 142 Abs. 1 Var. 2, Abs. 2 ZPO anzuordnen, dass die C GmbH & Co. KG, AC, die folgenden, in ihrem Besitz befindlichen Dokumente vorlegt:
Entwicklungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von März 2010;
Herstellungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von Oktober 2010;
E-Mails, Schriftstücke und sonstige Dokumente zwischen den Beklagten, Herrn D und Herrn AD einerseits sowie Herrn T und der E AG andererseits im Zeitraum vom April 2009 bis zum 07.02.2011; - III. Herausgabe der Kommunikation (E-Mails, Briefe etc.) zwischen den Beklagten und der E AG zwischen April 2009 und dem 07.02.2011;
- hilfsweise
-
IV. die Beklagten in entsprechender Anwendung von § 140c Abs. 1 S. 1 Var. 1 PatG zu verurteilen, der Klägerin die folgenden, in ihrem Besitz befindlichen Dokumente vorzulegen:
Entwicklungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von März 2010;
Herstellungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von Oktober 2010;
E-Mails, Schriftstücke und sonstige Dokumente zwischen den Beklagten, Herrn D und Herrn AD einerseits sowie Herrn T und der E AG andererseits im Zeitraum von April 2009 bis zum 07.02.2011; - äußerst hilfsweise
-
V. die Beklagten gemäß §§ 809, 810 BGB zu verurteilen, der Klägerin die folgenden, in ihrem Besitz befindlichen Dokumente vorzulegen oder deren Besichtigung zu gestatten:
Entwicklungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von März 2010;
Herstellungsvertrag zwischen den Beklagten und der E AG von Oktober 2010;
E-Mails, Schriftstücke und sonstige Dokumente zwischen den Beklagten, Herrn D und Herrn AD einerseits sowie Herrn T und der E AG andererseits im Zeitraum von April 2009 bis zum 07.02.2011; - E. Urkundenvorlage
- I. gemäß § 142 Abs. 1 Var. 1 ZPO und §§ 421, 422, 425, 427 ZPO anzuordnen, dass die Beklagten die in ihrem Besitz befindliche, ungeschwärzte Fassung des Schriftsatzes vom 23.08.2024 aus dem parallelen US-Verfahren (Az. 2:22-cv-00525-GW-AGR, Dokument Nr. 114) gemäß Anlage K 56 samt den dort referenzierten Dokumenten aus der U.S. Discovery vorlegen;
- II. gemäß § 142 Abs. 1 Var. 2, Abs. 2 ZPO anzuordnen, dass die C GmbH & Co. KG, AC, die in ihrem Besitz befindliche, ungeschwärzte Fassung des Schriftsatzes vom 23.08.2024 aus dem parallelen US-Verfahren (Az. 2:22-cv-00525-GW-AGR, Dokument Nr. 114) gemäß Anlage K 56 samt den dort referenzierten Dokumenten aus der U.S. Discovery vorlegt;
- hilfsweise
- III. die Beklagten in entsprechender Anwendung von § 140c Abs. 1 S. 1 Var. 1 PatG zu verurteilen, der Klägerin die in ihrem Besitz befindliche, ungeschwärzte Fassung des Schriftsatzes vom 23.08.2024 aus dem parallelen US-Verfahren (Az. 2:22-cv-00525-GW-AGR, Dokument Nr. 114) gemäß Anlage K 56 samt den dort referenzierten Dokumenten aus der U.S. Discovery vorzulegen;
- äußerst hilfsweise
- IV. die Beklagten gemäß §§ 809, 810 BGB zu verurteilen, der Klägerin die in ihrem Besitz befindliche, ungeschwärzte Fassung des Schriftsatzes vom 23.08.2024 aus dem parallelen US-Verfahren (Az. 2:22-cv-00525-GW-AGR, Dokument Nr. 114) gemäß Anlage K 56 samt den dort referenzierten Dokumenten aus der U.S. Discovery vorzulegen oder deren Besichtigung zu gestatten.
- Die Beklagten beantragen,
- die Berufung zurückzuweisen;
- die Vorlageanträge der Klägerin einschließlich der neuen Vorlageanträge zurückzuweisen.
- Sie verteidigen das angefochtene Urteil und treten den Ausführungen der Klägerin unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Einzelnen entgegen.
- Die Klägerin habe ihre materielle Berechtigung an der Erfindung ebenso wenig substantiiert und prüfbar dargetan wie im parallelen Verfahren in der Schweiz, in dem die Klage abgewiesen worden sei, weil die Klägerin nicht einmal behauptet und belegt habe, dass F die angeblichen Rechte an der Erfindung erworben habe. Sie habe weder dargetan, dass die angeblichen F-Mitarbeiter tatsächlich auf Basis eines Arbeitsvertrages im Sinne von Art. 319 ff. OR bei F angestellt gewesen seien, noch, dass es sich bei der angeblichen Erfindung um eine Diensterfindung gehandelt habe. Nur wenn diese Punkte dargelegt und bewiesen seien, könne sich die Klägerin jedoch auf eine Vermutung des Übergangs der Erfindung nach Art. 332 Abs. 1 OR berufen. Entsprechendes gelte für die Übertragung der Erfindung durch Mitarbeiter der O S.A. und der A G S.A. auf diese Unternehmen. Es fehle überdies belegbarer Tatsachenvortrag zum Übergang etwaiger auf F übergegangener Erfinderrechte auf die Klägerin. Dass das C von dem Rahmenvertrag mit O S.A. umfasst gewesen sei, werde bestritten. Der erst in der Berufungsreplik und -triplik erfolgte weitere Vortrag der Klägerin zu ihrer materiellen Berechtigung an der vermeintlichen Erfindung sei präkludiert sowie innerhalb der Berufungsinstanz verspätet. Er sei zudem nicht geeignet, die materielle Berechtigung der Klägerin schlüssig darzulegen.
- Den Erfindungsbesitz der Klägerin habe das Landgericht zu Recht abgelehnt. Das einzige Dokument, welches einen Barcode an der der Membran abgewandten Seite der Kapsel zeigen könnte, sei die Anlage K E9 vom 21.01.2010. Dabei handele es sich um eine 500-seitige Sammlung von 66 Ideen („Brainstorming Inputs“). Wer der Urheber der Darstellung unter Ziffer 6 auf Seite 491 sei, bleibe unklar. Diese Ideen von auf Seiten von F tätigen Personen seien zunächst nicht weiterverfolgt worden; deshalb enthalte auch kein anderes Dokument im relevanten Zeitraum einen Barcode an der der Membran abgewandten Seite des Flansches oder andere Identifikationsmittel aus der Ideensammlung. Hinsichtlich des neu vorgelegten Dokuments Anlage K E14c-Ü, welches wiederum von einer Person auf Seiten von F verfasst worden sei, rügten sie Verspätung. Auch dieses Dokument zeige zudem keinen Barcode.
- Die Klägerin habe einen vindikationsrelevanten Wissenstransfer weder von ihr selbst auf E („Wissenstransfer I“) noch von E auf sie, die Beklagten („Wissenstransfer II“), dargelegt und bewiesen.
- Bei dem Treffen zwischen der Klägerin und E am 02.06.2010 sei überhaupt noch nicht klar gewesen, ob eine Zusammenarbeit überhaupt zustande kommen würde. Es sei ausweislich der Präsentationen zudem allein darum gegangen, dass E auf Basis des neu entwickelten Extraktionsprozesses eine Maschine habe bauen sollen. Ebenso seien bei dem Kick-Off am 24.06.2010 keine Informationen zu einer „AE“ an E übermittelt worden, und zwar weder schriftlich in der Präsentation gemäß Anlage K E15 noch mündlich. Zu Recht sei das Landgericht davon ausgegangen, dass das D-System am 02.06.2010 noch nicht fertig entwickelt gewesen sei. Entsprechend solle auch der als Zeuge benannte Herr K allenfalls bestätigen können, dass sich ein optisch auslesbarer Code an zwei Orten befinden könne. Diese verschiedenen Orte – auf der Membran oder auf der ihr abgewandten Seite am Kapselrand – setzten in der Umsetzung jedoch völlig unterschiedliche Systeme voraus.
- Zu Recht habe das Landgericht im Zusammenhang mit dem angeblichen Wissenstransfer II sämtliche Punkte bewertet und festgestellt, dass diese einen Wissenstransfer nicht belegten. Im Zeitpunkt des behaupteten Wissenstransfers II im Juni 2010 habe die Zusammenarbeit zwischen ihnen, den Beklagten, und E noch ganz am Anfang gestanden; von einer „engen“ Verbindung könne keine Rede sein. Hingegen habe E zu diesem Zeitpunkt schon seit vielen Jahren G-Maschinen hergestellt und das Vertrauensverhältnis zu der Klägerin bestehe bis heute. Wie im OEM-Bereich üblich, produziere E für viele Wettbewerber. Es sei für diese daher lebensnotwendig, vertrauliche Informationen der Kunden vertraulich zu handhaben. E habe zudem bestätigt, keine Informationen weitergegeben zu haben.
- Die von der Klägerin vorgelegten Entscheidungen des PTAB (Anlagen K 57 und K 58) besagten nichts zum vermeintlichen Erfindungsbesitz der Klägerin im maßgeblichen Zeitraum. Die Anmeldung US ‘XXX aus Mai 2010 lehre nur die Verwendung eines Barcodes, nicht dessen Anordnung auf der Unterseite des Kapselflansches. Die Anmeldung US ‘XXX sei erst im Mai 2011 eingereicht worden, d.h. nach dem Prioritätstag der Streitschutzrechte im Juli 2010.
- Bei dem als Anlage K 56 vorgelegten Schriftsatz handele es sich um die eigene Klageerwiderung der Klägerin in einem Patentverletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten. Die darin behaupteten Vorgänge hätten sich ausnahmslos nach dem ersten Prioritätsdatum der Streitschutzrechte ereignet. Darüber hinaus sei hinsichtlich der dort gegenständlichen Merkmale (Zahnrad, Dorn, Dichtung, Haltearme, usw.) ein Wissenstransfer I, d.h. von der Klägerin auf E, noch nicht einmal behauptet worden.
- Insgesamt sei die Unterstellung eines Wissenstransfers auf sie, die Beklagten, rein spekulativ und unplausibel. Binnen kürzester Zeit – nämlich zwischen dem Treffen am 02.06.2010 und der ersten Prioritätsanmeldung der Streitschutzrechte am 22.07.2010 – müssten die Informationen von den Teilnehmern des Treffens, nämlich P, Q und R – ggf. über weitere Mitarbeiter von E – an sie gelangt sein. Sie, die Beklagten, müssten sodann einen Nebenaspekt der mitgeteilten Informationen – im Fokus des Treffens vom 02.06.2010 habe schließlich nicht die Kapselerkennung, sondern das neue Extraktionssystem gestanden – vom neuartigen Kapselsystem auf konventionelle Kaffeekapseln übertragen, die Aufgabenstellung von der Einstellung von Brühparametern zur Verhinderung von „Fremdkapseln“ ausgewechselt und die erfindungsgemäße Lösung als (in den Ansprüchen nicht ausdrücklich benanntes) Ausführungsbeispiel in ihre erste Prioritätsanmeldung aufgenommen haben. Zutreffend habe das Landgericht erkannt, dass dies nicht zusammenpasse.
- Da weder eine Anspruchsberechtigung noch ein Wissenstransfer vorliege, hätten sie zu ihrer eigenen Erfindung genügend vorgetragen. Eine weitergehende subjektive Darlegungs- oder Beweislast sei nicht begründet, zumal die angeblichen Vorgänge bei E ebenso wenig in ihrer Sphäre lägen wie in derjenigen der Klägerin.
- Jedenfalls aber hätten sie, die Beklagten, die Erfindung selbst getätigt und hierzu – soweit es ihnen möglich sei – trotz fehlender sekundärer Darlegungslast substantiiert vorgetragen. D habe die Erfindung Ende 2009 gemacht, weil er durch Gespräche mit anderen Marktteilnehmern im Mai und Juli 2009 erkannt habe, dass eine Individualisierung der Kapseln notwendig sei. Bekannt gewesen sei, wie sich unter anderem aus der Anlage K E7 ergebe (dort S. 22), ein Barcode auf der Membran. D habe den Barcode auf der Unterseite des Randbereichs der Portionskapsel platziert, weil er dort nicht verschmutze und das Risiko von physischen Beschädigungen kleiner sei. Bei einem Treffen Ende 2009 hätten D und Patentanwalt AF die Möglichkeit eines Patentschutzes für die von Herrn AG ins Auge gefassten Identifikationssysteme erörtert. Unter anderem habe Herr AG dabei von seiner Idee berichtet, den Barcode auf der Unterseite des Flansches anzuordnen. Anhand des Kalendereintrages in Anlage AR 21 und aufgrund der Rechnung in Anlage AR 22 – beides legen die Beklagten erstmals in der Berufungsinstanz vor – gingen sie davon aus, dass diese Besprechung am 04.12.2009 stattgefunden habe. Herr AG habe N beauftragt, seine Erfindungen zur Anmeldung zu bringen, was schließlich zu den Prioritätsanmeldungen der Streitschutzrechte beginnend ab dem 22.07.2010 geführt habe. Zu der damaligen Entstehung der Erfindung, der Erfindungsmeldung eines Barcodes als Kapselkennung an der Unterseite des Flansches und der Besprechung dieser Erfindung im Dezember 2009 mit Patentanwalt N existierten keine Unterlagen mehr, weder in Papierform noch digital.
- Die Ausführungen im landgerichtlichen Urteil zum Eingreifen der Ausschlussfrist seien zutreffend; im Übrigen seien die Ansprüche auch verjährt.
- Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.
- II.
- Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen Erfolg.
- A.
- Nachdem die Klägerin ihre Anträge in der Berufungsinstanz teilweise konkretisiert hat, genügt die Klage nunmehr insgesamt den Zulässigkeitsvoraussetzungen.
-
1.
Die – auch im Berufungsrechtszug zu prüfende (vgl. BGH, NJW 2004, 1456) – internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte ist auch im Hinblick auf die von der Klägerin verlangte Abtretung bzw. Übertragung nicht deutscher Schutzrechtsanmeldungen bzw. Schutzrechte gegeben. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts, gegen die sich die Parteien in der Berufungsinstanz auch nicht wenden, wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. -
2.
Die in der Berufungsinstanz neu gefassten Auskunftsanträge sind hinreichend bestimmt. Der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch muss nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO so deutlich gefasst sein, dass bei einer den Klageanträgen stattgebenden Verurteilung die Reichweite des Urteilsausspruchs feststeht. Ein auf Auskunftserteilung gerichteter Klageantrag muss unter Bezugnahme auf die konkrete (Verletzungs-)handlung so bestimmt gefasst sein, dass er auch für das Vollstreckungsgericht hinreichend klar erkennen lässt, worüber der Beklagte Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen hat (vgl. BGH, GRUR 2007, 871 – Wagenfeld-Leuchte; GRUR 2008, 357 Rn. 21 – Pfandfreigabesystem; Senat, Urt. v. 09.03.2017 – I-2 U 42/16, BeckRS 2017, 109831 Rn. 36 – Tropfenabscheideranordnung). Der Antrag muss den Gegenstand des Auskunftsbegehrens so genau bezeichnen, dass über dessen Inhalt keinerlei Ungewissheit bestehen kann (Senat, Urt. v. 09.03.2017 – I-2 U 42/16, BeckRS 2017, 109831 Rn. 36 – Tropfenabscheideranordnung). Die von der Klägerin in der Berufungsinstanz zuletzt gestellten Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge werden diesen Anforderungen gerecht. Indem sie auf Schutzrechte abstellen, die die DE ‘XXX, DE ‘XXX und/
oder DE ‘XXX als Priorität beanspruchen, lassen sich die betroffenen Schutzrechte nunmehr klar abgrenzen. - B.
- Die Klage ist jedoch unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass der Klägerin die gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf patent- bzw. gebrauchsmusterrechtliche Vindikation, Auskunft, Abtretung von Ansprüchen und Schadensersatz nicht zustehen.
-
1.
Patent- bzw. gebrauchsmusterrechtliche Vindikationsansprüche gegen die Beklagten stehen der Klägerin nicht zu. Sie kann weder die vollständige Übertragung bzw. Abtretung der Streitschutzrechte verlangen noch hat sie insoweit einen Anspruch auf Einräumung einer Mitinhaberschaft. -
a)
Dies gilt zunächst mit Blick auf das von der Klägerin in den Fokus ihrer Ausführungen gestellte EP ‘XXX. -
aa)
Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die als Inhaberin des EP ‘XXX eingetragene Beklagte zu 1) aus Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG zu. -
(1)
Entgegen der Auffassung des Landgerichts handelt es sich bei dem für europäische Patente geltenden Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG allerdings um die für das Begehren nach Übertragung des EP ‘XXX – und zwar hinsichtlich aller seiner nationalen Teile (vgl. Senat, Urt. v. 27.02.2003 – I-2 U 42/00, juris Rn. 222 – Hub-Kipp-Vorrichtung; OLG Karlsruhe, GRUR 2018, 1030 Rn. 24 – Rohrleitungsprüfung; a.A.: Nieder, GRUR 2015, 936, 938 f.; McGuire; Mitt. 2019, 197, 199; Krahforst, Mitt. 2019, 207, 210) – in Betracht kommende vindikationsrechtliche Anspruchsgrundlage. Der vom Landgericht herangezogene § 8 PatG findet hingegen keine Anwendung. Zwar haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht übereinstimmend erklärt, dass für die geltend gemachten Vindikationsansprüche deutsches Recht anwendbar sein soll. Unabhängig von der Wirksamkeit der damit verbundenen Rechtswahl (dazu noch unter l) bb)) verbleibt es indes bei der Anwendbarkeit des Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG auf die begehrte Übertragung des EP ‘XXX, weil diese Vorschrift deutsches Recht ist und daher auch bei einer wirksamen Vereinbarung deutschen Rechts zur Anwendung gelangen würde. Art. II § 5 IntPatÜG ist insoweit für nach dem EPÜ erteilte Patente lex specialis gegenüber § 8 PatG (Nieder, GRUR 2015, 936, 938). -
(2)
Gemäß Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG kann der nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents abgetreten wird. Hat die europäische Patentanmeldung – wie im Fall des EP ‘XXX – bereits zum europäischen Patent geführt, so kann der nach Art. 60 Abs. 1 EPÜ Berechtigte vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen, Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG. Dass diese Voraussetzungen gegeben sind, lässt sich auf der Grundlage des Vorbringens der Klägerin nicht feststellen. Die Klägerin kann weder die vollständige Übertragung des EP ‘XXX auf sie (dazu unter (a)) noch – als Minus – die Einräumung einer Mitberechtigung (dazu unter (b)) verlangen. -
(a)
Die Klägerin hat keinen Anspruch auf eine Vollübertragung des EP ‘XXX. Dabei kann offen bleiben, ob sie die im Sinne des Art. 60 Abs. 1 EPÜ Berechtigte an der von ihr behaupteten Erfindung ist. Selbst wenn man unterstellt, dass sämtliche in ihrem eigenen Konzern sowie bei F getätigten Erfindungen im Zusammenhang mit dem D-Projekt auf sie übergegangen sind, war die Klägerin im maßgeblichen Zeitpunkt nicht im Besitz einer fertigen und mit dem Gegenstand der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung. Ein diesbezüglicher Wissenstransfer an die Beklagten kommt vor diesem Hintergrund ebenfalls nicht in Betracht. -
(aa)
Der Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG setzt voraus, dass sich der Anspruchsteller zum maßgeblichen Zeitpunkt im Besitz einer fertigen Erfindung befunden hat, die mit dem Gegenstand der Anmeldung oder des erteilten Patents – hier des EP ‘XXX – wesensgleich ist (Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 91 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; OLG München, Urt. v. 07.12.2017 – 6 U 4503/16, juris Rn. 117; Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 21). - Maßgeblicher Zeitpunkt ist, was zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit steht, sowohl für das EP ‘XXX als auch für sämtliche anderen Streitschutzrechte der 22.07.2010 als Anmeldetag der ältesten Priorität aller Streitschutzrechte. Dass die Klägerin vor diesem Zeitpunkt im Besitz einer mit dem Gegenstand des EP ‘XXX wesensgleichen und fertigen Erfindung war, ist nicht feststellbar.
-
(aaa)
Die Erfindung des Vindikationsklägers ist mit dem Gegenstand der streitigen Anmeldung wesensgleich, wenn beide im technischen Problem und seiner Lösung im Wesentlichen übereinstimmen (vgl. BGH, GRUR 1981, 186, 188 – Spinnturbine II; Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 91 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; Urt. v. 09.03.2017 – I-2 U 42/16, BeckRS 2017, 109831 Rn. 58 – Tropfenabscheideranordnung; OLG München, Urt. v. 07.12.2017 – 6 U 4503/16, juris Rn. 117; BeckOK PatR/Konertz/Kubis, 33. Ed. Stand: 15.07.2024, § 8 Rn. 20). Aufgabe und Lösung sind nicht nach der subjektiven Vorstellung der Beteiligten, sondern objektiv anhand der tatsächlichen Lösung der technischen Probleme zu bestimmen. Entscheidend ist, welches technische Problem durch die angemeldete Erfindung tatsächlich gelöst wird (BGH, GRUR 1981, 186, 188 f. – Spinnturbine II; Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 101 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; Urt. v. 09.03.2017 – I-2 U 42/16, BeckRS 2017, 109831 Rn. 58 – Tropfenabscheideranordnung; OLG München, Urteil vom 07.12.2017 – 6 U 4503/16, juris Rn. 117; BeckOK/Konertz/Kubis, PatR, 33. Ed. Stand: 15.07.2024, § 8 Rn. 20). Ein Vindikationsanspruch ist nicht nur bei einer in diesem Sinne bestimmten konkreten gegenständlichen Übereinstimmung gerechtfertigt, sondern auch dann, wenn das Entnommene ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart hat, von dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betrifft (BGH, GRUR 1981, 186, 189 – Spinnturbine II; BeckOK/Konertz/Kubis, PatR, 33. Ed. Stand: 15.07.2024, § 8 Rn. 20; Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 21). Abänderungen im Rahmen des Fachkönnens, die den Kern der Erfindung unberührt lassen, sind unschädlich (Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 21). - Fertig ist die Erfindung, wenn die ihr zugrunde liegende Lehre technisch ausführbar ist, wenn also der Durchschnittsfachmann nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg arbeiten kann (BGH, GRUR 1971, 210, 212 – Wildverbißverhinderung; Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 91 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung). Dabei ist nicht auf die subjektive Meinung des Erfinders, sondern auf die Erkenntnis des Durchschnittsfachmanns abzustellen (BGH, GRUR 1971, 210, 212 – Wildverbißverhinderung; BeckOK/Konertz/Kubis, PatR, 33. Ed. Stand: 15.07.2024, § 8 Rn. 19).
-
(bbb)
Der danach vorzunehmende prüfende Vergleich zwischen der in dem EP ‘XXX beanspruchten Lehre (dazu unter (i)) mit der von der Klägerin behaupteten Erfindung (dazu unter (ii)) ergibt, dass es vor der frühesten Priorität der Streitschutzrechte an einer fertigen und mit der Lehre des herausverlangten Schutzrechts wesensgleichen Erfindung fehlte (dazu unter (iii)). -
(i)
Das EP ‘XXX betrifft eine Portionskapsel mit Kennung. - Die Patentschrift schildert, dass derartige Portionskapseln hinlänglich, beispielsweise aus der WO 02/078498 A1, der US 2010/078480 A1 sowie der US 2008/187638 A1, bekannt seien und in einer Vielzahl von Ausführungsformen am Markt angeboten würden. Da sich diese Kapseln oftmals relativ ähnlich seien, könne es, so das EP ‘XXX, vorkommen, dass Kapseln eines Herstellers in Kaffeeautomaten eines anderen Herstellers verwendet würden, wofür sie nicht geeignet seien. Dadurch könnten sich erhebliche Sicherheitsprobleme ergeben und/oder der Kaffeeautomat könne beschädigt werden (Abs. [0001]).
- Eine Verpackung mit einem Barcode zur Zubereitung eines Getränks sei auch in der US 2002/0048XXX beschrieben (Abs. [0001]).
- Vor dem geschilderten Hintergrund hat es sich das EP ‘XXX zur Aufgabe gemacht, eine Portionskapsel zur Verfügung zu stellen, die nur für einen ganz bestimmten Kaffeeautomaten geeignet ist (Abs. [0002]).
- Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 des EP ‘XXX eine Kaffeekapsel mit folgenden Merkmalen vor:
- 1. Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks.
- 2. Die Portionskapsel weist ein Basiselement (2) auf.
- 2.1 Das Basiselement (2) weist einen Hohlraum auf, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist.
- 3. Die Portionskapsel weist einen Randbereich auf, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist.
- 4. Der Hohlraum wird von einer Membran (4) verschlossen.
- 4.1 Die Membran (4) ist an dem Randbereich des Basiselements befestigt.
- 5. Die Portionskapsel weist eine Kennung auf, die es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren.
- 5.1 Die Kennung ist ein Barcode.
- 5.2 Der Barcode ist an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements (2) vorgesehen.
- Die Beschreibung des EP ‘XXX hebt hervor, dass das Individualisieren der jeweiligen Portionskapsel mittels der Kennung (Merkmal 5) vorzugsweise bedeutet, dass die jeweilige Portionskapsel einer Gruppe zugeordnet werden kann, die für den jeweiligen Kaffeeautomaten geeignet ist. Es ist nach der Lehre des EP ‘XXX nicht erforderlich, dass der Kaffeeautomat erkennt, um welche Portionskapsel es sich handelt. Individualisieren bedeutet nach der erfindungsgemäßen Lehre insbesondere, dass Portionskapseln, die nicht für den jeweiligen Kaffeeautomaten geeignet sind, in diesen entweder nicht einführbar sind und/oder direkt wieder herausfallen und/oder dass der Kaffeeautomat nur mit richtigen Kapseln in Betrieb zu nehmen ist. Vorzugsweise erfasst dabei ein an dem Kaffeeautomaten – vorzugsweise im Bereich des Einwurfschachtes oder der Brühkammer – vorgesehener Sensor bzw. ein Detektionsmittel diese Kennung und vergleicht sie mit einer abgespeicherten Kennung, wobei der Kaffeeautomat vorzugsweise nur dann in Betrieb zu nehmen ist, wenn die ermittelte Kennung mit der Referenzkennung übereinstimmt (Abs. [0004]).
- Die Beschreibung des EP ‘XXX schildert ferner, dass es mit der erfindungsgemäßen Portionskapsel möglich ist, zu verhindern, dass nicht für einen bestimmten Kaffeeautomaten vorgesehene Portionskapseln in diesen eingeführt werden. Weiterhin ist es demnach anhand der Kennung möglich, dass der Kaffeeautomat erkennt, welche Art von Kapsel sich in seiner Brühkammer befindet und den Getränke- oder Lebensmittelherstellungsprozess – beispielsweise die Menge an Wasser, dessen Druck und/oder dessen Temperatur – entsprechend einstellt (Abs. [0005]).
- Die nachfolgend eingeblendete Fig. 1 des EP ‘XXX zeigt eine Portionskapsel mit einem Barcode:
- Das EP ‘XXX beschreibt, dass die Portionskapsel im Bereich der Oberseite der Membran einen Barcode aufweist. Dieser Barcode kann aufgedruckt durch einen Materialabtrag oder mit in der Folie vorhandenen optisch erkennbaren Mitteln, beispielsweise Fluoreszenzmitteln, hergestellt werden. Alternativ können entsprechende Metallringe Teil der Folie sein oder auf der Folie angebracht werden. Die Bereiche des Barcodes können auch aus einem ferromagnetischen Material bestehen. Erfindungsgemäß kann der Barcode – wie durch den Pfeil 15 in der vorstehend eingeblendeten Abbildung symbolisiert und wie es in Patentanspruch 1 seinen Niederschlag gefunden hat – an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen werden. Der Barcode kann von einem Detektor 13 ausgelesen werden, beispielsweise in einem Einwurfschacht (vgl. Abs. [0019]).
- Das EP ‘XXX umfasst zudem mit seinem Anspruch 5 einen weiteren unabhängigen Anspruch, der die Verwendung einer erfindungsgemäßen Portionskapsel zur Herstellung eines Heißgetränks umfasst.
-
(ii)
Dass die Klägerin Erfindungsbesitz an der Ausgestaltung einer zur Individualisierung einer Portionskapsel verwendeten Kennung als Barcode hatte, kann sich auf der Grundlage ihres Vorbringens allein aus der Anlage K E9 – einer von F erstellten Präsentation – ergeben. Auf Seite 491 wird unter Ziffer 6 ein Barcode auf der Unterseite der Kapsel („on the capsule bottom“) wie folgt gezeigt: - Die Verwendung einer Kennung an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements, wobei es sich bei der Kennung nach ihrem eigenen Vorbringen jeweils nicht um einen Barcode handelt, behauptet die Klägerin demgegenüber insbesondere unter Berufung auf die folgenden Unterlagen:
- Sie beruft sich für die Begründung des Erfindungsbesitzes für eine Kapsel mit – nicht näher bestimmtem – Code auf der Flanschrückseite auf die Minutes des Entwicklertreffens vom 14.04.2010 (Anlage K E12b), wo es unter anderem auf Seite 6 heißt: „Optical design for reading … on rim bottom is done“.
- Darüber hinaus bezieht sich die Klägerin auf die nachfolgend eingeblendeten Darstellungen gemäß Anlage K E12a vom 15.04.2010 (Folien 4, 5, 8 und 9) sowie Anlage K E14a vom 08.06.2010 (Folie 19), die nach dem Vortrag der Klägerin jeweils alle Merkmale von Patentanspruch 1 von EP ‘XXX einschließlich der Anordnung eines optisch auslesbaren Codes auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches zeigen:
- Ferner beruft sich die Klägerin auf ihre am 12.05.2010 und 13.07.2010 eingereichten Prioritätsanmeldungen, deren Figuren samt Beschreibung sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 des EP ‘XXX einschließlich der Anordnung eines optisch auslesbaren Codes auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches zeigten:
- Darüber hinaus führt die Klägerin das Protokoll eines Entwicklertreffens im Rahmen des „C“ vom 02.06.2010 (Anlage K E14c) an, welches die Anordnung eines optischen Codes auf der Unterseite des Randbereichs einer Kapsel bestätige.
- Schließlich behauptet die Klägerin unter Bezugnahme auf die mündliche Erklärung des Herrn K in dem Treffen zwischen Vertretern von E und Vertretern aus dem Konzern der Klägerin am 02.06.2010, dass bei ihr die Verwendung eines optischen Codes an zwei möglichen Stellen – auf der Membran der Kaffeekapsel oder auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches – diskutiert worden sei. Dem diesbezüglichen Vortrag der Klägerin ist hingegen nicht die Behauptung zu entnehmen, dass Herr K von einem Barcode gesprochen habe. Soweit sie pauschal darauf verweist, Herr K habe den Teilnehmern sämtliche Merkmale der Streitschutzrechte mündlich erläutert, ist dieses Vorbringen dahingehend zu verstehen, dass es hinsichtlich der Merkmale 5.1 (Barcode) und 5.2 (Ort der Anbringung des Barcodes) des EP ‘XXX durch ihren soeben wiedergegebenen Vortrag konkretisiert wird, wonach als Ort der Anbringung neben dem im EP ‘XXX beanspruchten Ort eine weitere Möglichkeit – auf der Membran – genannt und wonach gerade nicht von einem Barcode, sondern von einem optischen Code gesprochen worden sei. Das Vorbringen der Klägerin in der Berufungsinstanz, wonach sich Herr K nicht erinnern könne, ob er von einem Barcode als optischer Kennung gesprochen habe, ist vor diesem Hintergrund als Klarstellung anzusehen, dass die verbale Übermittlung eines Barcodes nicht oder jedenfalls nicht mehr behauptet wird.
-
(iii)
Selbst wenn man unterstellt, dass sich die Klägerin zur Begründung ihres Erfindungsbesitzes auf sämtliche von ihr vorgelegten Unterlagen einschließlich der von F erstellten Präsentation gemäß Anlage K E9 berufen kann, ergibt sich aus diesem Vorbringen das Vorliegen einer mit dem Gegenstand des EP ‘XXX wesensgleichen und fertigen Erfindung mit Blick auf dessen Merkmale 5.1 und 5.2 nicht. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich eine nähere Betrachtung der weiteren Merkmale des EP ‘XXX, die im Wesentlichen eine aus dem Stand der Technik bekannte Kaffeekapsel beschreiben und hinsichtlich derer ein Erfindungsbesitz der Klägerin zu ihren Gunsten unterstellt werden kann. - Die Annahme einer Wesensgleichheit scheidet zwar nicht bereits deshalb aus, weil die technische Aufgabe der behaupteten Erfindung der Klägerin in der Einstellung von Brühparametern im Rahmen ihres neuartigen Kaffeekapsel- und Kaffeemaschinensystems zu sehen ist, während das EP ‘XXX es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Benutzung einer Maschine mit Fremdkapseln zu verhindern. Bei der nach den dargestellten Maßstäben gebotenen objektiven Betrachtung kann die Anbringung einer Kennung zur Einstellung der Brühparameter, wie von der Klägerin nach ihrem Vorbringen entwickelt, auch zur Verhinderung von Fremdkapseln eingesetzt werden und umgekehrt.
- Eine Übereinstimmung in der Lösung dieser Aufgabe setzt allerdings die Ausgestaltung als Barcode voraus, an der es – jedenfalls im Sinne einer fertigen Erfindung – zum Zeitpunkt der frühesten Priorität der Streitschutzrechte auf Seiten der Klägerin noch fehlte. Bei der einzigen Stelle, an der die Ausgestaltung einer Kennung als Barcode gezeigt ist, handelt es sich um eine ausdrücklich als „Brainstorming“ bezeichnete Lösung unter vielen. Die Präsentation vom 21.01.2010 (Anlage K E9) ist ein äußerst umfangreiches Dokument von rund 500 Seiten mit verschiedenen Ideen und Ansätzen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen (vgl. auch Fachrichtervotum, S. 18). Gerade der Umstand, dass die dort gezeigte Lösung in späteren Unterlagen nicht mehr aufgegriffen wird, zeigt zudem, dass dieser Ansatz nicht bevorzugt weiterverfolgt wurde. Soweit der Schweizer Fachrichter in seinem Votum vom 19.04.2023 davon ausgegangen ist, für die Umsetzung bedürfe es keines Entwicklungsprogramms mit unzumutbarem Aufwand, das könne der Fachmann so umsetzen (Fachrichtervotum, S. 22), entspricht dies jedenfalls nicht dem im deutschen Recht bei der Prüfung der Ausführbarkeit einer Erfindung zur Anwendung zu bringenden Maßstab. Danach ist entscheidend, dass der Durchschnittsfachmann nach den Angaben des Erfinders mit Erfolg arbeiten kann, was sich allein anhand der in der Anlage K E9 vorhandenen Zeichnung nicht feststellen lässt. Die abweichende Herangehensweise des Schweizer Fachrichters wird auch dadurch deutlich, dass dieser weiter argumentiert, bei Anlegung eines strengeren Maßstabs müsse man sich auch fragen, ob nicht die Streitpatente wegen mangelnder Ausführbarkeit nicht rechtsbeständig sein könnten (Fachrichtervotum, S. 22). Hierbei handelt es sich nach deutschem Recht um eine im Rahmen von Vindikationsklagen unzulässige Überlegung.
- Zwar kann es nach den oben dargetanen Grundsätzen für die Annahme einer wesensgleichen Erfindung auch ausreichen, wenn das Entnommene ein allgemeines Lösungsprinzip offenbart, von dem die streitige Anmeldung eine vom Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung betrifft und sind Abänderungen im Rahmen des Fachkönnens, die den Kern der Erfindung unberührt lassen, unschädlich. Hiervon kann mit Blick auf die Modifikation eines Bitcodes oder – allgemein gesprochen – optischen Codes in einen Barcode indes nicht ausgegangen werden. Auch wenn, wie erwähnt, der Schutzfähigkeit im Rahmen von Vindikationsklagen grundsätzlich keine Bedeutung beizumessen ist, darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich bei der Merkmalsgruppe 5 um den Kern der dem EP ‘XXX zugrunde liegenden Erfindung handelt. Während die Merkmale 1 bis 4.1 eine hinlänglich vorbekannte Kaffeekapsel beschreiben, ist es gerade die Ausgestaltung als Barcode einerseits und dessen Anbringung an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements andererseits, die das EP ‘XXX vom Stand der Technik abgrenzen. In diesem Zusammenhang ist auch das notwendige Zusammenspiel beider Merkmale zu bedenken, denn die Ausgestaltung des Codes als Barcode und die Auswahl des Orts seiner Anbringung beeinflussen sich in ihren technischen Wirkungen gegenseitig. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch nicht argumentieren, es sei allein der Ort der Anbringung des Codes, der die entscheidende Abgrenzung zum Stand der Technik liefere, während die Ausgestaltung einer Kennung als Barcode bereits bekannt gewesen sei. Soweit die Klägerin darauf abstellt, dass die Beschreibung des EP ‘XXX sich mit den Vorteilen der entsprechenden Ausgestaltung nicht näher befasst und diese als eine Möglichkeit unter vielen nennt, stellt dies die dargestellte Sichtweise nicht in Frage. Nach der Erteilung des EP ‘XXX kommt es für die Beurteilung der Wesensgleichheit entscheidend auf die Patentansprüche an (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 23), die indes auf die dargestellte Ausgestaltung beschränkt sind. Dies vorausgeschickt, macht gerade die Ausgestaltung als Barcode einen entscheidenden Teil des Kerns der erfindungsgemäßen Lehre des EP ‘XXX aus. Vor diesem Hintergrund kann auch ein behaupteter Erfindungsbesitz an einem Oberbegriff (optischer Code) oder einer anderen Ausgestaltung (Bitcode) nicht als selbstverständliche Abwandlung angesehen werden.
-
(bb)
Fehlte es im maßgeblichen Zeitpunkt bereits an einer mit der Lehre des EP ‘XXX wesensgleichen und fertigen Erfindung der Klägerin, kommt ein diesbezüglicher Wissenstransfer auf die Beklagten nicht in Betracht. -
(cc)
Wollte man entgegen den Ausführungen unter (aa) einen Erfindungsbesitz der Klägerin annehmen, scheidet ein Anspruch auf Vollübertragung des EP ‘XXX jedenfalls aus den nachfolgenden Gründen aus. Weil sich nicht nur ein Wissenstransfer hinsichtlich der herausverlangten Lehre einschließlich der Ausgestaltung als Barcode nicht feststellen lässt (siehe soeben unter (bb)), sondern – wie sogleich im Rahmen des Verlangens nach Einräumung einer Mitberechtigung auszuführen sein wird (siehe unter (b) (bb)) – die Klägerin auch einen Wissenstransfer hinsichtlich der Ausgestaltung der Kennung als optischer Code oder Bitcode nicht dargelegt und bewiesen hat, ist die Beklagte zu 1) jedenfalls nicht Nichtberechtigte i.S.v. Art. II § 5 S. 2 i.V.m. S. 1 IntPatÜG. -
(b)
Die Einräumung einer Mitberechtigung an dem EP ‘XXX – der entsprechende Antrag ist als Minus im Verlangen auf Vollrechtsübertragung enthalten (BGH, GRUR 2006, 747 Rn. 10 – Schneidbrennerstromdüse) – kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) nicht verlangen. - Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG betrifft zwar – ebenso wie § 8 PatG – unmittelbar nur den Fall, dass dem Berechtigten im Verhältnis zum Anmelder oder Patentinhaber allein das Recht auf das Patent zusteht; die Bestimmung ist ihrem Wortlaut nach nicht auf den Fall zugeschnitten, dass mehrere Personen um die Beteiligung an einer durch das Patent unter Schutz gestellten Erfindung streiten und die Einräumung einer Mitberechtigung an einem Patent verlangt wird. Nicht anders als bei einer deutschen Patentanmeldung oder einem deutschen Patent steht aber auch bei einer europäischen Patentanmeldung oder einem europäischen Patent den an einer Erfindung Beteiligten eine Mitberechtigung an der Anmeldung oder dem Patent zu, die dem einzelnen materiellen Mitberechtigten einen Anspruch auf Einräumung eines Anteils gegen den gewährt, der formell Alleinrechtsinhaber ist. Ein an der Erfindung Beteiligter kann demnach gemäß Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG die Einräumung einer Mitberechtigung an dem Patent verlangen (Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 51 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung).
-
(aa)
Ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an einer Patentanmeldung oder einem bereits erteilten Patent steht demjenigen zu, der einen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung geleistet hat (BGH, GRUR 2020, 1186 Rn. 39 – Mitralklappenprothese). Schöpferisch in diesem Sinne ist ein Beitrag, wenn er über eine bloße konstruktive Mithilfe bei der Realisierung der Erfindung hinausgeht. Hierzu ist nicht erforderlich, dass der Beitrag als selbstständige erfinderische Leistung zu bewerten ist. Nicht ausreichend sind nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen wurden (BGH, GRUR 2011, 903 Rn. 14 – Atemgasdrucksteuerung; GRUR 2020, 1186 Rn. 39 – Mitralklappenprothese; GRUR 2022, 1302 Rn. 114 – Brustimplantat; OLG München, Urt. v. 20.05.2021 – 6 U 2408/17, GRUR-RS 2021, 44220 Rn. 50 – Mitralklappenprothese). -
(bb)
Es bedarf vorliegend keiner Entscheidung, ob ein schöpferischer Beitrag zu der Lehre des EP ‘XXX gegeben wäre, wenn sich feststellen ließe, dass die Klägerin der Beklagten zu 1) das Wissen über die Anbringung eines optischen Codes oder eines Bitcodes an der der Membran abgewandten Seite des Kapselflansches vermittelt hätte. Denn es lässt sich jedenfalls nicht feststellen, dass ein solcher Wissenstransfer stattgefunden hat. -
(aaa)
Die nach allgemeinen Grundsätzen darlegungsbelastete Klägerin hat einen Wissenstransfer von ihr über E auf die Beklagten bzw. die Beklagte zu 1), soweit es die Anbringung eines optischen Codes oder eines Bitcodes auf der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs angeht, bereits nicht schlüssig dargelegt. -
(i)
Sachvortrag zur Begründung eines Klageanspruchs ist dann schlüssig und erheblich, wenn die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen (BGH, Beschl. v. 18.05.2017 – I ZR 205/16, BeckRS 2017, 114636 Rn. 7; NJW-RR 2022, 634 Rn. 10; GRUR 2022, 1302 Rn. 65 – Brustimplantat). Der Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen (BGH, NJW 2019, 607 Rn. 8; NJW-RR 2022, 634 Rn. 10; GRUR 2022, 1302 Rn. 65 – Brustimplantat). Ob und in welchem Ausmaß die Angabe näherer Einzelheiten erforderlich ist, hängt von den konkreten Umständen ab. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, welche Angaben der darlegungsbelasteten Partei zumutbar und möglich sind (BGH, NJW 2021, 1759 Rn. 18; NJW-RR 2022, 634 Rn. 10). Falls sie keinen Einblick in die Geschehensabläufe hat und ihr die Beweisführung deshalb erschwert ist, darf sie auch vermutete Tatsachen unter Beweis stellen. Sie ist grundsätzlich nicht gehindert, Tatsachen zu behaupten, über die sie keine genauen Kenntnisse hat, die sie aber nach Lage der Dinge für wahrscheinlich hält (BGH, Urt. v. 04.10.2018 – III ZR 213/17, BeckRS 2018, 27356 Rn. 26; NJW 2021, 1759 Rn. 18). Die Ablehnung eines angebotenen Beweises für eine grundsätzlich erhebliche Tatsache ist nur zulässig, wenn sie so ungenau bezeichnet ist, dass ihre Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann oder wenn sie ohne greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts willkürlich ins Blaue hinein aufgestellt worden ist, mithin aus der Luft gegriffen ist und sich deshalb als Rechtsmissbrauch darstellt. Bei der Annahme von Willkür in diesem Sinne ist allerdings Zurückhaltung geboten. In der Regel wird sie nur bei Fehlen jeglicher Anhaltspunkte vorliegen (BGH, Urt. v. 04.10.2018 – III ZR 213/17, BeckRS 2018, 27356 Rn. 26, m.w.N.). -
(ii)
Gemessen an diesen Grundsätzen hat die Klägerin mit ihrer Behauptung, Herr K habe in dem Treffen vom 02.06.2010 gegenüber Teilnehmern von E mitgeteilt, dass bei ihr, der Klägerin, die Anbringung eines optischen Codes an zwei Stellen der Kapsel – Membran oder der Membran abgewandte Seite des Kapselflansches – diskutiert werde, zwar einen Wissenstransfer von ihr auf E („Wissenstransfer I“) dargetan. Auch wenn, wie das Landgericht zu Recht angenommen hat, die Präsentationen I und J keinen Bitcode (oder allgemein optischen Code) auf der der Membran abgewandten Seite des Kapselrandes zeigen, beruft sich die Klägerin doch in der Berufungsinstanz ausdrücklich darauf, dass Herr K die behauptete Äußerung unabhängig von dem Inhalt der in den Treffen mit E gezeigten Präsentationen getätigt hat, weshalb für die Frage einer schlüssigen Darlegung nicht allein auf deren Inhalt abgestellt werden kann. Nachdem der Vortrag der Klägerin in der ersten Instanz demjenigen in der Berufungsinstanz bereits im Wesentlichen entsprach, handelt es sich auch nicht um eine erstmalige Substantiierung nicht schlüssigen Vorbringens, sondern allenfalls um eine unabhängig von den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO stets zulässige Klarstellung. - Es fehlt aber an der schlüssigen Darlegung eines Transfers dieses Wissens von E auf die Beklagten („Wissenstransfer II“). Wie das Landgericht zu Recht angenommen hat, liefert das Vorbringen der Klägerin hierfür keine greifbaren Anhaltspunkte. Zutreffend hat das Landgericht die von der Klägerin vorgetragenen Gesichtspunkte zunächst einzeln betrachtet und diese als nicht stichhaltig bewertet. Auch bei der gebotenen Gesamtwürdigung aller von der Klägerin genannten Argumente ergibt sich jedoch kein ausreichender Anhaltspunkt, der die Vermutung der Klägerin stützen und diese als nicht bloß ins Blaue hinein behauptet erscheinen lassen würde.
- Soweit es die Würdigung der einzelnen von der Klägerin angeführten Gesichtspunkte angeht, kann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Darstellung im landgerichtlichen Urteil (LG-Urteil, S. 25 f.) Bezug genommen werden, der sich der Senat anschließt. Mit Blick auf das Berufungsvorbringen der Klägerin sind lediglich folgende ergänzenden Bemerkungen veranlasst:
- Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem ersten Treffen zwischen ihr, der Klägerin, und E im Rahmen des D-Projekts am 02.06.2010 und der Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte am 22.07.2010 stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keinen für einen Wissenstransfer sprechenden Anhaltspunkt dar. Zwar kann ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und der Anmeldung eines Schutzrechts für das Vorliegen einer Diensterfindung sprechen (vgl. BGH, GRUR 1981, 128 – Flaschengreifer, der von einem Anscheinsbeweis ausgeht) oder dafür, dass die Erfindung auf den ehemaligen Arbeitgeber zurückgeht (vgl. Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 120 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung). Im vorliegenden Fall, dessen Konstellation mit den genannten Entscheidungen nicht vergleichbar ist, legen die zeitlichen Abläufe einen Entnahmetatbestand aber gerade nicht nahe. Im Gegenteil stellt sich ein Zeitraum von etwa sechs Wochen nach der Lebenserfahrung eher als zu kurz bemessen dar, um davon auszugehen, dass E gegenüber Mitarbeitern der Beklagten oder gegenüber ihrer eigenen Patentanwaltskanzlei Informationen weitergegeben hat, solche – zuvor nicht bekannten Informationen – dann Eingang in die Ausarbeitung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte gefunden haben und es bereits sechs Wochen nach der ersten Erwähnung gegenüber E zu der Anmeldung der Streitschutzrechte unter Verwendung dieser Informationen gekommen ist. Diese Bewertung gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass die Klägerin mit T nur einen einzigen Mitarbeiter von E benennen konnte, der überhaupt an Projekten der Klägerin und an solchen der Beklagten mitgearbeitet hat, dieser selbst aber nicht an den fraglichen Besprechungen zwischen der Klägerin und E im Juni 2010 teilgenommen hat. Der von der Klägerin vermutete Wissenstransfer muss vielmehr seinen Ausgangspunkt in einem der Teilnehmer von Seiten von E – bezogen auf das Treffen am 02.06.2010: P, Q und R – genommen haben, wofür die Klägerin aber keinerlei Anhaltspunkt aufzeigt. Soweit der Klägervertreter in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 14.11.2024 ausgeführt hat, wenn er P wäre, würde er im Anschluss an einen derartigen Besprechungstermin zu seinem Leiter Vorentwicklung – gemeint ist T – gehen und ihm berichten, was G so wolle, handelt es sich dabei schon nicht um eine Behauptung zu den tatsächlichen Geschehnissen. In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich bei der Kapselerkennung in der Präsentation zu dem Treffen am 02.06.2010 (I, Anlage K E14) um einen erst auf Folie 15 in einem Spiegelstrich angesprochenen Randaspekt handelt, während zentraler Aspekt der Darstellung die Nutzung von Zentrifugalkräften ist (vgl. Folie 4: „G R&D invents an innovative extraction system based on CENTRIFUGAL FORCES“). Es ist auch keine Kaffeekapsel mit Kennung in der Präsentation gezeigt; auf der auf Folie 18 abgebildeten Kapsel ist keinerlei Code erkennbar. Auch dem Vortrag der Klägerin zu den mündlichen Aussagen des als Zeugen benannten Herrn K ist nicht zu entnehmen, dass dieser die in der Präsentation nur am Rande angesprochene Kapselerkennung in den Fokus seiner Erörterungen gestellt hätte. In der Präsentation zu dem Treffen am 24.06.2010 (J, Anlage K E15) wird die Kapselerkennung nicht thematisiert, wobei sich hinsichtlich dieses Treffens dem Vortrag der Klägerin ohnehin nicht klar entnehmen ließ, wer daran von Seiten von E teilgenommen hat. Auf die diesbezügliche Unklarheit im Vorbringen der Klägerin haben die Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 14.11.2024 hingewiesen, ohne dass die Klägerin diesbezüglich ihren Vortrag klargestellt hätte.
- Der Senat vermag auf der Grundlage des Vorbringens der Klägerin auch nicht die von dieser erkannte besonders enge Verbindung zwischen E und den Beklagten zu erkennen. Hierfür sprechen insbesondere nicht die von der Klägerin genannten Ereignisse nach dem vermuteten Wissenstransfer, wie eine Zeugenaussage von T vor dem Europäischen Patentamt oder die Gründung eines Joint Venture durch mit beiden Unternehmen verbundene Personen im Jahr 2016. Soweit es die von der Klägerin angeführte Zeugenaussage angeht, kann der Senat dem Vorbringen der Klägerin im Übrigen nicht entnehmen, dass T an dieser Stelle etwas anderes getan hat als seiner Verpflichtung zu einer wahrheitsgemäßen Aussage nachzukommen und dass seinem Verhalten vor diesem Hintergrund eine irgendwie geartete Positionierung zu Lasten der Klägerin beizumessen wäre.
- Selbst wenn aber die Verbindung zwischen E und den Beklagten „besonders eng“ gewesen sein sollte, liefert auch dieser Umstand keinen tauglichen Anhaltspunkt für einen absichtlichen oder versehentlichen Verrat von Geschäftsgeheimnissen durch E. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Zusammenarbeit zwischen E und den Beklagten im Zeitraum 2009/2010 zu – teils für beide Seiten am selben Tag und durch dieselbe Patentanwaltskanzlei vorgenommenen – Schutzrechtsanmeldungen im Bereich der Kaffeemaschinen und Kaffeekapseln geführt hat und dass es eine Absprache zwischen E und den Beklagten gegeben hat, wie etwaige Schutzrechte aufgeteilt werden. E steht, was zwischen den Parteien unstreitig ist, schon dem Geschäftsmodell nach regelmäßig zeitgleich mit Unternehmen derselben Branche in Kontakt. Es gehört dabei nach dem unwidersprochenen Vortrag der Beklagten zu dem üblichen Vorgehen von E, für aus einer Kooperation hervorgehende Schutzrechte auf die patentanwaltlichen Vertreter des jeweiligen Kunden zurückzugreifen. Die Zusammenarbeit mit Kunden derselben Branche bringt zudem die Notwendigkeit einer strikten Geheimhaltung mit sich, wie sie in Bezug auf das C der Klägerin in der Präsentation zu dem Treffen am 24.06.2010 (J, Anlage K E15) auf Folie 24 auch ausdrücklich erwähnt ist. Aber auch unabhängig davon ist die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen ihrer Kunden aus Gründen einer weiteren Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kunden im unmittelbaren eigenen Interesse von E.
- Zu Recht hat das Landgericht ferner ausgeführt, dass die Gegenüberstellung der Entwicklungsdokumente mit dem EP ‘XXX (Anlage K 5 bzw. S. 18 ff. der Klageschrift, Bl. 20 ff. eA-LG) nicht für einen Wissenstransfer spricht. Es ist dabei zu bedenken, dass die Merkmale 1 bis 4.1 des EP ‘XXX, wie bereits ausgeführt, eine vorbekannte Kaffeekapsel beschreiben und dass auch die von der Klägerin in ihrer Gegenüberstellung zitierten Beschreibungsstellen des EP ‘XXX zumindest teilweise bekannte Aspekte solcher Kaffeekapseln betreffen. Überdies handelt es sich insgesamt nicht um technisch hochkomplexe Gegenstände, sondern um relativ einfache Konzepte auf Basis von damals üblichen Kapselformen, hinsichtlich derer ohne weiteres auch eine unabhängige Einfügung dieser Aspekte in die Patentanmeldungen auf Seiten der Beklagten denkbar ist (vgl. Fachrichtervotum, S. 29). Hinsichtlich der Anlage K E7 von F, auf die ein Großteil der darin herausgestellten Übereinstimmungen gestützt wird, behauptet die Klägerin im Übrigen nicht einmal, dass diese E vor der ältesten Priorität der Streitschutzrechte gezeigt worden sein soll.
- Soweit die Klägerin auf die fehlende technische Ausbildung des D abstellt, ist wiederum zu berücksichtigen, dass es sich bei der Lehre des EP ‘XXX nicht um eine komplexe Technologie handelt (so auch Fachrichtervotum, S. 29). Aus welchem Grund D konkret nicht in der Lage gewesen sein soll, die den Merkmalen 5.1 und 5.2 zugrunde liegende Idee gehabt und diese der Patentanwaltskanzlei zur näheren Ausarbeitung mitgeteilt zu haben, ist dem Vorbringen der Klägerin nicht zu entnehmen. Der Vergleich mit dem in ihrem Konzern beschäftigten Entwicklungsteam und der für das D-Projekt aufgebrachten Investitionssumme greift schon deshalb nicht durch, weil es ihr um die Entwicklung eines gänzlich neuartigen Kaffeemaschinensystems ging, während der Kern des EP ‘XXX in dem Vorsehen einer als Barcode ausgestalteten Kennung an einem bestimmten Ort der Kapsel zur Verhinderung von Fremdkapseln liegt. Dass das Landgericht, wie die Klägerin in der Berufungsinstanz geltend macht, in seinem den Tatbestandsberichtigungsantrag zurückweisenden Beschluss davon ausgehe, dass Kaffeekapsel und Maschine aufeinander bezogen sein müssten und eine getrennte Entwicklung ausscheide, vermag die dargestellte Sichtweise nicht in Frage zu stellen. Welcher Aspekt des EP ‘XXX konkret ohne gleichzeitige Entwicklung einer Maschine oder ohne technische Ausbildung nicht entwickelt worden sein kann, legt die Klägerin auch an dieser Stelle nicht dar.
- Zu Recht hat das Landgericht es ferner nicht als für einen Wissenstransfer sprechenden Anhaltspunkt berücksichtigt, dass die Beklagten die Barcode-Lösung der Streitschutzrechte selbst nicht nutzen. Auch der Senat vermag nicht zu erkennen, inwiefern sich daraus ein Indiz für einen Wissenstransfer ergeben soll.
- Die Behauptung der Klägerin, wonach jüngste Erkenntnisse aus dem US-Verfahren zeigten, dass T relevante Merkmale der Streitschutzrechte – beispielsweise Rillen an der Kapselwand – an die Beklagten weitergegeben habe, bleibt völlig pauschal und stützt daher nicht die Behauptung eines Wissenstransfers. Es ist dem Vorbringen der Klägerin weder zu entnehmen, welche Information wann und auf welche Weise weitergegeben worden sein soll, noch ist ein Zusammenhang zu der Lehre des EP ‘XXX zu erkennen. Mit dem Einwand der Beklagten, betroffen seien allenfalls Vorgänge nach Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte, setzt sich die Klägerin ebenfalls nicht auseinander. Hinsichtlich der in diesem Zusammenhang gestellten Vorlageanträge der Klägerin wird auf die späteren Ausführungen unter 3. Bezug genommen.
- Vor diesem Hintergrund lässt sich auch bei einer Gesamtwürdigung aller von der Klägerin angeführten Umstände kein hinreichender Anhaltspunkt erkennen, der ihre Vermutung stützt und diese als nicht nur ins Blaue hinein geäußert erscheinen lässt. Es bleibt vollkommen im Dunkeln, zu welcher Gelegenheit es durch welche Mitarbeiter von E überhaupt zu einer Weitergabe von Informationen gekommen sein kann und wie diese ihren Weg in die Anmeldung der ältesten Priorität der Streitschutzrechte gefunden haben könnten.
-
(iii)
Die Beklagten trifft entgegen der Ansicht der Klägerin auch keine sekundäre Darlegungslast, weshalb offen bleiben kann, ob die Beklagten einer solchen mit ihrem Vortrag genügten hätten. - Im Prozess des Berechtigten gegen den Nichtberechtigten auf Übertragung der Patentanmeldung oder nach dessen Erteilung des Patents muss grundsätzlich der Kläger darlegen und beweisen, dass er beziehungsweise der Erfinder, von dem er sein Recht ableitet, der Urheber der konkret angemeldeten Lehre war. Er muss dartun und ggf. nachweisen, dass die Anmeldung auf seine erfinderische Leistung zurückgeht (vgl. Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 110 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; OLG München, Urt. v. 07.12.2017 – 6 U 4503/16, juris Rn. 135; Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 PatG Rn. 47; Haedicke/Timmann/Pansch, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 10 Rn. 246). Steht aber fest, dass der auf Abtretung der Rechte Klagende Kenntnis von der streitigen Erfindung hatte, dem Anmelder vor der Anmeldung Kenntnis vom Gegenstand der Erfindung vermittelte und der Anmelder im Anschluss daran die Erfindung zum Patent anmeldete, ist es Sache des Patentanmelders, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden sollen, eingehend zu substantiieren (BGH, GRUR 1979, 145, 147 – Aufwärmvorrichtung; GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug). Grundsätzlich muss daher der Vindikationskläger darlegen und beweisen, dass der Anmelder oder Patentinhaber nicht auch (Doppel-)Erfinder ist (BGH GRUR 1979, 145, 147 – Aufwärmvorrichtung; Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 110 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; LG Mannheim, Urt. v. 21.08.2020 – 2 O 149/18, GRUR-RS 2020, 22342 Rn. 120 – PSMA-Verbindung; Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 47a). Dafür genügt es jedoch, wenn er darlegt und beweist, dass er dem Anmelder vor der Anmeldung Kenntnis vom Gegenstand der Erfindung vermittelt hat; danach ist es Sache des Patentanmelders, die von ihm behauptete Doppelerfindung eingehend zu substantiieren (BGH, GRUR 1979, 145, 147 – Aufwärmvorrichtung; GRUR 2001, 823, 825 – Schleppfahrzeug; Senat, Teilurt. v. 23.06.2016 – I-2 U 71/11, juris Rn. 110 – Waschturm für Rauchgas-Einrichtung; Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 47a).
- Daran gemessen bleibt es vorliegend bei den allgemeinen Regeln. Es steht, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, gerade nicht fest, dass die Klägerin den Beklagten bzw. der Beklagten zu 1) Kenntnis vom Gegenstand der Erfindung vermittelt hat. Soweit die Klägerin argumentiert, eine sekundäre Darlegungslast der Beklagten dürfe nicht mit dem bloßen Hinweis darauf abgelehnt werden, dass die Konstellation nicht derjenigen in der Entscheidung „Schleppfahrzeug“ entspricht, greift dies nicht durch. Denn nach den dargestellten Grundsätzen ist es auf der ersten Stufe Sache des Vindikationsklägers, einen Wissenstransfer darzulegen und zu beweisen; nur unter dieser Voraussetzung ist es Sache des Beklagten, zu der sodann allein in Betracht kommenden Doppelerfindung vorzutragen. Es liegt somit eine von den dargestellten Grundsätzen bereits erfasste Konstellation vor, wonach es Sache der Klägerin ist, den Wissenstransfer schlüssig darzulegen – was ihr, wie gezeigt, nicht gelungen ist – und ggf. zu beweisen.
- Auch nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises lässt sich vorliegend keine Darlegungslast der Beklagten begründen. Es handelt sich bei der widerrechtlichen Entlehnung eines gewerblichen Schutzrechts bereits nicht – wie für die Anwendung dieser Grundsätze aber erforderlich – um einen typischen Geschehensablauf (vgl. Benkard/Melullis, PatG, 12. Aufl. 2023, § 8 Rn. 50).
-
(bbb)
Selbst wenn man jedoch annimmt, dass die Klägerin einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten ausreichend dargelegt hat, ist sie jedenfalls beweisfällig geblieben. Beweis für ihre Behauptung hat die Klägerin nicht angeboten. Insbesondere hat sie, wie sie selbst vorträgt, bewusst davon abgesehen, Mitarbeiter von E, mit der sie nach dem Vorbringen der Beklagten auch weiterhin zusammenarbeitet, als Zeugen für ihre Behauptung anzubieten. Auch auf den ausdrücklichen Hinweis der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 14.11.2024, wonach für die Klägerin die Möglichkeit bestünde, insbesondere diejenigen Personen als Zeugen zu benennen, die nach ihrem Vorbringen auf Seiten von E an dem Treffen am 02.06.2010 teilgenommen haben (P, Q und R), hat die Klägerin keinen Beweis angeboten. - Die Klägerin hat vorgetragen, dass E ihr gegenüber mitgeteilt hat, keinerlei sensible Informationen betreffend die Projekte der Klägerin an die Beklagten weitergegeben zu haben (S. 61 der Berufungsbegründung, Bl. 280 eA OLG; vgl. auch Anlage K 25/K 25-Ü). Dass die Klägerin sich demnach von einer Vernehmung der in Betracht kommenden Zeugen keine Bestätigung ihrer Behauptung verspricht, befreit sie indes nicht von ihrer Beweislast. Eine Beweislastumkehr zu Lasten der Beklagten kommt vor diesem Hintergrund schon in Ermangelung einer Beweisnot der Klägerin nicht in Betracht. Im Übrigen ist auch nicht zu erkennen, dass die Beklagten den Beweis der – aus ihrer Sicht – negativen Tatsache einer fehlenden Wissensweitergabe von E auf sie ohne Weiteres führen könnten.
-
(c)
Die Geltendmachung des Anspruchs ist darüber hinaus nach Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜG ausgeschlossen, weil bei Einreichung der Klage mit Schriftsatz vom 10.01.2022 die Ausschlussfrist von zwei Jahren ab dem Hinweis auf die Erteilung des EP ‘XXX (03.01.2018) bereits abgelaufen war. - Nach Art. II § 5 Abs. 2 S. 2 IntPatÜG bleibt zwar eine spätere Geltendmachung möglich, wenn der Patentinhaber bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis davon hatte, dass er kein Recht auf das Patent hat. Dass dies der Fall ist, hat die Klägerin jedoch bereits nicht schlüssig dargelegt. Soweit sie geltend macht, sie habe bereits in erster Instanz durchgehend vorgetragen, dass zwar der Wissenstransfer von E auf die Beklagten versehentlich erfolgt sein könnte, die Beklagten bei Anmeldung der Streitschutzrechte aber gewusst hätten, dass die Erfindungsgedanken von ihr, der Klägerin, stammten, erfolgt dieser Vortrag ersichtlich ins Blaue hinein und ist damit unbeachtlich. Weder erläutert die Klägerin, auf welche Weise die Beklagten die entsprechende Kenntnis erlangt haben sollten, noch zeigt sie einen greifbaren Anhaltspunkt für eine derartige Kenntniserlangung auf.
-
bb)
Die Klägerin kann die Übertragung des Vollrechts oder die Einräumung einer Mitberechtigung auch nicht aus einer anderen Anspruchsgrundlage verlangen, weshalb offen bleiben kann, ob derartige Ansprüche bereits wegen des Eingreifens der Ausschlussfrist des Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜG ausgeschlossen wären (vgl. dazu BGH, GRUR 2024, 836 Rn. 84 ff. – Automatisierte Wärmebehandlung). - Die Klägerin kann die Übertragung des Vollrechts oder einer Mitberechtigung an dem EP ‘XXX nicht aus § 823 Abs. 1 BGB verlangen. Das Recht an der Erfindung und das daraus folgende Recht auf das Patent stellen zwar sonstige Rechte im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB dar (BGH, GRUR 2016, 1257 Rn. 24 – Beschichtungsverfahren; GRUR 2020, 986 Rn. 17– Penetrometer; Senat, Urt. v. 26.11.2020 – I-2 U 60/19; Urt. v. 13.01.2022 – I-2 U 26/21, GRUR-RS 2022, 2267 Rn. 84 – Schienentransportsystem = GRUR-RR 2022, 213; OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 22.07.2021 – 6 U 108/10, GRUR-RS 2021, 22620 Rn. 32 – Kunststoffsack). Aufgrund der fehlenden Darlegung bzw. des fehlenden Nachweises eines Wissenstransfers lässt sich jedoch nicht feststellen, dass die Beklagte zu 1) in dieses Recht eingegriffen hat.
- Ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB (Eingriffskondiktion) besteht ebenfalls nicht. Die Beklagte zu 1) ist mit der Registereintragung als einer vorteilhaften Rechtsposition jedenfalls nicht auf Kosten der Klägerin bereichert, da sich mangels Darlegung bzw. Nachweises eines Wissenstransfers ein Eingriffstatbestand nicht feststellen lässt.
-
b)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) auch nicht die Übertragung des EP ‘XXX (Anlage K P2) verlangen, das ebenfalls eine Portionskapsel mit Barcode betrifft. - Anspruch 1 des EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem tiefgezogenen Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist und wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, wobei die Kennung ein Barcode ist und wobei die Kennung ein maschinenlesbarer Aufdruck mit einer im Lebensmittelbereich zugelassenen Farbe ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Barcode an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG sind nicht gegeben. Die Übertragung des Vollrechts kann die Klägerin schon deshalb nicht verlangen, weil sie sich zu dem auch insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Nachdem die geschützte Portionskapsel auch nach der Lehre des EP ‘XXX eine Kennung aufweist, die ein Barcode ist und die an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, kann auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen werden.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 1) an der Berechtigung fehlt.
Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
c)
Auch die Übertragung des EP ‘XXX (Anlage K P3), welches ebenfalls eine Portionskapsel mit Barcode betrifft, kann die Klägerin nicht verlangen. - Anspruch 1 des EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4), die eine dünne Kunststoff- oder eine Aluminiumfolie umfasst, verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist, wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG liegen nicht vor. Die Übertragung des Vollrechts kann die Klägerin schon deshalb nicht verlangen, weil sie sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Auch insoweit kann auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen werden. Denn auch nach der Lehre des EP ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel eine Kennung auf, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 1) an der Berechtigung fehlt.
Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
d)
Auch ein Anspruch auf Übertragung des EP ‘XXX (Anlage K P4), welches ebenfalls eine Portionskapsel mit Barcode betrifft, steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) als eingetragener Inhaberin des EP ‘XXX nicht zu. - Anspruch 1 des EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist, wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, wobei die Kennung ein Barcode ist, wobei das Basiselement vom Bodenbereich abgewandt einen Flansch zur Befestigung der Membran an dem Basiselement aufweist, wobei das Basiselement einen Wandungsbereich und einen Bodenbereich aufweist, wobei der Wandungsbereich sich zwischen dem Flansch und dem Bodenbereich erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass in den Wandungsbereich eine Mehrzahl von Rillen eingebracht sind und dass der Barcode an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Auch nach der Lehre des EP ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel demnach eine Kennung auf, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist, wobei das EP ‘XXX zusätzlich unter anderem vorsieht, dass in einem sich zwischen dem Flansch und dem Bodenbereich erstreckenden Wandungsbereich eine Mehrzahl von Rillen vorgesehen ist.
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG sind nicht gegeben. Die Übertragung des Vollrechts kann die Klägerin schon deshalb nicht verlangen, weil sie sich im Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Insoweit kann ebenfalls auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen werden, weil auch nach der Lehre des EP ‘XXX, wie soeben ausgeführt, die beanspruchte Portionskapsel eine Kennung aufweist, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 1) an der Berechtigung fehlt.
Weil vor diesem Hintergrund jedenfalls kein Anspruch der Klägerin aus Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG besteht, kann offen bleiben, ob, wie es das Landgericht angenommen hat, mit Blick auf das EP ‘XXX die Ausschlussfrist nach Art. II § 5 Abs. 2 S. 1 IntPatÜG eingreift oder ob die Frist durch die am 10.01.2022 – einem Montag – bei Gericht eingereichte Klage gewahrt ist, nachdem der Hinweis auf die Erteilung des EP ‘XXX am 08.01.2022 veröffentlicht worden ist.
- Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
e)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 2) nicht die Einräumung der Inhaberschaft an der europäischen Patentanmeldung EP ‘XXX (Anlage K P5), die ebenfalls eine Portionskapsel mit Barcode betrifft und deren Inhaberin die Beklagte zu 2) ist, verlangen. - Anspruch 1 der EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem tiefgezogenen Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist, wobei die Membran aus demselben oder einem unterschiedlichen Werkstoff als das Basiselement gefertigt ist und wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG sind nicht gegeben. Die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents als Vollrecht kann die Klägerin schon deshalb nicht verlangen, weil sie sich zu dem auch insoweit maßgeblichen Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX kann Bezug genommen werden, nachdem auch nach der Lehre der EP ‘XXX die beanspruchte Portionskapsel eine Kennung aufweist, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 2) an der Berechtigung fehlt.
Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 2) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
f)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) nicht die Abtretung der europäischen Patentanmeldung EP ‘XXX (Anlage K P6) verlangen, die eine „Portionskapsel mit Barcode, System und Verwendung einer Portionskapsel zur Herstellung eines Getränkes“ betrifft und deren Inhaberin die Beklagte zu 1) ist. - Anspruch 1 der EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem tiefgezogenen Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist, wobei die Portionskapsel aus einem Naturstoff und/oder einem biologisch abbaubaren Werkstoff hergestellt ist, und wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, dadurch gekennzeichnet, dass die Kennung ein Barcode ist, der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Auch nach der Lehre der EP ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel demnach eine Kennung auf, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG sind nicht gegeben. Die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des europäischen Patents als Vollrecht kann die Klägerin schon deshalb nicht verlangen, weil sie sich im Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX wird Bezug genommen.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 1) an der Berechtigung fehlt.
Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
g)
Die Übertragung des EP ‘XXX (Anlage K P7) mit dem Titel „XXX“ kann die Klägerin von der Beklagten zu 2) als der eingetragenen Inhaberin dieses Schutzrechts nicht verlangen. - Anspruch 1 des EP ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem tiefgezogenen Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und sie einen Randbereich (2.4) aufweist, der an dem Basiselement (2) vorgesehen ist und der Hohlraum von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Randbereich (2.4) des Basiselements befestigt ist, wobei sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren und wobei die Kennung ein Barcode ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Barcode an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs (2.4) des Basiselements (2) vorgesehen ist.“
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach Art. II § 5 Abs. 1 S. 2 IntPatÜG sind nicht gegeben. Die Übertragung des Vollrechts kann die Klägerin schon deshalb nicht von der Beklagten zu 2) verlangen, weil sie sich im Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX kann Bezug genommen werden, weil auch die im EP ‘XXX beanspruchte Portionskapsel eine Kennung aufweist, die ein Barcode ist und an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist.
-
Darüber hinaus kann die Klägerin auch die Einräumung einer Mitberechtigung an dem EP ‘XXX nicht verlangen, weil es an der schlüssigen Darlegung eines Wissenstransfers, jedenfalls aber an einem diesbezüglichen Nachweis bzw. Beweisantritt fehlt und sich vor diesem Hintergrund nicht feststellen lässt, dass es der Beklagten zu 2) an der Berechtigung fehlt.
Weil sich nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 2) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage stützen.
-
h)
Die Abtretung der deutschen Patentanmeldung DE ‘XXX (Anlage K P8), die eine „Portionskapsel mit Kennung“ betrifft, kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) als Inhaberin der DE ‘XXX nicht verlangen. - Anspruch 1 der DE ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und der von einer Membran (4), die an dem Basiselement befestigt ist, verschlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu Individualisieren.“
- Nach der Lehre der DE ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel demnach eine Kennung auf, wobei diese – anders als im Fall der bislang erläuterten europäischen Patente und Patentanmeldungen – nicht zwingend als Barcode ausgestaltet sein muss.
- Ein Vindikationsanspruch steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) nach dem insoweit anwendbaren § 8 S. 1 PatG nicht zu. Nach dieser Vorschrift kann der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.
- Zwar sieht § 8 PatG – insoweit abweichend von der korrespondierenden Vorschrift des Art. II § 5 IntPatÜG – neben dem Anspruch des sachlich Berechtigten auch einen solchen des durch widerrechtliche Entnahme Verletzten vor. An der rechtlichen Beurteilung ändert sich hierdurch aber nichts. Es kann offen bleiben, ob sich die Klägerin mit Blick auf die – gegenüber derjenigen des EP ‘XXX weiteren – Lehre der DE ‘XXX zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Jedenfalls lässt sich mangels schlüssiger Darlegung eines Wissenstransfers auch insoweit nicht feststellen, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte ist. Wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt, fehlt es an der Darlegung jeglicher Informationsweitergabe von E an die Beklagten, weshalb auch hinsichtlich der weiteren Lehre der DE ‘XXX ein Wissenstransfer von der Klägerin über E auf die Beklagten nicht dargetan ist. Darüber hinaus mangelt es, wie ebenfalls oben ausgeführt, insoweit jedenfalls an einem Nachweis bzw. einem Beweisantritt seitens der Klägerin.
- Weil sich somit nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage, insbesondere § 823 Abs. 1 BGB oder § 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB, stützen.
-
i)
Die vorstehenden Ausführungen betreffend die DE ‘XXX gelten für die DE ‘XXX (Anlage K P9) entsprechend, die ebenfalls eine „Portionskapsel mit Kennung“ betrifft und die eine nicht näher konkretisierte Kennung zur Individualisierung der Portionskapsel vorsieht, wobei ihr Anspruch 1 lautet: - „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und der von einer Membran (4), die an dem Basiselement befestigt ist, verschlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu Individualisieren.“
-
j)
Auch die Abtretung der DE ‘XXX (Anlage K P10) mit dem Titel „Portionskapsel und Verwendung einer Portionskapsel“ kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) als der Inhaberin der DE ‘XXX nicht verlangen. - Anspruch 1 der DE ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks aufweisend ein im Wesentlichen kegelstumpfförmiges oder zylindrisches Basiselement (2), welches einen Hohlraum (3) zur Aufnahme eines Getränkerohmaterials aufweist, und eine den Hohlraum (3) verschließende Membran (3), dadurch gekennzeichnet, dass das Basiselement (2) einen Wandungsbereich (12) aufweist, wobei das Basiselement (2) ferner auf der der Membran (4) abgewandten Seite der Portionskapsel (1) einen Bodenbereich (11) aufweist, wobei der Wandungsbereich (12) eine Mehrzahl von Rillen (15) aufweist, wobei die Rillen (15) zwischen der Membran (4) und dem Bodenbereich (11) über wenigstens einen Teil der Höhenerstreckung des Wandungsbereichs (12) verlaufend vorgesehen sind.“
- Nach der Lehre der DE ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel demnach insbesondere einen Wandungsbereich auf, der eine Mehrzahl von Rillen aufweist, die zwischen der Membran und dem Bodenbereich über wenigstens einen Teil der Höhenerstreckung des Wandungsbereichs verlaufend vorgesehen sind. Das Vorsehen einer als Barcode ausgebildeten Kennung ist hingegen nicht Gegenstand der DE ‘XXX.
- Die Voraussetzungen für einen Anspruch nach § 8 S. 1 PatG liegen auch insoweit nicht vor. Es lässt sich auch mit Blick auf die – gegenüber derjenigen des EP ‘XXX grundlegend abweichenden – Lehre der DE ‘XXX nicht feststellen, dass sich die Klägerin zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Die Klägerin verweist insoweit auf ihren Vortrag zu einem vergleichbaren Merkmal des EP ‘XXX und gibt in diesem Zusammenhang verschiedene Abbildungen aus Entwicklungsdokumenten wieder, u.a. aus der Anlage K E9 von F, in der sich unter der erwähnten Vielzahl an Ideen auf Seite 495 auch die nachfolgend eingeblendete Skizze findet:
- Darüber hinaus bezieht sich die Klägerin auf eine Präsentation vom 17.04.2008 mit dem Titel „XXX“ (auszugsweise vorgelegt als Anlage K E4), in der sich auf Seite 29 die nachfolgende Abbildung findet:
- Was die als Anlage K E9 überreichte Ideensammlung angeht, kann auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX verwiesen werden. Es lässt sich auch insoweit nicht feststellen, dass es sich bei dargestellten Idee unter der Vielzahl von gänzlich unterschiedlichen Ansätzen bereits um eine fertige – also ausführbare – Erfindung gehandelt hat. Für die nur auszugsweise vorgelegte Anlage K E4 gilt Entsprechendes. Näherer Vortrag zu der technischen Umsetzbarkeit erfolgt hierzu zudem nicht.
- Jedenfalls lässt sich mangels schlüssiger Darlegung eines Wissenstransfers nicht feststellen, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte ist. Wie zu dem EP ‘XXX erläutert, hat die Klägerin nicht schlüssig dargetan, jedenfalls aber keinen Beweis für die Behauptung angetreten, dass irgendwelche Informationen von E an die Beklagten weitergegeben wurden – und damit auch solche betreffend Rillen in der Kapselwand. Soweit die Klägerin in der Berufungstriplik vom 20.09.2024 (S. 19 Rn. 57, Bl. 1817 eA OLG) auf eine Weitergabe von Informationen betreffend „AH“, die in den Streitschutzrechten als Rillen beschrieben werden sollen, durch T verweist, bleibt dieser Vortrag völlig pauschal. Die Klägerin verweist auf einen Schriftsatz von Anwälten des A-Konzerns in einem Verfahren in den USA und auf das dortige Discovery-Verfahren. Sie erhofft sich hiervon nähere Erkenntnisse und stützt deshalb einen Vorlageantrag darauf (siehe dazu unten unter 3.). Aus sich heraus verständlichen Vortrag liefert sie in Bezug auf eine etwaige Informationsweitergabe im Zusammenhang mit Rillen an der Kapselwand allerdings nicht. Darüber hinaus fehlt es an dieser Stelle aber auch bereits an der Behauptung eines Wissenstransfers von der Klägerin an E („Wissenstransfer I“). Die Klägerin hat insbesondere nicht behauptet, dass eine solche Ausgestaltung der Kapseln Gegenstand der Treffen mit E im Juni 2010 gewesen ist.
- Weil sich somit nicht feststellen lässt, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte an der herausverlangten Erfindung ist, kann die Klägerin ihre Ansprüche auch nicht auf eine andere Anspruchsgrundlage, insbesondere § 823 Abs. 1 BGB oder § 812 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. BGB, stützen.
-
k)
Die Einräumung der Inhaberschaft an den deutschen Gebrauchsmustern DE ‘XXX (Anlage K P7c), DE ‘XXX (Anlage K P2c), DE ‘XXX (Anlage K P4c), DE ‘XXX (Anlage K P3c) und DE ‘XXX (Anlage K P5c) kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) ebenfalls nicht verlangen. -
aa)
Es lässt sich hinsichtlich keines der Gebrauchsmuster feststellen, dass sich die Klägerin im Besitz einer mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. - Weil das DE ‘XXX nach dem Vorbringen der Klägerin inhaltlich identisch mit dem EP ‘XXX ist, kann auf die dortigen Ausführungen (s.o. unter g)) Bezug genommen werden.
- Hinsichtlich des DE ‘XXX, zu dem die Klägerin vorträgt, dieses sei inhaltlich identisch mit dem EP ‘XXX, wird auf die dortigen Ausführungen (s.o. unter b)) verwiesen.
- Das DE ‘XXX entspricht nach Darstellung der Klägerin inhaltlich dem EP ‘XXX, weshalb auf die dortigen Ausführungen (s.o. unter d)) Bezug genommen wird.
- Weil das DE ‘XXX nach dem Vortrag der Klägerin inhaltlich identisch mit dem EP ‘XXX ist, wird auf die dortigen Ausführungen (s.o. unter c)) Bezug genommen.
- Schließlich trägt die Klägerin zu dem DE ‘XXX vor, dieses entspreche inhaltlich der EP ‘XXX. Auf die dortigen Ausführungen (s.o. unter e)) wird vor diesem Hintergrund verwiesen.
-
Festzuhalten ist hierbei, dass nach den Patentansprüchen aller europäischen Patente und der Patentanmeldung, deren Lehre nach dem Vorbringen der Klägerin derjenigen jeweils eines Gebrauchsmusters entspricht, ein Barcode als Kennung vorgesehen ist,
der an der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements vorgesehen ist. Vor diesem Hintergrund wird in Bezug auf alle Gebrauchsmuster ergänzend auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen, wonach sich die Klägerin insoweit vor der ältesten Priorität der Streitschutzrechte nicht im Besitz einer fertigen Erfindung befand. -
bb)
Ein Wissenstransfer von der Klägerin über E auf die Beklagten ist, wie bereits ausgeführt, ebenfalls nicht dargetan, jedenfalls aber nicht nachgewiesen, weshalb die Beklagte zu 1) auch insoweit jedenfalls nicht im Sinne von § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 1 PatG Nichtberechtigte ist. -
cc)
Zudem greift hinsichtlich aller Gebrauchsmuster die Ausschlussfrist nach § 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 8 S. 3 PatG ein. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts (LG-Urteil, S. 31 f.) wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Soweit es den Einwand einer Bösgläubigkeit der Beklagten zu 1) angeht, wird zudem auf die Ausführungen zu der Ausschlussfrist nach Art. II § 5 Abs. 2 IntPatÜG zu dem EP ‘XXX verwiesen, die hier entsprechend gelten. -
l)
Die Übertragung des aus der US-amerikanischen Patentanmeldung US ‘XXX (Anlage K P13) hervorgegangenen US-amerikanischen Patents US ‘XXX (Patentschrift nicht vorgelegt) kann die Klägerin nicht verlangen. -
aa)
Die dem US ‘XXX zugrunde liegende Anmeldung US ‘XXX trägt den Titel „Portion capsule having an identifier“ (Portionskapsel mit Kennung). Ihr Anspruch 1 lautet: - „A beverage system for producing a coffee or tea beverage, comprising: a beverage machine comprising: a holder configured to receive and support a portion capsule, and a pump controlled to push water into the portion capsule to produce the beverage, the portion capsule comprising: a metal cover attached to a metal base element having a cavity within which a beverage material is located, the base element including a circumferential flange having a top side onto which the lid is attached, the portion capsule being free of a filter, the cavity com prising a plurality of ribs that are radially spaced, vertically oriented, and configured to extend toward a central portion of the cavity, the ribs are free from extending all the way to a bottom of the cavity, the base element has a side wall with an electrically conductive section and radially spaced and vertically oriented grooves, the grooves are free from extending all the way to a bottom of the base element and are also free from extending all the way to a region of the side wall that is immediately adjacent to the flange.“
- Der weitere unabhängige Anspruch 17 lautet:
-
„A beverage system for producing a coffee or tea beverage, comprising:
a beverage machine comprising: a holder configured to receive and support a portion capsule, and a pump controlled to push water into the portion capsule to produce the beverage, the portion capsule comprising: a metal cover attached to a metal base element having a cavity within which a beverage material is located, the base element including a circumferential flange having a top side onto which the lid is attached, the portion capsule being free of a filter, the cavity com prising a plurality of ribs that are radially spaced, vertically oriented, and configured to extend toward a central portion of the cavity, the ribs are free from extending all the way to a bottom of the cavity, the base element has a side wall with radially spaced and vertically oriented grooves, the grooves are free from extending all the way to a bottom of the base element and are also free from extending all the way to a region of the side wall that is immediately adjacent to the flange, wherein the beverage machine comprises a seal that seals against the cover, and a mandrel that pierces the cover in a region that is offset from a central axis of the portion capsule.“ - Die Klägerin bezieht sich darüber hinaus auf Patentanspruch 21 des zu erteilenden, nach ihrem letzten Vorbringen zwischenzeitlich auch erteilten Patents, hat die ehemals als Anlage K 28 angekündigte Patentschrift indes nicht vorgelegt.
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P13-Ü lauten die Ansprüche 1 und 17:
- Anspruch 1:
- „Ein Getränkesystem zur Herstellung eines Kaffee- oder Teegetränks, das Folgendes umfasst: eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Halter, der so konfiguriert ist, dass er eine Portionskapsel aufnimmt und trägt, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie Wasser in die Portionskapsel drückt, um das Getränk herzustellen, wobei die Portionskapsel Folgendes umfasst: einen Metalldeckel, der an einem Metallbasiselement befestigt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein Getränkematerial befindet, wobei das Basiselement einen Umfangsflansch mit einer Oberseite aufweist, an der der Deckel befestigt ist, wobei die Portionskapsel frei von einem Filter ist, wobei der Hohlraum eine Vielzahl von Rippen aufweist, die radial beabstandet, vertikal ausgerichtet und so konfiguriert sind, dass sie sich zu einem zentralen Abschnitt des Hohlraums hin erstrecken, die Rippen sich nicht bis zu einem Boden des Hohlraums erstrecken, das Basiselement eine Seitenwand mit einem elektrisch leitenden Abschnitt und radial beabstandeten und vertikal ausgerichteten Nuten aufweist, die Nuten sich nicht bis zu einem Boden des Basiselements und auch nicht bis zu einem Bereich der Seitenwand erstrecken, der unmittelbar an den Flansch angrenzt.“
- Anspruch 17:
- „Ein Getränkesystem zur Herstellung eines Kaffee- oder Teegetränks, das Folgendes umfasst: eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Halter, der so konfiguriert ist, dass er eine Portionskapsel aufnimmt und trägt, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie Wasser in die Portionskapsel drückt, um das Getränk herzustellen, wobei die Portionskapsel Folgendes umfasst: einen Metalldeckel, der an einem Metallbasiselement befestigt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein Getränkematerial befindet, wobei das Basiselement einen Umfangsflansch mit einer Oberseite aufweist, an der der Deckel befestigt ist, wobei die Portionskapsel frei von einem Filter ist, wobei der Hohlraum eine Vielzahl von Rippen aufweist, die radial beabstandet, vertikal ausgerichtet und so konfiguriert sind, dass sie sich zu einem zentralen Abschnitt des Hohlraums erstrecken, die Rippen sich nicht bis zu einem Boden des Hohlraums erstrecken, das Basiselement eine Seitenwand mit radial beabstandeten und vertikal ausgerichteten Nuten aufweist, die Nuten sich nicht bis zu einem Boden des Basiselements erstrecken und sich auch wobei die Getränkemaschine eine Dichtung, die gegen den Deckel abdichtet, und einen Dorn umfasst, der den Deckel in einem Bereich durchsticht, der von einer zentralen Achse der Portionskapsel versetzt ist.“
-
bb)
Ob auf das US-amerikanische Patent US ‘XXX, wie es das Landgericht für alle Streitschutzrechte angenommen hat, aufgrund der nachträglichen Rechtswahl der Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht deutsches Recht anwendbar ist, erscheint zweifelhaft. Art. 14 Abs. 1 a) Rom II-VO lässt eine solche nachträgliche Rechtswahl zwar grundsätzlich zu. Nach Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO kann von dem nach diesem Artikel anzuwendenden Recht allerdings nicht durch eine Vereinbarung nach Art. 14 Rom II-VO abgewichen werden. Dies gilt nicht nur dann, wenn man Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO für auf Vindikationsansprüche direkt anwendbar hält (vgl. BeckOGK/McGuire, Stand: 01.07.2023, Art. 8 Rom II-VO Rn. 213; Hüßtege/Mansel/Dauner-Lieb/Heidel/Ring/Grünberger, BGB, Rom-Verordnungen, 2024, Art. 8 Rom II-VO Rn. 9). Auch wenn man, wie es das Landgericht angenommen hat, aufgrund einer bereicherungsrechtlichen Qualifikation des Vindikationsanspruchs erst über den Verweis in Art. 13 zu der Anwendbarkeit des Art. 8 Rom II-VO gelangt, schließt dessen Absatz 3 die Rechtswahl aus (BeckOGK/McGuire, Stand: 01.12.2016, Art. 13 Rom II-VO Rn. 2; Hüßtege/Mansel/Dauner-Lieb/Heidel/Ring/Grünberger, BGB, Rom-Verordnungen, 2024, Art. 13 Rom II-VO Rn. 1). Selbst wenn man ohne Anwendung der Rom II-VO das allgemeine Schutzlandstatut auf Patentvindikationsansprüche für anwendbar hält, handelt es sich dabei um die kollisionsrechtliche Konsequenz aus der Geltung des Territorialitätsgrundsatzes (vgl. Krahforst, Mitt. 2019, 209, 210) und ist das Schutzlandstatut damit als zwingend und einer Rechtswahl nicht zugänglich anzusehen. Der Bundesgerichtshof hat sich in dem Urteil vom 26.07.2022 (GRUR 2022, 1302 – Brustimplantat), mit dem er die vom Landgericht zitierte Entscheidung des OLG Frankfurt am Main (Urt. v. 26.11.2020 – 6 U 79/19, GRUR-RS 2020, 45898) aufgehoben und die Sache zurückverwiesen hat, nicht zu der Zulässigkeit der getroffenen Rechtswahl geäußert. - Für den vorliegenden Fall bedarf die Frage indes keiner weiteren Vertiefung. Selbst wenn es vorliegend bei dem nach Art. 8 Abs. 1 Rom II-VO anzuwendenden Schutzlandprinzip und demnach der Anwendbarkeit US-amerikanischen Rechts auf die Vindikation des US ‘XXX und aller weiteren US-amerikanischen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen bleibt, lässt sich ein Anspruch der Klägerin nicht feststellen. Entsprechendes gilt – worauf lediglich vorsorglich hingewiesen werden soll – auch hinsichtlich der nicht deutschen nationalen Teile aller streitgegenständlichen europäischen Patente, wenn man – entgegen der hier vertretenen Auffassung (s.o. unter a) aa) (1)) – davon ausgeht, dass Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG nur hinsichtlich der deutschen Teile dieser Streitschutzrechte anwendbar ist. Als allen Rechtsordnungen gemeinsames Prinzip ist jedenfalls festzuhalten, dass ein Vindikationsanspruch nicht besteht, wenn sich eine fehlende Berechtigung des Anspruchsgegners nicht feststellen lässt. So liegt es hier.
-
cc)
Dass die Klägerin sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand, lässt sich bereits in Bezug auf die dem US ‘XXX zugrunde liegende US ‘XXX nicht feststellen. Damit hat die Klägerin auch hinsichtlich des nicht vorgelegten US ‘XXX ihren Erfindungsbesitz nicht dargelegt. - Das Landgericht hat hinsichtlich der US ‘XXX angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe, weil sie lediglich behauptet habe, dass sie im Rahmen ihrer Entwicklung bereits Rillen vorgesehen habe, die sich nur über einen Teil des Hohlraums erstreckten. Dieser Beurteilung schließt sich der Senat an. Soweit es das Erfordernis von „Rippen“ im Hohlraum nach der Lehre der US ‘XXX angeht, verweist die Klägerin zudem auf ihre das EP ‘XXX betreffenden Ausführungen zu „Rillen“ im Wandungsbereich des Basiselements, weil, so die Klägerin, Rippen im Hohlraum die korrespondierenden Ausbuchtungen der Rillen des Basiselements seien. Vor diesem Hintergrund wird ergänzend auf die obigen Ausführungen zu der DE ‘XXX verwiesen, wonach es hinsichtlich derartiger Rillen an der Darlegung einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung fehlt. Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz pauschal darauf verweist, sie habe in erster Instanz bei der Begründung des Erfindungsbesitzes darauf hingewiesen, dass einige Merkmale keinen technischen Effekt hätten oder es sich bei diesen Merkmalen jedenfalls um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns handele, die den Kern der Erfindung unberührt lasse, spielt ein solcher Vortrag im Fall der US ‘XXX schon keine Rolle. Abgesehen davon kann mit der nicht näher begründeten Behauptung, ein bestimmtes Merkmal habe keinen technischen Effekt oder sei eine selbstverständliche Abwandlung, der Erfindungsbesitz nicht schlüssig dargetan werden. Insoweit wäre jedenfalls eine Erläuterung dazu erforderlich gewesen, aus welchem Grund dies in Bezug auf ein konkretes Merkmal der Fall ist.
- Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
m)
Auch die Übertragung des aus der US-amerikanischen Anmeldung US ‘XXX (Anlage K P14) hervorgegangenen Patents US ‘XXX (Patentschrift nicht vorgelegt) kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) als dessen Inhaberin nicht verlangen. -
aa)
Die US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Ihr Anspruch 1 lautet: - „A single-serve capsule for making a beverage, comprising: a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided, the base element is made of a biodegradable material, a flange extending outwardly from the base element, the flange comprising a top side and an opposing bottom side, and a cover that is fastened to the top side of the flange to close the cavity, the cover is made of a same material as the base element, wherein the single-serve capsule is free of a filter, and wherein the capsule has an identifier, which makes it possible to individualize the respective single-serve capsule, the identifier is provided on the bottom side of the flange.“
- Der weitere unabhängige Anspruch 15 lautet:
-
„A single-serve capsule for making a beverage, comprising:
a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided, the base element is made of a biodegradable material,
a flange extending outwardly from the base element, the flange comprising a top side and an opposing bottom side, and
a that is fastened to the top side of the flange to close the cavity, the cover is made of a same material as the base element,
a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule,
wherein the single-serve capsule is free of a filter, and
wherein the capsule has an identifier, which makes it possible to individualize the respective single-serve capsule, the identifier is provided on the bottom side of the flange, the identifier comprises a paper material.“ - In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P14-Ü lauten die Ansprüche 1 und 15 der US ‘XXX (offensichtliche Übersetzungsfehler wurden übernommen):
- Anspruch 1:
-
„Eine Einzelportionskapsel für die Zubereitung eines Getränks, bestehend aus:
ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem sich ein Rohgetränk befindet, wobei das Basiselement aus einem biologisch abbaubaren Material hergestellt ist, einen Flansch, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist, und
einen Deckel, der an der Oberseite des Flansches befestigt ist, um den Hohlraum zu verschließen, wobei der Deckel aus dem gleichen Material wie das Basiselement besteht,
wobei die Einzelportionskapsel frei von einem Filter ist,
und wobei die Kapsel eine Kennung aufweist, die sie
Um die Individualisierung der jeweiligen Portionskapsel zu ermöglichen, ist die Kennzeichnung auf der Unterseite des Flansches angebracht.“ - Anspruch 15:
-
„Eine Einzelportionskapsel für die Zubereitung eines Getränks, bestehend aus:
ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem sich ein Rohgetränk befindet, wobei das Basiselement aus einem biologisch abbaubaren Material hergestellt ist, einen Flansch, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist, und
a, der an der Oberseite des Flansches befestigt wird, um den Hohlraum zu verschließen, wobei der Deckel aus dem gleichen Material wie das Basiselement besteht, eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Portionskapsel entweichen,
wobei die Einzelportionskapsel frei von einem Filter ist, und wobei die Kapsel eine Kennung aufweist, die sie
möglich, die jeweiligen Einzelportionen zu individualisieren
Kapsel ist die Kennzeichnung auf der Unterseite des Flansches angebracht, die Kennzeichnung besteht aus einem Papiermaterial.“ - Die US ‘XXX beansprucht demnach zum einen eine Portionskapsel mit einer Kennung an der Unterseite des Flansches (Anspruch 1) und zum anderen eine solche Portionskapsel mit – zusätzlich – einer Sperrschicht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Aroma aus der Portionskapsel entweicht (Anspruch 15).
-
bb)
Dass die Klägerin sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand, lässt sich bereits in Bezug auf die dem US ‘XXX zugrunde liegende US ‘XXX nicht feststellen. Damit ist auch hinsichtlich des nicht vorgelegten US ‘XXX ein Erfindungsbesitz nicht dargelegt. - Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe, weil sie lediglich behauptet habe, dass auch sie in ihren Entwicklungen eine Sperrschicht vorgesehen habe, um ein Entweichen von Feuchtigkeit oder Aroma zu verhindern; ebenso wie eine Kennung aus einem Papiermaterial. Auch insoweit schließt sich der Senat – jedenfalls mit Blick auf den unabhängigen Anspruch 15 der US ‘XXX – der Beurteilung des Landgerichts an. Auch soweit es den Anspruch 1 angeht, erschöpft sich das Vorbringen der Klägerin zu ihrem Erfindungsbesitz im Übrigen in einem – ebenfalls nicht ausreichenden – Verweis auf andere Schutzrechte. Die Klägerin wendet sich hiergegen in der Berufungsinstanz auch nur mit dem bereits erwähnten (pauschalen) Argument, sie habe vorgetragen, dass einige Merkmale keinen technischen Effekt hätten oder es sich bei diesen Merkmalen jedenfalls um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns handele, die den Kern der Erfindung unberührt lasse. Dies betrifft indes nicht die US ‘XXX und ist überdies, wie bereits ausgeführt, nicht ausreichend.
- Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
n)
Auch ein Anspruch auf Einräumung der Inhaberschaft an dem aus der US-amerikanischen Patentanmeldung US ‘XXX (Anlage K P15) hervorgegangenen US-amerikanischen Patents US ‘XXX (Patentschrift nicht vorgelegt) steht der Klägerin nicht zu. -
aa)
Die US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Ihr Anspruch 1 lautet: - „A single-serve capsule for making a beverage, having a base element with a cavity that is free of a filter, and in which a raw beverage material is provided, the cavity including radially spaced and vertically oriented convexi ties, wherein a width defined between each of the plurality of convexities is wider than a width of each of plurality of convexities, the capsule having a flange, the cavity being closed by a cover, which is fastened on a top side of the flange, the base element comprises a wall region extending between the flange and a bottom region of the base element, the wall region includes radially spaced and vertically oriented grooves that are free from extending entirely to the bottom region, a width of the side wall defined between each of the plurality of grooves is wider than a width of each of plurality of grooves, wherein the capsule has an identifier, which makes it possible to individualize the single-serve capsule, the identifier is a barcode on the wall region and on a bottom side of the flange.“
- Der weitere unabhängige Anspruch 9 lautet:
- „A single-serve capsule for making a beverage, having a base element made of metal with a cavity that is free of a filter, and in which a raw beverage material is provided, the cavity including radially spaced and vertically oriented convexities, the capsule having a flange, and the cavity being closed by a metal cover, which is fastened on a top side of the flange, the base element comprises a wall region extending between the flange and a bottom region of the base element, the wall region includes radially spaced and vertically oriented grooves that are free from extending entirely to the bottom region, wherein the capsule has an identifier, which makes it possible to individualize the single-serve capsule, the identifier is a barcode on the wall region and on a bottom side of the flange.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P15-Ü lauten die Ansprüche 1 und 9 der US ‘XXX (offensichtliche Übersetzungsfehler wurden übernommen):
- Anspruch 1:
-
„Einzelportionskapsel zur Herstellung eines Getränks, die ein Basiselement mit einem Hohlraum aufweist, der frei von einem Filter ist und in dem ein Rohgetränkematerial bereitgestellt wird, wobei der Hohlraum radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Konvexitäten einschließt, wobei eine Breite, die zwischen jeder der Vielzahl von Konvexitäten definiert ist, breiter ist als eine Breite von jeder der Vielzahl von Konvexitäten, wobei die Kapsel einen Flansch aufweist, wobei der Hohlraum durch einen Deckel verschlossen ist, die an einer Oberseite des Flansches befestigt ist, das Basiselement einen Wandbereich umfasst, der sich zwischen dem Flansch und einem Bodenbereich des Basiselements erstreckt, der Wandbereich radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Nuten umfasst, die sich nicht vollständig zum Bodenbereich erstrecken, eine Breite der Seitenwand, die zwischen jeder der Vielzahl von Nuten definiert ist, breiter ist als eine Breite jeder der Vielzahl von Nuten,
wobei die Kapsel eine Kennung aufweist, die eine Individualisierung der Portionskapsel ermöglicht, die Kennung ein Barcode auf dem Wandbereich und auf einer Unterseite des Flansches ist.“ - Anspruch 9:
-
„Einzelportionskapsel zur Herstellung eines Getränks, mit einem Basiselement aus Metall mit einem filterfreien Hohlraum, in dem ein Rohgetränkematerial vorgesehen ist, wobei der Hohlraum radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Wölbungen aufweist, die Kapsel einen Flansch aufweist und der Hohlraum durch einen Metalldeckel verschlossen ist, die an einer Oberseite des Flansches befestigt ist, das Basiselement einen Wandbereich umfasst, der sich zwischen dem Flansch und einem Bodenbereich des Basiselements erstreckt, der Wandbereich radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Rillen umfasst, die sich nicht vollständig zum Bodenbereich erstrecken,
wobei die Kapsel mit einer Kennung versehen ist, die sie Um eine Individualisierung der Portionskapsel zu ermöglichen, ist der Identifikator ein Barcode auf dem Wandbereich und auf einer Unterseite des Flansches.“ -
bb)
Dass die Klägerin sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand, lässt sich bereits in Bezug auf die dem US ‘XXX zugrunde liegende US ‘XXX nicht feststellen. Damit ist auch hinsichtlich des nicht vorgelegten US ‘XXX ein Erfindungsbesitz nicht dargelegt. - Auch hinsichtlich der US ‘XXX hat die Klägerin nicht dargetan, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung war. Die Klägerin verweist insoweit weitgehend auf ihren Vortrag zu anderen Streitschutzrechten, mit Blick auf die Rillen in der Seitenwand betreffenden Merkmale insbesondere zu dem EP ‘XXX. Auf die obigen Ausführungen zu der DE ‘XXX, welche ebenfalls Rillen in der Kapselwand vorsieht, kann vor diesem Hintergrund verwiesen werden. Dass die Überlegungen der Klägerin über ein bloßes Brainstorming hinaus das Stadium einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung angenommen haben, lässt sich auf der Grundlage ihres Vorbringens nicht feststellen.
- Soweit es die Vorgabe in den unabhängigen Ansprüchen der US ‘XXX angeht, wonach die Kapsel eine Kennung aufweist, die eine Individualisierung der Portionskapsel ermöglicht und ein Barcode auf dem Wandbereich und auf einer Unterseite des Flansches ist, verweist die Klägerin auf ihren Vortrag zu dem EP ‘XXX. Wie die Klägerin geht auch der Senat davon aus, dass die Unterseite des Flansches nach der Lehre der US ‘XXX der der Membran abgewandten Seite des Randbereichs des Basiselements nach der Lehre des EP ‘XXX entspricht. Auf die dortigen Ausführungen zum fehlenden Erfindungsbesitz (s.o. unter a)) kann vor diesem Hintergrund Bezug genommen werden. Sollte die entsprechende Vorgabe der US ‘XXX abweichend von derjenigen im EP ‘XXX zu verstehen sein, lässt sich dem Vorbringen der Klägerin jedenfalls nicht entnehmen, dass sie sich insoweit im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befunden hat. Darüber hinaus lässt sich dem Vortrag der Klägerin auch nicht entnehmen, dass sie sich im Besitz einer mit der Vorgabe der US ‘XXX fertigen und wesensgleichen Erfindung befunden hat, wonach der Barcode auf dem Wandbereich und auf einer Unterseite des Flansches vorgesehen ist.
- Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
o)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) auch nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P18), dessen eingetragene Inhaberin die Beklagte zu 1) ist, verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A method of making a coffee beverage comprising: providing an apparatus including a barcode reader; inserting a first portion capsule into the apparatus, the first portion capsule including a first foil lid sealed to a base element having a cavity within which a powdered coffee material is located, the cavity being free of a filter and including a central portion, and a plurality of ribs that are radially spaced, vertically oriented, and configured to extend toward the central portion of the cavity, the base element including a circumferential flange having a top side to which the first foil lid is sealed and an opposing bottom side with a first barcode located on the bottom side, the base element of the first portion capsule includes an outside surface having a plurality of vertically oriented grooves; reading the first barcode with the barcode reader; Controlling a production process of a first coffee beverage based upon the reading of the first barcode; piercing the first foil lid with a mandrel of the apparatus in a region that is offset from a central axis of the first portion capsule; sealing the first foil lid against a seal of the apparatus; introducing heated water into the first portion capsule through a water inlet of the apparatus that is arranged along the central axis of the portion capsule to form the first coffee beverage; unloading the first portion capsule from the apparatus; inserting a second portion capsule into the apparatus, the second portion capsule including a second foil lid sealed to a base element having a cavity within which a powdered coffee material is located, the cavity of the second portion capsule being free of a filter and includes a central portion, and a plurality of ribs that are radially spaced, vertically oriented, and configured to extend toward the central portion of the cavity, the base element of the second portion capsule including a circumferential flange having a top side to which the second foil lid is sealed and an opposing bottom side with a second barcode located on the bottom side and being different from the first barcode, the base element of the second portion capsule includes an outside surface having a plurality of vertically oriented grooves; reading the second barcode with the barcode reader; controlling a second production process of a second coffee beverage based upon the reading of the second barcode, the second production process being different than the first production process; piercing the second foil lid with the mandrel of the apparatus in a region that is offset from a central axis of the second portion capsule; scaling the top side of the flange and/or the second foil lid of the second portion capsule against the seal of the apparatus; and introducing the heated water into the second portion capsule to form the second coffee beverage.“
- Anspruch 4 lautet:
- „The method according to claim 3, wherein the method comprises: activating the apparatus if the read barcode matches with the stored reference.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P18-Ü lauten die Ansprüche 1 und 4:
- Anspruch 1:
-
„Verfahren zur Herstellung eines Kaffeegetränks, umfassend: Bereitstellen einer Vorrichtung mit einem Strichcodeleser; Einsetzen einer ersten Portionskapsel in die Vorrichtung, wobei die erste Portionskapsel einen ersten Foliendeckel enthält, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein pulverförmiges Kaffeematerial befindet, wobei der Hohlraum frei von einem Filter ist und einen zentralen Abschnitt und eine Vielzahl von Rippen enthält, die radial beabstandet und vertikal ausgerichtet sind, und so konfiguriert sind, dass sie sich in Richtung des zentralen Abschnitts des Hohlraums erstrecken, wobei das Basiselement einen Umfangsflansch mit einer Oberseite, an der der erste Foliendeckel versiegelt ist, und einer gegenüberliegenden Unterseite mit einem ersten Strichcode, der sich auf der Unterseite befindet, aufweist, wobei das Basiselement der ersten Portionskapsel eine Außenfläche mit einer Vielzahl von vertikal ausgerichteten Nuten aufweist;
Lesen des ersten Strichcodes mit dem Strichcode-Lesegerät; Steuerung eines Produktionsprozesses eines ersten Kaffeegetränks auf der Grundlage des Lesens des ersten Strichcodes;
Durchstechen des ersten Foliendeckels mit einem Dorn der Vorrichtung in einem Bereich, der von einer zentralen Achse der ersten Portionskapsel versetzt ist; Versiegeln des ersten Foliendeckels gegen eine Dichtung der Vorrichtung; Einleiten von erhitztem Wasser in die erste Portionskapsel durch einen Wassereinlass der Vorrichtung, der entlang der Mittelachse der Portionskapsel angeordnet ist, um das erste Kaffeegetränk zu bilden;
Entladen der ersten Portionskapsel aus der Vorrichtung; Einsetzen einer zweiten Portionskapsel in die Vorrichtung, wobei die zweite Portionskapsel einen zweiten Foliendeckel aufweist, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein pulverförmiges Kaffeematerial befindet, wobei der Hohlraum der zweiten Portionskapsel frei von einem Filter ist und einen zentralen Abschnitt und eine Vielzahl von Rippen aufweist, die radial beabstandet, vertikal ausgerichtet und so konfiguriert sind, dass sie sich in Richtung des zentralen Abschnitts des Hohlraums erstrecken, das Basiselement der zweiten Portionskapsel einen Umfangsflansch mit einer Oberseite, an der der zweite Foliendeckel versiegelt ist, und einer gegenüberliegenden Unterseite mit einem zweiten Strichcode, der sich auf der Unterseite befindet und sich von dem ersten Strichcode unterscheidet, aufweist, wobei das Basiselement der zweiten Portionskapsel eine Außenfläche mit einer Vielzahl von vertikal ausgerichteten Rillen aufweist;
Lesen des zweiten Strichcodes mit dem Strichcodeleser; Steuerung eines zweiten Herstellungsprozesses eines zweiten Kaffeegetränks auf der Grundlage des Lesens des zweiten Strichcodes, wobei sich der zweite Herstellungsprozess von dem ersten unterscheidet; Durchstechen des zweiten Foliendeckels mit dem Dorn der Vorrichtung in einem Bereich, der von einer zentralen Achse der zweiten Portionskapsel versetzt ist; die Oberseite des Flansches und/oder des zweiten Foliendeckels der zweiten Portionskapsel gegen die Dichtung der Vorrichtung zu drücken; und Einleiten des erhitzten Wassers in die zweite Portionskapsel zur Bildung des zweiten Kaffeegetränks.“ - Anspruch 4:
- „Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Verfahren umfasst: Aktivieren der Vorrichtung, wenn der gelesene Strichcode mit der gespeicherten Referenz übereinstimmt.“
-
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin hinsichtlich des US ‘XXX bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe, indem sie (lediglich) vorgetragen habe, dass ihre Entwicklungen auch das Lesen mit einem Barcodeleser, das Steuern eines Herstellungsprozesses eines ersten Kaffeegetränks auf der Grundlage des Lesens des ersten Barcodes, das Durchstechen des ersten Foliendeckels mit einem Dorn der Vorrichtung in einem Bereich, der von einer zentralen Achse der ersten Portionskapsel versetzt ist, das Abdichten des ersten Foliendeckels gegen eine Dichtung der Vorrichtung, das Einleiten von erhitztem Wasser in die erste Portionskapsel durch einen Wassereinlass der Vorrichtung, der entlang der zentralen Achse der Portionskapsel angeordnet ist, um das erste Kaffeegetränk herzustellen, und das Entladen der ersten Portionskapsel aus der Vorrichtung vorgesehen hätten. Diesen zutreffenden Ausführungen, gegen die sich die Beklagten in der Berufungsinstanz auch nur mit dem bereits erwähnten pauschalen und unbeachtlichen Einwand wenden, schließt sich der Senat an. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
p)
Auch ein Anspruch auf Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P19) steht der Klägerin nicht zu. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A beverage system for producing a beverage, comprising: a portion capsule comprising: a foil lid sealed to a base element having a cavity within which a beverage raw material is provided, the base element comprising a circumferential flange having a top side to which the lid is attached and a bottom side with a barcode located on the bottom side, and a beverage machine comprising: a detector to read the barcode, a media chute configured to receive and support the portion capsule, and a pump controlled to push water into the portion capsule only upon a deter mination that the read barcode agrees with a stored reference, wherein the base element has a wall region with an electrically conductive section and radially spaced and vertically oriented drawn grooves, the cavity has radially spaced and vertically oriented drawn ribs.“
- Anspruch 7 lautet:
- „A beverage system comprising: a portion capsule comprising: a foil lid sealed to a base element having a cavity within which a powdered coffee material is located, the base element including an electrically conductive section and a circumferential flange having a top side onto which the lid is attached and a bottom side with a barcode located on the bottom side, the portion capsule being free of a filter and comprising a plurality of ribs that are (i) radially spaced, (ii) vertically oriented, and (iii) configured to extend toward a central portion of the cavity; and a beverage machine comprising: a detector to read the barcode, a media chute configured to receive and support the portion capsule, and a pump controlled to push heated water into the portion capsule only upon a determination that the read barcode agrees with a stored reference, wherein the base element comprises a circumferential border adjacent the flange and a wall region extending between the border and a bottom of the base element, the border has a larger diameter compared to a diameter of the wall region.“
- Anspruch 9 lautet:
- „A beverage system comprising: a portion capsule comprising: a foil lid sealed to a base element having a cavity within which a powdered coffee material is located, the base element including a flange having a top side onto which the lid is attached and an opposing bottom side with a barcode located on the bottom side; and a coffee machine comprising: a detector to read the barcode, a media chute configured to receive the portion capsule, a seal that seals against the foil lid, a mandrel configured to pierce the foil lid in a region that is offset from a central axis of the portion capsule, and a pump controlled to push heated water into the portion capsule only upon a determination that the read barcode agrees with a stored reference, the pump is also con trolled to not push heated water into the portion capsule upon a determination that the read barcode does not agree with the stored reference, wherein the base, element has a wall region with an electrically conductive section and radially spaced and vertically oriented drawn grooves, the cavity has radially spaced and vertically oriented drawn ribs, and wherein the base element comprises a circumferential border adjacent the flange that has an enlarged diameter compared to a diameter of the wall region of the base element.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P19-Ü lauten die Ansprüche 1, 7 und 9:
- Anspruch 1:
- „Ein Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, das Folgendes umfasst: eine Portionskapsel, die Folgendes umfasst: einen Foliendeckel, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem ein Getränke-Rohmaterial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement einen umlaufenden Flansch mit einer Oberseite, an der der Deckel befestigt ist, und einer Unterseite mit einem Strichcode auf der Unterseite umfasst, und eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Detektor zum Lesen des Strichcodes, eine Medienrutsche, die so konfiguriert ist, dass sie die Portionskapsel aufnimmt und trägt, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann Wasser in die Portionskapsel drückt, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt, wobei das Basiselement einen Wandbereich mit einem elektrisch leitenden Abschnitt und radial beabstandeten und vertikal ausgerichtete gezogene Rillen, der Hohlraum hat radial beabstandete und vertikal ausgerichtete gezogene Rippen.“
- Anspruch 7:
-
„Ein Getränkesystem, das Folgendes umfasst:
Portionskapsel, umfassend: einen Foliendeckel, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein pulverförmiges Kaffeematerial befindet, wobei das Basiselement einen elektrisch leitenden Abschnitt und einen Umfangsflansch mit einer Oberseite, an der der Deckel befestigt ist, und einer Unterseite mit einem auf der Unterseite angeordneten Strichcode aufweist, wobei die Portionskapsel frei von einem Filter ist und eine Vielzahl von Rippen umfasst, die (i) radial beabstandet, (ii) vertikal ausgerichtet und (hi) so konfiguriert sind, dass sie sich in Richtung eines zentralen Teils des Hohlraums erstrecken; und eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Detektor zum Lesen des Strichcodes, eine Medienrutsche, die so konfiguriert ist, dass sie die Portionskapsel aufnimmt und trägt, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann erhitztes Wasser in die Portionskapsel drückt, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt, wobei das Basiselement einen umlaufenden Rand angrenzend an den Flansch und einen sich zwischen dem Rand und einem Boden des Basiselements erstreckenden Wandbereich aufweist, wobei der Rand einen größeren Durchmesser im Vergleich zu einem Durchmesser des Wandbereichs aufweist.“ - Anspruch 9:
-
„Ein Getränkesystem, das Folgendes umfasst: eine Portionskapsel, die Folgendes umfasst: einen Foliendeckel, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein pulverförmiges Kaffeematerial befindet, wobei das Basiselement einen Flansch mit einer Oberseite, an der der Deckel befestigt ist, und einer gegenüberliegenden Unterseite mit einem Strichcode auf der Unterseite aufweist; und
Kaffeemaschine, die Folgendes umfasst: einen Detektor zum Lesen des Strichcodes, eine Medienrutsche, die so konfiguriert ist, dass sie die Portionskapsel aufnimmt, eine Dichtung, die gegen den Foliendeckel abdichtet, einen Dorn, der so konfiguriert ist, dass er den Foliendeckel in einem Bereich durchsticht, der von einer Mittelachse der Portionskapsel versetzt ist, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie erhitztes Wasser nur dann in die Portionskapsel drückt, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt, wobei die Pumpe auch so gesteuert wird, dass sie kein erhitztes Wasser in die Portionskapsel drückt, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode nicht mit der gespeicherten Referenz übereinstimmt, wobei das Basiselement einen Wandbereich mit einem elektrisch leitenden Abschnitt und radial beabstandeten und vertikal ausgerichteten gezogenen Rillen aufweist, der Hohlraum radial beabstandete und vertikal ausgerichtete gezogene Rippen aufweist, und wobei das Basiselement einen Umfangsrand angrenzend an den Flansch aufweist, der einen vergrößerten Durchmesser im Vergleich zu einem Durchmesser des Wandbereichs des Basiselements aufweist.“ -
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe. Sie habe diesen hinsichtlich des Merkmals, wonach das Basiselement einen an den Flansch angrenzenden, in den Ansprüchen näher spezifizierten Umfangsrand aufweist, mit der Behauptung zu begründen versucht, sie habe sich im Zuge der Entwicklungen Gedanken zu verschiedenen Durchmessern und Dimensionen möglicher Kapseln gemacht. Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass dieses Vorbringen für eine schlüssige Darlegung des Erfindungsbesitzes nicht ausreicht. Der bereits erwähnte pauschale und unbeachtliche Einwand der Klägerin in der Berufungsinstanz greift nicht durch. - Ergänzend wird hinsichtlich der in den unabhängigen Ansprüchen des US ‘XXX enthaltenen Vorgabe eines an der Unterseite des Umfangsflansches angeordneten Strichcodes – im englischen Originalwortlaut: Barcode – auf die Ausführungen zu dem fehlenden Erfindungsbesitz hinsichtlich des EP ‘XXX Bezug genommen.
- Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
q)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) auch nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P20) verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A method of using a portion capsule for producing a beverage, the method comprising: providing an apparatus including a barcode reader, the apparatus including a pump adapted to supply heated water; inserting the portion capsule into the apparatus, the portion capsule including a foil lid sealed to a base element having a cavity in which a beverage raw material is provided, the base element comprising a flange, the flange having a top side to which the foil lid is sealed and an opposing bottom side with a barcode located on the bottom side, the base element has a wall region with an electrically conductive section and radially spaced and vertically oriented grooves, the cavity has radially spaced and vertically oriented ribs, the portion capsule being free of a filter, the base element and/or the lid are made of metal; piercing the foil lid; reading the barcode with the barcode reader; determining whether the read barcode agrees with a stored reference; and activating the pump to push heated water into the portion capsule only upon a determination that the read barcode agrees with the stored reference.“
- Anspruch 10 lautet:
- „A method of using a portion capsule for making a coffee beverage, the method comprising: providing an apparatus including a barcode reader, the apparatus having a pump and being adapted to supply heated water; inserting the portion capsule into the apparatus, the portion capsule including a foil lid sealed to a base element having a cavity within which a powdered coffee material is located, the base element including a circumferential flange having a top side and a bottom side with a barcode located on the bottom side, the portion capsule being free of a Alter and comprising a plurality of ribs that are radially spaced, vertically oriented and extend toward a central portion of the cavity, wherein an outer surface of the base element comprises radially spaced and vertically oriented grooves; piercing the foil lid; reading the barcode with the barcode reader; and activating the pump to introduce the heated water into the portion capsule only upon a determination that the read barcode agrees with a stored reference, or not activating the pump upon a determination that the read barcode does not agree with the stored reference.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P20-Ü lauten die Ansprüche 1 und 10:
- Anspruch 1:
-
„Verfahren zur Verwendung einer Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks, wobei das Verfahren umfasst:
Bereitstellung einer Vorrichtung mit einem Strichcodeleser, wobei die Vorrichtung eine Pumpe zur Zufuhr von erwärmtem Wasser enthält;
Einsetzen der Portionskapsel in die Vorrichtung, wobei die Portionskapsel einen Foliendeckel enthält, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem ein Getränke-Rohmaterial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement einen Flansch umfasst, wobei der Flansch eine Oberseite, mit der der Foliendeckel versiegelt ist, und eine gegenüberliegende Unterseite mit einem Strichcode aufweist, der sich auf der Unterseite befindet, wobei das Basiselement einen Wandbereich mit einem elektrisch leitenden Abschnitt und radial beabstandeten und vertikal ausgerichteten Rillen aufweist, wobei der Hohlraum radial. Die Portionskapsel ist filterfrei, das Basiselement und/oder der Deckel sind aus Metall gefertigt; den Foliendeckel durchstoßen; Lesen des Strichcodes mit dem Strichcode-Lesegerät; Feststellung, ob der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt; und Aktivieren der Pumpe, um erhitztes Wasser in die Portionskapsel zu drücken, nur wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit der gespeicherten Referenz übereinstimmt.“ - Anspruch 10:
-
„Verfahren zur Verwendung einer Portionskapsel zur Herstellung eines Kaffeegetränks, wobei das Verfahren umfasst: Bereitstellung eines Geräts mit einem Strichcodeleser, wobei das Gerät eine Pumpe hat und geeignet ist, erwärmtes Wasser zu liefern;
Einsetzen der Portionskapsel in die Vorrichtung, wobei die Portionskapsel einen Foliendeckel aufweist, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem sich ein pulverförmiges Kaffeematerial befindet, wobei das Basiselement einen Umfangsflansch mit einer Oberseite und einer Unterseite aufweist, wobei sich auf der Unterseite ein Strichcode befindet, wobei die Portionskapsel frei von einem Filter ist und eine Vielzahl von Rippen aufweist, die radial beabstandet und vertikal ausgerichtet sind und sich in Richtung eines zentralen Abschnitts des Hohlraums erstrecken, wobei eine Außenfläche des Basiselements radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Nuten aufweist; den Foliendeckel durchstoßen; Lesen des Strichcodes mit dem Strichcodeleser; und
Aktivieren der Pumpe, um das erhitzte Wasser nur dann in die Portionskapsel einzuleiten, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt, oder Nichtaktivieren der Pumpe, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode nicht mit der gespeicherten Referenz übereinstimmt.“ -
bb)
Die Klägerin hat hinsichtlich des US ‘XXX bereits nicht dargetan, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung war. Die Klägerin verweist insoweit weitgehend auf ihren Vortrag zu anderen Streitschutzrechten. Soweit sie in diesem Zusammenhang etwa vorträgt, ihre Entwicklungen hätten vorgesehen, dass die Kaffeemaschine feststellt, ob der gelesene Barcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt und die Pumpe aktiviert wird, um erhitztes Wasser in die Portionskapsel zu drücken, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Barcode mit der gespeicherten Referenz übereinstimmt, fehlt jede nähere Begründung anhand von Entwicklungsunterlagen, mündlichen Äußerungen oder ähnlichem. Soweit nach der Lehre des US ‘XXX ein Barcode gelesen wird, kann überdies auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen werden, wonach sich die Klägerin hinsichtlich eines Barcodes als Kennung nicht im Besitz einer fertigen Erfindung befand. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
r)
Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auf Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P21). -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „Single-serve capsule for making a beverage, having a base element made of metal with a cavity that is free of a Alter, and in which a raw beverage material is provided, the cavity including radially spaced and vertically oriented ribs, the capsule having a flange which is provided on the base element, and the cavity being closed by a metal cover, which is fastened on a top side of the flange, the base element comprises a wall region extending between the flange and a bottom region of the base element, the wall region includes radially spaced and vertically oriented grooves that are free from extending entirely to the bottom region, wherein the capsule has an identifier, which makes it possible to individualize the respective single-serve capsule, and the identifier is a barcode provided on a bottom side of the flange which is directed away from the metal cover.“
- Der weitere unabhängige Anspruch 9 lautet:
- „Single-serve capsule for making a beverage, comprising: a base element with a cavity having radially spaced and vertically oriented ribs and in which a raw beverage material is provided, the capsule having a flange that extends from the base element, the cavity being closed by a cover, which is fastened on a top side of the flange, the base element comprises a wall region extending between the flange and a bottom region of the base element, the wall region includes radially spaced and vertically oriented grooves that are free from extending entirely to the bottom region, wherein the capsule has a barcode provided on a bottom side of the flange that opposes the top surface of the flange to which the cover is fastened, and wherein the base element comprises a circumferential border adjacent the flange, the border has a larger diameter compared to a diameter of the wall region.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P21-Ü lauten die Ansprüche 1 und 9:
- Anspruch 1:
- „Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks, mit einem Basiselement aus Metall mit einem filterfreien Hohlraum, in dem ein Getränke-Rohstoff vorgesehen ist, wobei der Hohlraum radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Rippen aufweist, wobei die Kapsel einen Flansch aufweist, der an dem Basiselement vorgesehen ist, und der Hohlraum durch eine Metallabdeckung verschlossen ist, die an einer Oberseite des Flansches befestigt ist, das Basiselement einen Wandbereich umfasst, der sich zwischen dem Flansch und einem Bodenbereich des Basiselements erstreckt, der Wandbereich radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Rillen umfasst, die sich nicht vollständig bis zum Bodenbereich erstrecken, wobei die Kapsel eine Kennung aufweist, die es ermöglicht, die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren, und die Kennung ein Barcode ist, der auf einer von der Metallabdeckung abgewandten Unterseite des Flansches vorgesehen ist.“
- Anspruch 9:
- „Einzelportionskapsel zur Herstellung eines Getränks, bestehend aus: ein Basiselement mit einem Hohlraum, der radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Rippen aufweist und in dem ein Rohgetränkematerial vorgesehen ist, wobei die Kapsel einen Flansch aufweist, der sich von dem Basiselement aus erstreckt, wobei der Hohlraum durch einen Deckel verschlossen ist, der an einer Oberseite des Flansches befestigt ist, wobei das Basiselement einen Wandbereich aufweist, der sich zwischen dem Flansch und einem Bodenbereich des Basiselements erstreckt, wobei der Wandbereich radial beabstandete und vertikal ausgerichtete Rillen aufweist, die sich nicht vollständig zu dem Bodenbereich erstrecken, wobei die Kapsel einen Strichcode aufweist, der auf einer Unterseite des Flansches angebracht ist, die der Oberseite des Flansches gegenüberliegt, an dem der Deckel befestigt ist, und wobei das Basiselement einen umlaufenden Rand angrenzend an den Flansch aufweist, wobei der Rand einen größeren Durchmesser im Vergleich zu einem Durchmesser des Wandbereichs hat.“
-
bb)
Die Klägerin hat auch hinsichtlich des US ‘XXX nicht dargetan, dass sie zum maßgeblichen Zeitpunkt im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung war. Soweit es die nach Patentanspruch 1 des US ‘XXX vorgesehene Kennung angeht, die ein Barcode ist, der auf einer von der Metallabdeckung abgewandten Unterseite des Flansches vorgesehen ist, kann auf die Ausführungen zu dem EP ‘XXX Bezug genommen werden. Mit Blick auf Patentanspruch 9 verweist die Klägerin unter Hinweis auf inhaltliche Parallelen weitgehend auf ihren Vortrag zu der US ‘XXX. Nachdem es dort aber, wie ausgeführt, ebenfalls an der Darlegung einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung fehlt, gilt dies für das US ‘XXX gleichermaßen. Auf die obigen Ausführungen zu der US ‘XXX wird verwiesen. Im Übrigen sieht auch Patentanspruch 9 des US ‘XXX einen Strichcode – im englischen Originalwortlaut: Barcode – vor, der auf einer Unterseite des Flansches angebracht ist, die der Oberseite des Flansches gegenüberliegt, an dem der Deckel befestigt ist. Auf die Ausführungen zu dem fehlenden Erfindungsbesitz in Bezug auf die Lehre des EP ‘XXX wird auch in Bezug auf Patentanspruch 9 des US ‘XXX ergänzend verwiesen. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
s)
Auch ein Anspruch auf Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P16) steht der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1) als dessen eingetragener Inhaberin nicht zu. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: -
„A beverage System for making a beverage, comprising: A) a single-serve capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element being symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having a rounded bottom portion; ii) a Hange extending outwardly from the base element, the Hange comprising a top side and an opposing bottom side; iii) a cover fastened to the top side of the flange, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location that is offset from the central longitudinal axis; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; and v) an identifier, which includes a repeat pattern, provided on the bottom side of the flange;
B) a beverage machine comprising: i) a sensor/detector; ii) a receptacle configured to receive the single-serve capsule; iii) a pump controlled to supply water into the singleserve capsule only upon detection of the identifier by the sensor/detector and a determination by the beverage machine that the single-serve capsule is suitable for use with the beverage machine; iv) a chamfered mandrel that is configured to pierce the cover at the location that is offset from the central longitudinal axis; v) a groove that is laterally offset from the chamfered mandrel; and vi) a seal that is at least partially seated in the groove and configured to bear against a top side of the cover in a region between a peripheral edge of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel.“ - Anspruch 7 lautet:
-
„A beverage System for making a beverage, comprising: A) a single-serve capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element being symmetrical about a central longitudinal axis and having a rounded bottom portion; ii) a flange extending outwardly from the base element, the flange comprising a top side and an opposing bottom side; iii) a cover that is fastened to the top side of the flange, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location offset from the central longitudinal axis; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; and v) an identifier, which includes a repeat pattern, provided on the bottom side of the flange;
B) a beverage machine comprising: i) a sensor/detector; ii) a receptacle configured to receive the single-serve capsule; iii) a pump controlled to supply water into the singleserve capsule only upon detection of the identifier with the sensor/detector and determination by the beverage machine that the detected identifier agrees with a stored reference; iv) a chamfered mandrel that is configured to pierce the cover at the location offset from the central longitudinal axis; v) a pair of holding arms for guiding the single-serve capsule; vi) a waste Container for the single-serve capsule to fall into; vii) a groove that is laterally offset from the chamfered mandrel; and viii) a seal that is at least partially seated in the groove and configured to bear against a top side of the cover in a region between a peripheral edge of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel.“ - Anspruch 10 lautet:
-
„A beverage System for making a beverage, comprising: A) a single-serve capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element being symmetrical about a central longitudinal axis; ii) an inside wall defining the cavity, which includes a ledge at an upper region thereof, the ledge projects from the inside wall towards the central longitudinal axis iii) a rounded bottom portion; iv) a flange extending outwardly from the base element, the flange comprising a top side and an opposing bottom side; v) a cover that is fastened to the top side of the flange, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location offset from the central longitudinal axis; vi) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; vii) a side wall comprising a plurality of indentations arranged about the central longitudinal axis; viii) an identifier, which includes a repeat pattem, provided on the bottom side of the flange;
B) a beverage machine comprising: i) a sensor/detector; ii) a receptacle configured to receive the single-serve capsule; iii) a pump controlled to supply water into the singleserve capsule only upon detection of the identifier with the sensor/detector and a determination by the beverage machine that the single-serve capsule is suitable for use with the beverage machine; iv) a chamfered mandrel that is configured to pierce the cover in the location offset from the central longitudinal axis v) a pair of holding arms for guiding the single-serve capsule; vi) a waste Container for the single-serve capsule to fall into; vii) a groove that is laterally offset from the chamfered mandrel; and viii) a seal at least partially seated in the groove and 5 configured to seal against a top side of the cover in a region between a peripheral edge of the Hange and the region of the cover that is pierced by the mandrel.“ - In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P16-Ü lauten die Ansprüche 1, 7 und 10:
- Anspruch 1:
- „Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, umfassend: A) eine Einzelportionskapsel, die Folgendes enthält: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement symmetrisch um eine zentrale Längsachse desselben ist und einen abgerundeten Bodenabschnitt aufweist; ii) einen Bügel, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Bügel eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist; iii) eine Abdeckung, die an der Oberseite des Flansches befestigt ist, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gebogen ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer Stelle durchstochen wird, die von der zentralen Längsachse versetzt ist; iv) eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aroma aus der Einzelportionskapsel entweicht; und v) eine Kennzeichnung, die ein sich wiederholendes Muster enthält und auf der Unterseite des Flansches angebracht ist; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Sensor/Detektor; ii) einen Behälter, der zur Aufnahme der Einzelportionskapsel konfiguriert ist; iii) eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist, wenn der Sensor/Detektor die Kennung erfasst und die Getränkemaschine feststellt, dass die Einzelportionskapsel geeignet ist für die Verwendung mit der Getränkemaschine; iv) einen abgeschrägten Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung an der Stelle durchsticht, die von der zentralen Längsachse abgewichen ist; v) eine Nut, die seitlich vom abgeschrägten Dorn abgesetzt ist, und vi) eine Dichtung, die zumindest teilweise in der Nut sitzt und so konfiguriert ist, dass sie an einer Oberseite der Abdeckung in einem Bereich zwischen einer Umfangskante der Abdeckung und dem Bereich der Abdeckung, der von der Dichtung durchstoßen wird, anliegt abgeschrägter Dorn.“
- Anspruch 7:
-
„Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, umfassend: A) eine Einzelportionskapsel, die Folgendes enthält: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement um eine zentrale Längsachse symmetrisch ist und einen abgerundeten Bodenteil aufweist; ii) einen Flansch, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist; iii) eine Abdeckung, die an der Oberseite des Flansches befestigt ist, die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gewölbt ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer von der zentralen Längsachse versetzten Stelle durchstochen wird; iv) eine Barriereschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Einzelportionskapsel austritt; und v) eine auf der Unterseite des Flansches angebrachte Kennzeichnung, die ein Rapportmuster enthält; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Sensor/Detektor;
ii) einen Behälter, der zur Aufnahme der Einzelportionskapsel konfiguriert ist; iv) eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist, wenn die Kennung mit dem Sensor/Detektor erfasst und von der Getränkemaschine festgestellt wird, dass die erfasste Kennung mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt; v) einen abgeschrägten Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung an der Stelle durchstößt, die von der zentralen Längsachse abweicht; vi) ein Paar Haltearme zur Führung der Einzelportionskapsel; vii) einen Abfallbehälter, in den die Einzelportionskapsel fallen kann; viii) eine Nut, die seitlich von dem abgeschrägten Dorn abgewinkelt ist; und ix) eine Dichtung, die zumindest teilweise in der Nut sitzt und so konfiguriert ist, dass sie an einer Oberseite der Abdeckung in einem Bereich zwischen einem Umfangsrand der Abdeckung und dem Bereich der Abdeckung, der von dem abgeschrägten Dorn durchstoßen wird, anliegt.“ - Anspruch 10:
-
„Ein Getränk System zur Herstellung eines Getränks, bestehend aus:
A) eine Einzelportionskapsel, die Folgendes enthält: i) ein Grundelement mit einem Hohlraum, in dem sich ein Getränkematerial befindet, wobei das Grundelement symmetrisch um eine zentrale Längsachse angeordnet ist; ii) eine den Hohlraum begrenzende Innenwand, die in ihrem oberen Bereich eine Leiste aufweist, die von der Innenwand in Richtung der zentralen Längsachse vorsteht iii) einen abgerundeten unteren Teil; iv) einen Flansch, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist; v) eine Abdeckung, die an der Oberseite des Flansches befestigt ist, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gewölbt ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer von der zentralen Längsachse versetzten Stelle durchstochen wird; vi) eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Portionskapsel entweichen; vii) eine Seitenwand mit einer Vielzahl von Einkerbungen, die um die zentrale Längsachse angeordnet sind; viii) eine Kennzeichnung, die ein Wiederholungsmuster enthält und auf der Unterseite des Flansches angebracht ist; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Sensor/Detektor; ii) einen Behälter, der zur Aufnahme der Einzelportionskapsel konfiguriert ist; iii) eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist, wenn die Kennung mit dem Sensor/Detektor erfasst wird und die Getränkemaschine feststellt, dass die Einzelportionskapsel zur Verwendung mit der Getränkemaschine geeignet ist; iv) einen abgeschrägten Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung an einer Stelle durchsticht, die von der zentralen Längsachse abweicht v) ein Paar Haltearme zur Führung der Einzelportionskapsel; vi) einen Abfallbehälter, in den die Einzelportionskapsel fallen kann; vii) eine Nut, die seitlich von dem abgeschrägten Dorn versetzt ist; und viii) eine Dichtung, die zumindest teilweise in der Nut sitzt und so konfiguriert ist, dass sie gegen eine Oberseite der Abdeckung in einen Bereich zwischen einer Umfangskante des Hanges und dem Bereich des Deckels, der vom Dorn durchstoßen wird.“ -
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe. Sie habe insoweit lediglich vorgetragen, dass ihre Entwicklungen eine Abdeckung vorgesehen hätten, die an der Oberseite des Flansches befestigt sei, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem Randbereich der Abdeckung nach außen gewölbt sei. Zu Recht ist das Landgericht zu der Beurteilung gelangt, dass dieses Vorbringen für eine schlüssige Darlegung des Erfindungsbesitzes nicht ausreicht. Der bereits erwähnte pauschale Einwand der Klägerin in der Berufungsinstanz ist unbeachtlich und vermag diese Beurteilung nicht in Frage zu stellen. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
t)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) auch nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P17) verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A beverage System for making a beverage, comprising: a single-serve capsule comprising: a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided; a Hange extending outwardly from the base element, the Hange comprising a top side and an opposing bottom side; a cover that is fastened to the top side of the Hange to close the cavity; and a barcode provided on the bottom side of the Hange; and a beverage machine comprising: a sensor/detector configured to read the barcode; a brewing chamber configured to receive the base element of the single-serve capsule and having an end portion that opposes the bottom side of the flange; and a pump controlled to supply water into the single-serve capsule; wherein the single-serve capsule is free of a filter that is located inside of the cavity, the single-serve capsule also comprises: i. an upper end portion that has an annular convexity and a lower end portion that has an annular concavity relative to a central axis of the base element; and ii. a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; wherein the beverage machine also comprises: i. a mandrel that is configured to pierce the cover in a region that is offset from the central axis of the base element; ii. a seal that is configured to seal against the cover in a region between a peripheral edge of the flange and the region of the cover that is pierced by the mandrel; iii. a pair of holding arms for engaging the single-serve capsule; and iv. a dropping box for the single-serve capsule to fall into; wherein the pump is controlled to push the water into the single-serve capsule only upon a determination that the read barcode agrees with a stored reference.“
- Anspruch 7 lautet:
- „A beverage System for making a beverage, comprising: a single-serve capsule comprising: a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided; a flange extending outwardly from the base element, the flange comprising a top side and an opposing bottom side; a cover that is fastened to the top side of the flange to close the cavity; and an identifier provided on the bottom side of the flange, the identifier being a barcode; and a beverage machine comprising: a sensor/detector, a brewing chamber configured to receive the base element of the single-serve capsule and having an end portion that opposes the bottom side of the flange; and a pump controlled to supply water into the single-serve capsule; wherein the single-serve capsule is free of a filter that is located inside of the cavity, the single-serve capsule also comprises: i. an upper end portion that has an annular convexity and a lower end portion that has an annular concavity relative to a central axis of the base element; ii. a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; and iii. a side wall having indentations; wherein the beverage machine also comprises: i. a mandrel that is configured to pierce the cover in a region that is offset from the central axis of the base element; ii. a seal that is configured to seal against the cover in a region between a peripheral edge of the flange and the region of the cover that is pierced by the mandrel; iii. a pair of holding arms for engaging opposite sides of the single-serve capsule; and iv. a dropping box for the single-serve capsule to fall into; wherein the beverage machine, by reading or detecting the identifier with the sensor/detector, is configured to determine if the single-serve capsule belongs to a group of single serve capsules operable for use with the beverage machine, and only if the beverage machine determines that the single-serve capsule belongs to the group of single serve capsules operable for use with the beverage machine is the pump controlled to push the water into the single-serve capsule.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P17-Ü lauten die Ansprüche 1 und 7 (offensichtliche Übersetzungsfehler wurden übernommen):
- Anspruch 1:
- „Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, umfassend: eine Einzelportionskapsel, umfassend: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Rohgetränkematerial bereitgestellt wird; einen Hange, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Hange eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite umfasst; einen Deckel, der an der Oberseite des Hanges befestigt ist, um den Hohlraum zu schließen; und einen Strichcode, der auf der Unterseite des Hanges bereitgestellt ist; und eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Sensor/Detektor, der zum Lesen des Strichcodes konfiguriert ist; eine Brühkammer mit die so geformt ist, dass sie das Basiselement der Einzelportionskapsel aufnimmt und einen Endabschnitt aufweist, der der Unterseite des Flansches gegenüberliegt; und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie Wasser in die Einzelportionskapsel fördert; wobei die Einzelportionskapsel frei von einem Filter ist, der sich im Inneren des Hohlraums befindet, wobei die Einzelportionskapsel auch umfasst: i. einen oberen Endabschnitt, der eine ringförmige Konvexität aufweist, und einen unteren Endabschnitt, der eine ringförmige Konkavität relativ zu einer Mittelachse des Basiselements aufweist; und ii. eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Portionskapsel entweichen; wobei die Getränkemaschine auch umfasst: i. einen Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung in einem Bereich durchsticht, der von der Mittelachse des Basiselements versetzt ist; ii. eine Dichtung, die so konfiguriert ist, dass sie gegen den Deckel in einem Bereich zwischen einer Umfangskante des Flansches und dem Bereich des Deckels, der von dem Dorn durchstoßen wird, abdichtet; iii. ein Paar Haltearme für den Eingriff in die Einzelportionskapsel; und iv. eine Einwurfbox, in die die Einzelportionskapsel fällt; wobei die Pumpe so gesteuert wird, dass das Wasser nur dann in die Einzelportionskapsel gedrückt wird, wenn festgestellt wird, dass der gelesene Strichcode mit einer gespeicherten Referenz übereinstimmt.“
- Anspruch 7:
-
„Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, umfassend: eine Einzelportionskapsel, umfassend: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Rohgetränkematerial bereitgestellt wird; einen Flansch, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite umfasst; eine Abdeckung, die an der Oberseite des Flansches befestigt ist, um den Hohlraum zu verschließen; und eine Kennung, die auf der Unterseite des Flansches bereitgestellt ist, wobei die Kennung ein Strichcode ist; und eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Sensor/Detektor, eine Brühkammer, die so konfiguriert ist, dass sie das Basiselement der Einzelportionskapsel aufnimmt und einen Endabschnitt aufweist, der der Unterseite des Flansches gegenüberliegt; und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist; wobei die Einzelportionskapsel frei von einem Filter ist, der sich im Inneren des Hohlraums befindet, wobei die Einzelportionskapsel auch umfasst: i. einen oberen Endabschnitt, der eine ringförmige Konvexität aufweist, und einen unteren Endabschnitt, der eine ringförmige
Konkavität relativ zu einer Mittelachse des Basiselements aufweist; ii. eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aroma aus der Einzelportionskapsel entweicht; und iii. eine Seitenwand mit Einbuchtungen; wobei die Getränkemaschine auch umfasst: i. einen Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung in einem Bereich durchsticht, der von der Mittelachse des Basiselements versetzt ist; ii. eine Dichtung, die so konfiguriert ist, dass sie gegen den Deckel in einem Bereich zwischen einer Umfangskante des Flansches und dem Bereich des Deckels, der von dem Dorn durchstoßen wird, abdichtet; iii. ein Paar Haltearme für den Eingriff in gegenüberliegende Seiten der Einzelportionskapsel; und iv. eine Einwurfbox, in die die Einzelportionskapsel fällt; wobei die Getränkemaschine durch Lesen oder Erfassen der Kennung mit dem Sensor/Detektor konfiguriert ist, um zu bestimmen, ob die Einzelportionskapsel zu einer Gruppe von Einzelportionskapseln gehört, die zur Verwendung mit der Getränkemaschine betreibbar sind, und nur wenn die Getränkemaschine bestimmt, dass die Einzelportionskapsel zu der Gruppe von Einzelportionskapseln gehört, die zur Verwendung mit der Getränkemaschine betreibbar sind, wird die Pumpe gesteuert, um das Wasser in die Einzelportionskapsel zu drücken.“ -
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe. Sie habe insoweit lediglich vorgetragen, ihre Entwicklungen hätten vorgesehen, dass die Getränkemaschine eine Kammer umfasse, die so konfiguriert sei, dass sie das Basismaterial der Portionskapsel aufnehme und einen Endabschnitt aufweise, der der Unterseite des Flansches gegenüberliege. Der Beurteilung des Landgerichts, wonach mit diesem Vorbringen ein Erfindungsbesitz nicht ausreichend dargetan ist, schließt sich der Senat an. Die Klägerin wendet sich hiergegen in der Berufungsinstanz auch nur mit dem bereits erwähnten pauschalen Einwand, der indes, wie ausgeführt, unbeachtlich ist. - Ergänzend wird hinsichtlich der in den unabhängigen Ansprüchen des US ‘XXX enthaltenen Vorgabe, wonach ein Strichcode – im englischen Originalwortlaut: Barcode – an der Unterseite des Flansches bereitgestellt ist, auf die die Ausführungen zu dem fehlenden Erfindungsbesitz hinsichtlich des EP ‘XXX Bezug genommen
- Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
u)
Die Klägerin kann ferner nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P22) von der Beklagten zu 1) verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: -
„A beverage System for making a beverage, comprising: A) a portion capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element being symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having an open end and a bottom portion, the base element having a first height that is defined between the open end and the bottom portion; ii) a rim extending outwardly from the base element, the rim comprising a top side and an opposing bottom side; iii) a cover fastened to the base element to close the cavity, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location that is offset from the central longitudinal axis, the cover has a second height that is defined between the peripheral region and the central region, wherein the first height of the base element is greater than the second height of the cover; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; and v) an identifier provided on the bottom side of the rim;
B) a beverage machine comprising: i) a sensor/detector; ii) an insertion shaft configured to receive the portion capsule and to enable detection of the identifier on the bottom side of the rim by the sensor/detector; iii) a chamfered mandrel that is configured to pierce the cover at the location that is offset from the central longitudinal axis; iv) a seal that is configured to bear against a top side of the cover in a region between the peripheral region of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel; and v) a pump controlled to supply hot water into the portion capsule only upon detection of the identifier by the sensor/detector and a determination by the beverage machine that the portion capsule is suitable for use with the beverage machine.“ - Anspruch 12 lautet:
- „A beverage System comprising: A) a portion capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element being symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having an open end and a bottom portion, the base element having a first height that is defined between the open end and the bottom portion; ii) a rim extending outwardly from the base element, the rim having a top side and an opposing bottom side; iii) a cover fastened to the base element, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location that is offset from the central longitudinal axis, the cover has a second height that is defined between the peripheral region and the central region, wherein the first height of the base element is greater than the second height of the cover; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; and v) an identifier provided on the bottom side of the rim; B) a beverage machine comprising: i) an insertion shaft having a wall structure into which the portion capsule is received, the insertion shaft defined by a base portion and an annular portion laterally extending outwardly from the base portion in a direction that is transverse to a longitudinal axis of the insertion shaft; ii) a chamfered mandrel that pierces the cover at the location that is offset from the central longitudinal axis; iii) an optical sensor/detector positioned outside of the base portion of the wall structure of the insertion shaft and below the annular portion, which directs a beam through a portion of the wall structure to read the identifier on the portion capsule; iv) a seal that is configured to bear against a top side of the cover in a region between the peripheral region of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel; and v) a pump that supplies hot water into the portion capsule only after the identifier is read by the sensor/detector.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P22-Ü lauten die Ansprüche 1 und 12:
- Anspruch 1:
-
„Getränkesystem zur Herstellung eines Getränks, bestehend aus: A) eine Portionskapsel, bestehend aus: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement symmetrisch um eine zentrale Längsachse desselben ist und ein offenes Ende und einen Bodenabschnitt aufweist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen Ende und dem Bodenabschnitt definiert ist; ii) einen Rand, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Rand eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist; iii) eine Abdeckung, die an dem Basiselement befestigt ist, um den Hohlraum zu schließen, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gewölbt ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer Stelle durchstochen wird, die von der zentralen Längsachse versetzt ist, wobei die Abdeckung eine zweite Höhe aufweist, die zwischen dem peripheren Bereich und dem zentralen Bereich definiert ist, wobei die erste Höhe des Basiselements größer ist als die zweite Höhe der Abdeckung; iv) eine Sperrschicht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Aromastoffe aus der Portionskapsel entweichen; und v) eine auf der Unterseite der Felge angebrachte Kennzeichnung; 8) eine Getränkemaschine mit: 1. einen Sensor/Detektor;
11. einen Einführschacht, der so konfiguriert ist, dass er die Portionskapsel aufnimmt und die Erkennung der Kennung an der Unterseite der Felge durch den Sensor/Detektor ermöglicht;
111. einen abgeschrägten Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung an der Stelle durchstößt, die von der zentralen Längsachse versetzt ist;
112. eine Dichtung, die so konfiguriert ist, dass sie an einer Oberseite des Deckels in einem Bereich zwischen dem Umfangsbereich des Deckels und dem Bereich des Deckels, der von dem abgeschrägten Dorn durchstoßen wird, anliegt; und
113. eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann heißes Wasser in die Portionskapsel einspeist, wenn der Sensor/Detektor die Kennung erfasst und die Getränkemaschine feststellt, dass die Portionskapsel für die Verwendung mit der Getränkemaschine geeignet ist.“ - Anspruch 12:
- „Ein Getränkesystem bestehend aus: A) eine Portionskapsel, bestehend aus: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement symmetrisch um eine zentrale Längsachse desselben ist und ein offenes Ende und einen Bodenabschnitt aufweist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen Ende und dem Bodenabschnitt definiert ist; ii) einen Rand, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Rand eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist; iii) eine Abdeckung, die an dem Basiselement befestigt ist, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gebogen ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer Stelle durchstochen wird, die von der zentralen Längsachse versetzt ist, wobei die Abdeckung eine zweite Höhe aufweist, die zwischen dem peripheren Bereich und dem zentralen Bereich definiert ist, wobei die erste Höhe des Basiselements größer ist als die zweite Höhe der Abdeckung; iv) eine Sperrschicht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Aromastoffe aus der Portionskapsel entweichen; und v) eine auf der Unterseite der Felge angebrachte Kennzeichnung; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Einführungsschaft mit einer Wandstruktur, in der die Portionskapsel aufgenommen wird, wobei der Einführungsschaft durch einen Basisabschnitt und einen ringförmigen Abschnitt definiert ist, der sich seitlich vom Basisabschnitt in einer Richtung nach außen erstreckt, die quer zu einer Längsachse des Einführungsschafts verläuft; ii) einen abgeschrägten Dorn, der den Deckel an der von der zentralen Längsachse abgesetzten Stelle durchstößt; iii) einen optischen Sensor/Detektor, der außerhalb des Basisteils der Wandstruktur des Einführschachts und unterhalb des ringförmigen Teils angeordnet ist und einen Strahl durch einen Teil der Wandstruktur lenkt, um die Kennung auf der Teilkapsel zu lesen; iv) eine Dichtung, die so konfiguriert ist, dass sie an einer Oberseite des Deckels in einem Bereich zwischen dem Umfangsbereich des Deckels und dem Bereich des Deckels, der von dem abgeschrägten Dorn durchstoßen wird, anliegt; und v) eine Pumpe, die erst dann heißes Wasser in die Portionskapsel einspeist, wenn die Kennung vom Sensor/Detektor gelesen wurde.“
-
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe. Sie habe insoweit lediglich vorgetragen, ihre Entwicklungen hätten vorgesehen, dass das Basiselement der Portionskapsel eine erste Höhe habe, die sich zwischen dem offenen Ende und dem Bodenabschnitt definiere. Daneben sei eine zweite Höhe vorgesehen gewesen, die sich zwischen dem Randbereich und dem Zentrum der Abdeckung definiere, wobei die erste Höhe des Basiselements größer sei als die zweite Höhe der Abdeckung. Der Beurteilung des Landgerichts, wonach mit diesem Vorbringen ein Erfindungsbesitz nicht ausreichend dargetan ist, schließt sich der Senat an. Die Klägerin wendet sich hiergegen in der Berufungsinstanz auch nur mit dem erwähnten pauschalen Einwand, der unbeachtlich ist und die dargestellte Beurteilung nicht in Frage stellt. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
v)
Ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1) auf Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P23) steht der Klägerin ebenfalls nicht zu. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A portion capsule for making a beverage comprising: a base element having a cavity in which a beverage material is provided, the base element including a wall that is symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having an open end and a closed bottom portion, the base element has a first height that is defined between the open end and the closed bottom portion, the wall has an outside surface and an inside surface which faces the beverage material; a plurality of indentations arranged on the outside surface of the wall, about the central longitudinal axis; a ledge formed at the inside surface of the wall and projecting towards the central longitudinal axis, the ledge is spaced below the open end of the base element; a rim at the open end of the base element, the rim having a top surface and an opposing bottom surface; an optically detectable individualization identifier, which is carried by the bottom surface of the rim, the optically detectable individualization identifier includes surface areas having different optically detectable reflective properties, the optically detectable individualization identifier is configured to be read by a sensor/detector of a beverage machine to individualize the portion capsule and to activate a pump of the beverage machine; a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; and a cover attached to the base element to close the cavity, the cover having a central region and a perimeter, the cover is bowed outwardly to a second height in the central region relative to the perimeter of the cover, the second height of the cover is less than the first height of the base element, the cover includes a piercing region that is configured to be pierced by a mandrel of the beverage machine at a location that is laterally offset from the central longitudinal axis and a sealing region that is configured to be sealed against by a seal of the beverage machine, the sealing region is located between the piercing region and the perimeter of the cover.“
- Anspruch 8 lautet:
- „A portion capsule for making a beverage comprising: a base element having a cavity in which a beverage material is provided, the base element including a wall that is symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having an open end and a closed bottom portion, the base element has a first height that is defined between the open end and the closed bottom portion, the wall has an outside surface and an inside surface which faces the beverage material; a plurality of vertically-orientated indentations arranged on the outside surface of the wall; a plurality of vertically-orientated ribs arranged on the inside surface of the wall; a rim at the open end of the base element, the rim having a top surface and an opposing bottom surface; an optically detectable individualization identifier, which is carried by the bottom surface of the rim, the optically detectable individualization identifier includes surface areas having different optically detectable reflective properties, the optically detectable individualization identifier is configured to be read by a sensor/detector of a beverage machine to individualize the portion capsule and to activate a pump of the beverage machine; a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; and a cover sealed to the base element to close the cavity, the cover having a central region and a perimeter, the cover is bowed outwardly to a second height in the central region relative to the perimeter of the cover, the second height of the cover is less than the first height of the base element, the cover includes a piercing region that is configured to be pierced by a mandrel of the beverage machine at a location that is laterally offset from the central longitudinal axis and a sealing region that is configured to be sealed against by a seal of the beverage machine, the sealing region is located between the piercing region and the perimeter of the cover.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P23-Ü lauten die Ansprüche 1 und 8:
- Anspruch 1:
- „Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks, umfassend: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement eine Wand einschließt, die symmetrisch um eine zentrale Längsachse davon ist und ein offenes Ende und einen geschlossenen Bodenabschnitt aufweist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen Ende und dem geschlossenen Bodenabschnitt definiert ist, wobei die Wand eine Außenfläche und eine Innenfläche aufweist, die dem Getränkematerial gegenüberliegt; eine Vielzahl von Vertiefungen, die auf der Außenfläche der Wand um die zentrale Längsachse angeordnet sind; eine Leiste, die an der Innenfläche der Wand ausgebildet ist und in Richtung der zentralen Längsachse vorsteht, wobei die Leiste unterhalb des offenen Endes des Basiselements beabstandet ist; einen Rand am offenen Ende des Basiselements, wobei der Rand eine obere Fläche und eine gegenüberliegende untere Fläche aufweist; eine optisch detektierbare Individualisierungskennung, die von der Bodenfläche des Randes getragen wird, wobei die optisch detektierbare Individualisierungskennung Oberflächenbereiche mit unterschiedlichen optisch detektierbaren Reflexionseigenschaften aufweist, wobei die optisch detektierbare Individualisierungskennung so konfiguriert ist, dass sie von einem Sensor/Detektor einer Getränkemaschine gelesen wird, um die Portionskapsel zu individualisieren und eine Pumpe der Getränkemaschine zu aktivieren; eine Sperrschicht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Aromastoffe aus der Portionskapsel entweichen; und einen Deckel, der an dem Basiselement angebracht ist, um den Hohlraum zu schließen, wobei der Deckel einen zentralen Bereich und einen Umfang aufweist, wobei der Deckel nach außen auf eine zweite Höhe in dem zentralen Bereich relativ zu dem Umfang des Deckels gebogen ist, wobei die zweite Höhe des Deckels geringer ist als die erste Höhe des Basiselements, die Abdeckung einen Durchstoßbereich, der so konfiguriert ist, dass er von einem Dorn der Getränkemaschine an einer Stelle durchstoßen wird, die seitlich von der zentralen Längsachse versetzt ist, und einen Dichtungsbereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er von einer Dichtung der Getränkemaschine abgedichtet wird, wobei der Dichtungsbereich zwischen dem Durchstoßbereich und dem Umfang der Abdeckung angeordnet ist.“
- Anspruch 8:
- „Portionskapsel zur Herstellung eines Getränks, umfassend: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement eine Wand einschließt, die symmetrisch um eine zentrale Längsachse davon ist und ein offenes Ende und einen geschlossenen Bodenabschnitt aufweist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen Ende und dem geschlossenen Bodenabschnitt definiert ist, wobei die Wand eine Außenfläche und eine Innenfläche aufweist, die dem Getränkematerial gegenüberliegt; eine Vielzahl von vertikal ausgerichteten Vertiefungen, die an der Außenfläche der Wand angeordnet sind; eine Vielzahl von vertikal ausgerichteten Rippen, die auf der Innenfläche der Wand angeordnet sind; einen Rand am offenen Ende des Basiselements, wobei der Rand eine obere Fläche und eine gegenüberliegende untere Fläche aufweist; eine optisch detektierbare Individualisierungskennung, die von der Bodenfläche des Randes getragen wird, wobei die optisch detektierbare Individualisierungskennung Oberflächenbereiche mit unterschiedlichen optisch detektierbaren Reflexionseigenschaften aufweist, wobei die optisch detektierbare Individualisierungskennung so konfiguriert ist, dass sie von einem Sensor/Detektor einer Getränkemaschine gelesen wird, um die Portionskapsel zu individualisieren und eine Pumpe der Getränkemaschine zu aktivieren; eine Sperrschicht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Aromastoffe aus der Portionskapsel entweichen; und eine Abdeckung, die mit dem Basiselement versiegelt ist, um den Hohlraum zu schließen, wobei die Abdeckung einen zentralen Bereich und einen Umfang aufweist, wobei die Abdeckung nach außen auf eine zweite Höhe im zentralen Bereich relativ zum Umfang der Abdeckung gebogen ist, wobei die zweite Höhe der Abdeckung geringer ist als die erste Höhe des Basiselements, die Abdeckung einen Durchstoßbereich, der so konfiguriert ist, dass er von einem Dorn der Getränkemaschine an einer Stelle durchstoßen wird, die seitlich von der zentralen Längsachse versetzt ist, und einen Dichtungsbereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er von einer Dichtung der Getränkemaschine abgedichtet wird, wobei der Dichtungsbereich zwischen dem Durchstoßbereich und dem Umfang der Abdeckung angeordnet ist.“
-
bb)
Die Klägerin hat hinsichtlich der US ‘XXX bereits nicht dargelegt, dass sie sich im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Sie begründet ihren Erfindungsbesitz hinsichtlich des Merkmals von Patentanspruch 1, wonach eine anspruchsgemäße Portionskapsel eine Leiste umfasst, die an der Innenfläche der Wand ausgebildet ist und in Richtung der zentralen Längsachse vorsteht, wobei die Leiste unterhalb des offenen Endes des Basiselements beabstandet ist, ausschließlich damit, das Merkmal habe keinen technischen Effekt bzw. es handele sich hierbei um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns, die den Kern der Erfindung unberührt lasse. Ebenso begründet sie das Vorsehen einer optisch detektierbaren Individualisierungskennung und deren nähere Ausgestaltung sowie den in bestimmter Weise konfigurierten Dichtungsbereich der an dem Basiselement angebrachten Abdeckung im Rahmen von Patentanspruch 1. Im Rahmen von Patentanspruch 8 verweist sie weitgehend auf Patentanspruch 1 und damit auch auf die vorgenannte Begründung. Zur Darlegung einer fertigen und wesensgleichen Erfindung reichen diese pauschalen und in keiner Weise näher begründeten Behauptungen indes nicht aus. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
w)
Die Klägerin kann auch nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P24) von der Beklagten zu 1) verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A beverage System comprising: A) a single-serve capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element including a wall that is symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having a closed, rounded bottom portion, the base element is free of a filter inside of the cavity; ii) a Hange extending outwardly from the base element, the Hange having a top side and an opposing bottom side; iii) a cover fastened to the top side of the Hange, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location that is offset from the central longitudinal axis; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; and v) an individualization identifier, which includes an optically detectable repeat pattern, provided on the bottom side of the Hange; B) a beverage machine comprising: i) a capsule receptacle having a wall structure into which the single-serve capsule is received, the capsule receptacle defined by a base portion and an annular portion laterally extending outwardly from the base portion in a direction that is transverse to a longitudinal axis of the capsule receptacle; ii) a chamfered mandrel that pierces the cover at the location that is offset from the central longitudinal axis; iii) an optical sensor/detector positioned outside of the base portion of the wall structure of the capsule receptacle and below the annular portion, which directs a beam through a portion of the wall structure to read the individualization identifier on the singleserve capsule; iv) a pump that supplies water into the single-serve capsule only after the individualization identifier is read by the sensor/detector; v) a groove that is laterally offset from the chamfered mandrel; and vi) a seal that is at least partially seated in the groove and configured to bear against a top side of the cover in a region between the peripheral region of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel.“
- Anspruch 12 lautet:
- „A beverage System comprising: A) a single-serve capsule comprising: i) a base element with a cavity, in which a beverage material is provided, the base element including a wall that is symmetrical about a central longitudinal axis thereof and having a closed, rounded bottom portion, the base element having an exterior wall that includes a plurality of indentations arranged about the central longitudinal axis, the base element is free of a filter inside of the cavity; ii) a Hange extending outwardly from the base element, the Hange having a top side and an opposing bottom side; iii) a cover fastened to the top side of the Hange, the cover is bowed outwardly in a central region of the cover relative to a peripheral region of the cover, the cover includes a region configured to be pierced at a location that is offset from the central longitudinal axis; iv) a barrier layer to prevent moisture or aroma from escaping out of the single-serve capsule; and v) an individualization identifier, which includes an optically detectable repeat pattern, provided on the bottom side of the Hange; B) a beverage machine comprising: i) a capsule receptacle having a wall structure into which the single-serve capsule is received, the capsule receptacle defined by a base portion and an annular portion laterally extending outwardly from the base portion in a direction that is transverse to a longitudinal axis of the capsule receptacle, ii) a chamfered mandrel that pierces the cover at the location that is offset from the central longitudinal axis; iii) an optical sensor/detector positioned outside of the base portion of the wall structure of the capsule receptacle and below the annular portion, which directs a beam through a portion of the wall structure to read the identifier on the single-serve capsule, iv) a pump that supplies water into the single-serve capsule only after the individualization identifier is read by the sensor/detector; v) a groove that is laterally offset from the chamfered mandrel; and vi) a seal that is at least partially seated in the groove and configured to bear against a top side of the cover in a region between the peripheral region of the cover and the region of the cover that is pierced by the chamfered mandrel.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P24-Ü lauten die Ansprüche 1 und 12:
- Anspruch 1:
- „Ein Getränkesystem bestehend aus: A) eine Einzelportionskapsel, die Folgendes enthält: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement eine Wand aufweist, die symmetrisch zu einer zentralen Längsachse desselben ist und einen geschlossenen, abgerundeten Bodenteil hat, wobei das Basiselement innerhalb des Hohlraums frei von einem Filter ist; ii) einen Bügel, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Bügel eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite hat; iii) eine Abdeckung, die an der Oberseite der Hängevorrichtung befestigt ist, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gewölbt ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer Stelle durchstochen wird, die von der zentralen Längsachse versetzt ist; iv) eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aroma aus der Einzelportionskapsel entweicht; und v) ein Individualisierungskennzeichen, das ein optisch erkennbares, sich wiederholendes Muster enthält und auf der Unterseite des Hängers angebracht ist; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Kapselbehälter mit einer Wandstruktur, in der die Einzelportionskapsel aufgenommen wird, wobei der Kapselbehälter durch einen Basisabschnitt und einen ringförmigen Abschnitt definiert ist, der sich seitlich von dem Basisabschnitt in einer Richtung nach außen erstreckt, die quer zu einer Längsachse des Kapselbehälters verläuft; ii) einen abgeschrägten Dorn, der den Deckel an der von der zentralen Längsachse abgesetzten Stelle durchstößt; iii) einen optischen Sensor/Detektor, der außerhalb des Basisteils der Wandstruktur des Kapselbehälters und unterhalb des ringförmigen Teils positioniert ist und einen Strahl durch einen Teil der Wandstruktur lenkt, um die Individualisierungskennzeichnung auf der Einzelkapsel zu lesen; iv) eine Pumpe, die erst dann Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist, wenn die Individualisierungskennung vom Sensor/Detektor gelesen wurde; v) eine Nut, die seitlich von dem abgeschrägten Dorn versetzt ist; und vi) eine Dichtung, die zumindest teilweise in der Nut sitzt und so gestaltet ist, dass sie an einer Oberseite der Abdeckung in einem Bereich zwischen dem Umfangsbereich der Abdeckung und dem Bereich der Abdeckung, der von dem abgeschrägten Dorn durchstoßen wird, anliegt.“
- Anspruch 12:
- „Ein Getränkesystem bestehend aus: A) eine Einzelportionskapsel, die Folgendes enthält: i) ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Getränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement eine Wand aufweist, die symmetrisch um eine zentrale Längsachse desselben ist und einen geschlossenen, abgerundeten Bodenabschnitt aufweist, wobei das Basiselement eine Außenwand aufweist, die eine Vielzahl von Einbuchtungen aufweist, die um die zentrale Längsachse angeordnet sind, wobei das Basiselement innerhalb des Hohlraums frei von einem Filter ist; ii) einen Bügel, der sich von dem Basiselement nach außen erstreckt, wobei der Bügel eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite hat; iii) eine Abdeckung, die an der Oberseite der Hängevorrichtung befestigt ist, wobei die Abdeckung in einem zentralen Bereich der Abdeckung relativ zu einem peripheren Bereich der Abdeckung nach außen gewölbt ist, wobei die Abdeckung einen Bereich aufweist, der so konfiguriert ist, dass er an einer Stelle durchstochen wird, die von der zentralen Längsachse versetzt ist; iv) eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aroma aus der Einzelportionskapsel entweicht; und v) ein Individualisierungskennzeichen, das ein optisch erkennbares, sich wiederholendes Muster enthält und auf der Unterseite des Hängers angebracht ist; B) eine Getränkemaschine mit: i) einen Kapselbehälter mit einer Wandstruktur, in der die Einzelportionskapsel aufgenommen wird, wobei der Kapselbehälter durch einen Basisabschnitt und einen ringförmigen Abschnitt definiert ist, der sich seitlich von dem Basisabschnitt in einer Richtung nach außen erstreckt, die quer zu einer Längsachse des Kapselbehälters verläuft, ii) einen abgeschrägten Dorn, der den Deckel an der von der zentralen Längsachse abgesetzten Stelle durchstößt; iii) einen optischen Sensor/Detektor, der außerhalb des Basisteils der Wandstruktur des Kapselbehälters und unterhalb des ringförmigen Teils angeordnet ist und einen Strahl durch einen Teil der Wandstruktur lenkt, um die Kennung auf der Einzelportionskapsel zu lesen, iv) eine Pumpe, die erst dann Wasser in die Einzelportionskapsel einspeist, wenn die Individualisierungskennung vom Sensor/Detektor gelesen wurde; v) eine Nut, die seitlich von dem abgeschrägten Dorn versetzt ist; und vi) eine Dichtung, die zumindest teilweise in der Nut sitzt und so gestaltet ist, dass sie an einer Oberseite der Abdeckung in einem Bereich zwischen dem Umfangsbereich der Abdeckung und dem Bereich der Abdeckung, der von dem abgeschrägten Dorn durchstoßen wird, anliegt.“
-
bb)
Die Klägerin hat auch hinsichtlich der US ‘XXX nicht dargelegt, dass sie sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Auch insoweit begründet sie ihren Erfindungsbesitz – neben dem Verweis auf andere Streitschutzrechte – hinsichtlich mehrerer Merkmale mit dem pauschalen Hinweis, diese hätten keinen technischen Effekt oder es handele sich um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns, die den Kern der Erfindung unberührt lasse. Dies gilt etwa für die nach Patentanspruch 1 und Patentanspruch 12 vorgesehene Individualisierungskennung sowie die Vorgabe, wonach der Kapselbehälter durch einen Basisabschnitt und einen ringförmigen Abschnitt definiert wird, der sich seitlich von dem Basisabschnitt in einer Richtung nach außen erstreckt, die quer zu einer Längsachse des Kapselbehälters verläuft. Im Rahmen von Patentanspruch 12 gilt dies ferner für die Vorgabe, wonach das Basiselement eine Außenwand umfasst, die mehrere um die zentrale Längsachse angeordnete Vertiefungen aufweist. Für eine schlüssige Darlegung des Erfindungsbesitzes ist dieses Vorbringen, welches sich nicht näher mit der Lehre des US ‘XXX auseinandersetzt, nicht ausreichend. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
x)
Auch ein Anspruch auf Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P25) steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) nicht zu. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A beverage system for producing a beverage, comprising: a portion capsule comprising: a foil lid sealed to a base element having a cavity within which a beverage raw material is provided, the base element comprising a circumferential flange having a top side to which the lid is attached and a bottom side with a printed optically detectable identifier located on the bottom side, the optically detectable identifier includes a surface having at least two areas which differ in their reflection properties, and a beverage machine comprising: a detector to read the optically detectable identifier, a media chute configured to receive and support the portion capsule, and a pump controlled to push water into the portion capsule only upon a determination that the read optically detectable identifier agrees with a stored reference, wherein the base element has a wall region with an electrically conductive section and radial spaced and vertically oriented drawn grooves, the cavity has radially spaced and vertically oriented drawn ribs.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P25-Ü lautet Anspruch 1:
-
„Ein Getränkesystem zur Zubereitung eines Getränks, das Folgendes umfasst:
Portionskapsel, umfassend: einen Foliendeckel, der mit einem Basiselement versiegelt ist, das einen Hohlraum aufweist, in dem ein Getränke-Rohmaterial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement einen Umfangsflansch umfasst, der eine Oberseite, an der der Deckel befestigt ist, und eine Unterseite mit einem gedruckten, optisch detektierbaren Identifizierer aufweist, der sich auf der Unterseite befindet, wobei der optisch detektierbare Identifizierer eine Oberfläche mit mindestens zwei Bereichen umfasst, die sich in ihren Reflexionseigenschaften unterscheiden, und eine Getränkemaschine, die Folgendes umfasst: einen Detektor zum Lesen der optisch erkennbaren Kennung, eine Einwurfschacht, die so konfiguriert ist, dass sie die Portionskapsel aufnimmt und trägt, und eine Pumpe, die so gesteuert wird, dass sie nur dann Wasser in die Portionskapsel drückt, wenn festgestellt wird, dass die gelesene optisch erkennbare Kennung mit einer Referenzkennung übereinstimmt, wobei das Basiselement eine Wandung mit einem elektrisch leitenden Abschnitt und radial beabstandeten und vertikal ausgerichteten gezogenen Rillen aufweist, der Hohlraum radial beabstandete und vertikal ausgerichtete gezogene Rippen aufweist.“ -
bb)
Die Klägerin hat auch hinsichtlich des US ‘XXX nicht dargelegt, dass sie sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Ihr Vorbringen genügt nicht den Anforderungen an eine schlüssige Darlegung, weil sie sich – neben dem Verweis auf andere Streitschutzrechte – auch an dieser Stelle in Bezug auf mehrere Merkmale mit dem Hinweis begnügt, diese hätten keinen technischen Effekt oder es handele sich um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns, die den Kern der Erfindung unberührt lasse. Dies betrifft die Merkmale, wonach sich an der Unterseite des Basiselements eine gedruckte, optisch detektierbare Kennung befindet und diese eine Oberfläche mit mindestens zwei Bereichen aufweist, die sich in ihren Reflexionseigenschaften unterscheiden; darüber hinaus betrifft dies auch die Vorgabe, wonach das Basiselement einen Wandbereich mit einem elektrisch leitenden Abschnitt aufweist. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
y)
Die Klägerin kann von der Beklagten zu 1) nicht die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent, welches aus der Patentanmeldung US ‘XXX (Anlage K P26d) hervorgehen wird, verlangen. -
aa)
Die US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Ihr Anspruch 10 lautet: - „A method of making a portion capsule for use with a beverage making machine to make a beverage, the beverage making machine includes a pump, an optical detector, a mandrel, and a seal, the method comprising: forming a metal material into a base element that includes: i) a wall extending around a central longitudinal axis to define a cavity, and ii) a rim having a top side and an opposing bottom side; filling the cavity with a beverage material; closing the cavity by attaching a foil cover onto the top side of the rim, the cover being dimensioned and configured to be: i) pierced by the mandrel of the beverage making machine in a piercing region that is laterally offset from the central longitudinal axis, and ii) sealed by the seal of the beverage making machine in a sealing region that is located between the piercing region and an outer perimeter of the rim; and providing an optically detectable identifier onto the metal material so that the optically detectable identifier results on the bottom side of the rim, the optically detectable identifier having sections that differ optically; wherein the optically detectable identifier is configured to be read by the optical detector of the beverage making machine, and the pump is activated to supply hot water after the optically detectable identifier is read by the optical detector and compatibility of the portion capsule is determined based upon Information obtained using the optically detectable identifier.“
- Anspruch 25 lautet:
- „A method of making a portion capsule for use with a beverage making machine to make a beverage, the beverage making machine includes a pump, an optical detector, a mandrel, and a seal, the method comprising: forming a metal material into a base element that includes: i) a wall extending around a central longitudinal axis to define a cavity, ii) a rim having a top side and an opposing bottom side, and iii) a bottom area that is generally opposed to the rim and that is at least partially rounded; filling the cavity with a beverage material; closing the cavity by attaching a foil cover onto the top side of the rim, the cover being dimensioned and configured to be: i) pierced by the mandrel of the beverage making machine in a piercing region that is laterally offset from the central longitudinal axis, and ii) sealed by the seal of the beverage making machine in a sealing region that is located between the piercing region and an outer perimeter of the rim; and providing an optically detectable identifier onto the metal material so that the optically detectable identifier results on the bottom side of the rim, the optically detectable identifier having sections that differ optically; wherein the forming Step includes deep drawing the metal material, and the attaching Step includes sealing and/or bonding the foil cover to the top side of the rim; and wherein the optically detectable identifier is configured to be read by the optical detector of the beverage making machine, and the pump is activated to supply hot water after the optically detectable identifier is read by the optical detector.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P26d-Ü lauten die Ansprüche 10 und 25:
- Anspruch 10:
-
„Verfahren zur Herstellung einer Portionskapsel zur Verwendung mit einer Getränkeherstellungsmaschine zur Herstellung eines Getränks, wobei die Getränkeherstellungsmaschine eine Pumpe, einen optischen Detektor, einen Dorn und eine Dichtung aufweist, wobei das Verfahren umfasst: Formen eines Metallmaterials zu einem Basiselement, das umfasst: i) eine Wand, die sich um eine zentrale Längsachse erstreckt, um einen Hohlraum zu definieren, und ii) einen Rand mit einer Oberseite und einer gegenüberliegenden Unterseite; Füllen des Hohlraums mit einem Getränkematerial;
Verschließen des Hohlraums durch Anbringen einer Folienabdeckung auf der Oberseite des Randes, wobei die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie: i) von dem Dorn der Getränkeherstellungsmaschine in einem Durchstoßbereich durchstoßen wird, der seitlich von der zentralen Längsachse versetzt ist, und ii) von der Dichtung der Getränkeherstellungsmaschine in einem Dichtungsbereich abgedichtet wird, der sich zwischen dem Durchstoßbereich und einem äußeren Umfang des Randes befindet; und
Anbringen eines optisch detektierbaren Identifikators auf dem Metallmaterial, so dass der optisch detektierbare Identifikator auf der Unterseite der Felge entsteht, wobei der optisch detektierbare Identifikator Abschnitte aufweist, die sich optisch unterscheiden; wobei der optisch detektierbare Identifikator so konfiguriert ist, dass er von dem optischen Detektor der Getränkeherstellungsmaschine gelesen werden kann, und die Pumpe aktiviert wird, um heißes Wasser zuzuführen, nachdem der optisch detektierbare Identifikator von dem optischen Detektor gelesen wurde und die Kompatibilität der Portionskapsel auf der Grundlage von Informationen bestimmt wird, die unter Verwendung des optisch detektierbaren Identifikators erhalten wurden.“ - Anspruch 25:
-
„Verfahren zur Herstellung einer Portionskapsel zur Verwendung mit einer Getränkeherstellungsmaschine zur Herstellung eines Getränks, wobei die Getränkeherstellungsmaschine eine Pumpe, einen optischen Detektor, einen Dorn und eine Dichtung aufweist, wobei das Verfahren umfasst: Formen eines Metallmaterials zu einem Basiselement, das Folgendes umfasst: i) eine Wand, die sich um eine zentrale Längsachse herum erstreckt, um einen Hohlraum zu definieren, ii) einen Rand mit einer Oberseite und einer gegenüberliegenden Unterseite, und iii) einen Bodenbereich, der dem Rand im Allgemeinen gegenüberliegt und der zumindest teilweise abgerundet ist; Füllen des Hohlraums mit einem Getränkematerial;
Verschließen des Hohlraums durch Anbringen einer Folienabdeckung auf der Oberseite des Randes, wobei die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie: i) von dem Dorn der Getränkeherstellungsmaschine in einem Durchstoßbereich durchstoßen wird, der seitlich von der zentralen Längsachse versetzt ist, und ii) von der Dichtung der Getränkeherstellungsmaschine in einem Dichtungsbereich abgedichtet wird, der sich zwischen dem Durchstoßbereich und einem äußeren Umfang des Randes befindet; und
Anbringen einer optisch detektierbaren Kennung auf dem Metallmaterial, so dass sich die optisch detektierbare Kennung auf der Unterseite der Felge ergibt, wobei die optisch detektierbare Kennung Abschnitte aufweist, die sich optisch unterscheiden; wobei der Formungsschritt das Tiefziehen des Metallmaterials einschließt und der Anbringungsschritt das Versiegeln und/oder Verkleben der Folienabdeckung mit der Oberseite der Felge einschließt; und wobei der optisch detektierbare Identifikator so konfiguriert ist, dass er von dem optischen Detektor der Getränkeherstellungsmaschine gelesen wird, und die Pumpe aktiviert wird, um heißes Wasser zuzuführen, nachdem der optisch detektierbare Identifikator von dem optischen Detektor gelesen wurde.“ -
bb)
Die Klägerin hat hinsichtlich der US ‘XXX bzw. des aus dieser hervorgehenden Patents nicht dargelegt, dass sie sich zum Zeitpunkt der ältesten Priorität der Streitschutzrechte im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung befand. Die Klägerin verweist insoweit, was für eine schlüssige Darlegung des Erfindungsbesitzes nicht ausreicht, hinsichtlich einer ganzen Reihe von Merkmalen lediglich darauf, diese hätten keinen technischen Effekt oder es handele sich um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns, die den Kern der Erfindung unberührt lasse. Dies betrifft im Rahmen von Patentanspruch 10 etwa die Vorgabe, wonach die Getränkeherstellungsmaschine eine Pumpe, einen optischen Detektor, einen Dorn und eine Dichtung beinhaltet, die Vorgabe, wonach das Basiselement eine Wand beinhaltet, die sich um eine zentrale Längsachse erstreckt, um einen Hohlraum zu definieren, die Vorgabe, wonach die Abdeckung dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie von dem Dorn der Getränkeherstellungsmaschine in einem Durchstoßbereich durchstoßen wird, der seitlich von der zentralen Längsachse versetzt ist und wonach die Abdeckung ferner dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie von der Dichtung der Getränkeherstellungsmaschine in einem Dichtungsbereich versiegelt wird, der sich zwischen dem Durchstoßbereich und einem äußeren Umfang des Randes befindet. Darüber hinaus gilt dies für sämtliche Vorgaben im Zusammenhang mit dem Anbringen einer optisch detektierbaren Kennung auf dem Metallmaterial, so dass die optisch detektierbare Kennung auf der Unterseite des Randes angebracht ist. Mit Blick auf Patentanspruch 25 gilt dies neben den zu Patentanspruch 10 inhaltsgleichen Vorgaben etwa für das Merkmal, wonach das Anbringen einer Folienabdeckung auf der Oberseite des Randes das Versiegeln und/oder Verkleben der Folienabdeckung an der Oberseite des Randes umfasst. Nicht ausreichend ist aber auch der im Zusammenhang mit einem anderen Merkmal erfolgte Hinweis, ihre Entwicklungen hätten auch vorgesehen, dass das Formen eines Metallmaterials zu einem Basiselement einen Bodenbereich umfasst, der dem Rand im Allgemeinen gegenüberliegt und zumindest teilweise abgerundet ist. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
z)
Auch die Einräumung der Inhaberschaft an dem US-amerikanischen Patent US ‘XXX (Anlage K P27), welches aus der US-amerikanischen Patentanmeldung US 15/646,XXX hervorgegangen und während der ersten Instanz des hiesigen Rechtsstreits erteilt worden ist, kann die Klägerin von der Beklagten zu 1) nicht verlangen. -
aa)
Das US ‘XXX trägt den Titel „XXX“ (XXX). Sein Anspruch 1 lautet: - „A portion capsule for making a beverage and having an individualization identifier capable of being detected by a sensor/detection System for determining whether the portion capsule is suitable for a specific coffee machine, the portion capsule comprises: a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided, the base element is deep drawn, made of metal, and has an open upper end portion, a closed bottom, and a wall that extends from the open upper end portion to the closed bottom, the wall is rotationally symmetrical about a central longitudinal axis of the base element, the wall includes an outside surface and an inside surface that faces the raw beverage material, the base element has a first height that is defined between the open upper end portion and the closed bottom; a flange extending outwardly from the wall at the open upper end portion of the base element, the flange having a top side and an opposing bottom side, the individualization identifier is located on the bottom side of the flange; a plurality of vertically oriented grooves arranged on the outside surface of the wall, the plurality of vertically oriented grooves each have a radiused top end and a radiused bottom end and are spaced a distance between the flange and the closed bottom, the plurality vertically oriented grooves cover 20% to 80% of the wall between the flange and the closed bottom; a plurality of vertically oriented ribs arranged on the inside surface of the wall; a barrier sheet to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; a cover comprising a metal foil that is sealed to the top side of the flange, the cover having a central region and a perimeter, the cover is bowed upwardly to a second height at the central region relative to the perimeter, the second height of the cover is less than the first height of the base element, the cover being dimensioned and configured to provide a sealing area that is configured to bear against a seal of the specific coffee machine, the cover being dimensioned and configured to provide a piercing area that is configured to be pierced by a mandrel of the specific coffee machine, the piercing area being laterally offset from the central longitudinal axis of the base element; wherein the portion capsule is free of a filter inside of the cavity; and wherein the individualization identifier: i) comprises at least two areas which differ in their optically detectable reflection properties; ii) includes an optically detectable, machine readable, repeat pattem; iii) encodes Information used by the specific coffee machine to individualize the portion capsule so the portion capsule is permitted to be used with the specific coffee machine; iv) encodes Information used by the specific coffee machine to activate a pump of the specific coffee machine; v) encodes Information used by the specific coffee machine to control a beverage-making process, which includes setting a quantity of hot water, pressure of the hot water, and/or a temperature of the hot water; vi) is further provided on the outside surface of the wall of the base element; and vii) is compared to a stored reference to determine if the portion capsule is suitable for the specific coffee machine.“
- Anspruch 8 lautet:
- „A portion capsule for making a beverage and having an individualization identifier capable of being detected by a sensor/detection System for determining whether the portion capsule is suitable for a specific coffee machine, the portion capsule comprises: a base element with a cavity, in which a raw beverage material is provided, the base element is deep drawn, made of metal, and has an open upper end portion, a closed bottom, and a wall that extends from the open upper end portion to the closed bottom, the wall is rotationally symmetrical about a central longitudinal axis of the base element, the wall includes an outside surface and an inside surface that faces the raw beverage material, the base element has a first height that is defined between the open upper end portion and the closed bottom; a flange extending outwardly from the wall at the open upper end portion of the base element, the flange having a top side and an opposing bottom side, the individualization identifier is located on the bottom side of the flange; a plurality of vertically-oriented grooves arranged on the outside surface of the wall, the plurality of vertically-oriented grooves each have a radiused top end and a radiused bottom end and are spaced a distance between the flange and the closed bottom, the plurality of vertically-oriented grooves cover 20% to 80% of the wall between the flange and the closed bottom; a plurality of vertically oriented ribs arranged on the inside surface of the wall; a barrier sheet to prevent moisture or aroma from escaping out of the portion capsule; a cover comprising a metal foil that is sealed to the top side of the flange, the cover having a central region and a perimeter, the cover is bowed upwardly to a second height at the central region relative to the perimeter, the second height of the cover is less than the first height of the base element, the cover being dimensioned and configured to provide a sealing area that is configured to bear against a seal of the specific coffee machine, the cover being dimensioned and configured to provide a piercing area that is configured to be pierced by a mandrel of the specific coffee machine, the piercing area being laterally offset from the central longitudinal axis of the base element; wherein the portion capsule is free of a filter inside of the cavity; and wherein the individualization identifier: i) comprises at least two areas which differ in their optically detectable reflection properties; ii) includes an optically detectable, machine readable, repeat pattem; iii) encodes Information used by the specific coffee machine to individualize the portion capsule so the portion capsule is permitted to be used with the specific coffee machine; iv) encodes Information used by the specific coffee machine to activate a pump of the specific coffee machine; v) encodes Information used by the specific coffee machine to control a beverage-making process, which includes setting a quantity of hot water, pressure of the hot water, and/or a temperature of the hot water; vi) is compared to a stored reference to determine if the portion capsule is suitable for the specific coffee 5 machine.“
- In deutscher Übersetzung gemäß der in der Berufungsinstanz vorgelegten Anlage K P27-Ü lauten die Ansprüche 1 und 8
- Anspruch 1:
- „Portionskapsel zur Zubereitung eines Getränks, die eine Individualisierungskennung aufweist, die von einem Sensor/Detektionssystem erfasst werden kann, um festzustellen, ob die Portionskapsel für eine bestimmte Kaffeemaschine geeignet ist, wobei die Portionskapsel umfasst: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Rohgetränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement tiefgezogen ist, aus Metall besteht und einen offenen oberen Endabschnitt, einen geschlossenen Boden und eine Wand aufweist, die sich von dem offenen oberen Endabschnitt zu dem geschlossenen Boden erstreckt, wobei die Wand rotationssymmetrisch um eine zentrale Längsachse des Basiselements ist, wobei die Wand eine Außenfläche und eine Innenfläche aufweist, die dem Rohgetränkematerial zugewandt ist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen oberen Endabschnitt und dem geschlossenen Boden definiert ist; einen Flansch, der sich von der Wand am offenen oberen Endabschnitt des Basiselements nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist und die Individualisierungskennung auf der Unterseite des Flansches angeordnet ist; mehrere vertikal ausgerichtete Rillen, die auf der Außenfläche der Wand angeordnet sind, wobei die mehreren vertikal ausgerichteten Rillen jeweils ein gerundetes oberes Ende und ein gerundetes unteres Ende aufweisen und in einem Abstand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden angeordnet sind, wobei die mehreren vertikal ausgerichteten Rillen 20 % bis 80 % der Wand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden bedecken; eine Vielzahl von vertikal ausgerichteten Rippen, die auf der Innenseite der Wand angeordnet sind; eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Portionskapsel entweichen; eine Abdeckung, die eine Metallfolie umfasst, die mit der Oberseite des Flansches versiegelt ist, wobei die Abdeckung einen zentralen Bereich und einen Umfang aufweist, wobei die Abdeckung im zentralen Bereich relativ zum Umfang auf eine zweite Höhe nach oben gebogen ist, wobei die zweite Höhe der Abdeckung geringer ist als die erste Höhe des Basiselements, die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie einen Dichtungsbereich bereitstellt, der so konfiguriert ist, dass er an einer Dichtung der jeweiligen Kaffeemaschine anliegt, die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie einen Durchstoßbereich bereitstellt, der so konfiguriert ist, dass er von einem Dorn der jeweiligen Kaffeemaschine durchstoßen wird, wobei der Durchstoßbereich seitlich von der zentralen Längsachse des Basiselements versetzt ist; wobei die Portionskapsel im Inneren des Hohlraums frei von einem Filter ist; und wobei die Individualisierungskennung: i) mindestens zwei Bereiche umfasst, die sich in ihren optisch erkennbaren Reflexionseigenschaften unterscheiden; ii) ein optisch erkennbares, maschinenlesbares Wiederholungsmuster enthält; iii) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine verwendet werden, um die Portionskapsel zu individualisieren, damit die Portionskapsel mit der spezifischen Kaffeemaschine verwendet werden kann; iv) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine verwendet werden, um eine Pumpe der jeweiligen Kaffeemaschine zu aktivieren; v) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine zur Steuerung eines Getränkezubereitungsprozesses verwendet werden, einschließlich der Einstellung einer Heißwassermenge, des Drucks des Heißwassers und/oder einer Temperatur des Heißwassers; vi) ferner an der Außenfläche der Wand des Basiselements vorgesehen ist; und vii) mit einer gespeicherten Referenz verglichen wird, um festzustellen, ob die Portionskapsel für die jeweilige Kaffeemaschine geeignet ist.“
- Anspruch 8:
- „Portionskapsel zur Zubereitung eines Getränks, die eine Individualisierungskennung aufweist, die von einem Sensor/Detektionssystem erfasst werden kann, um festzustellen, ob die Portionskapsel für eine bestimmte Kaffeemaschine geeignet ist, wobei die Portionskapsel umfasst: ein Basiselement mit einem Hohlraum, in dem ein Rohgetränkematerial bereitgestellt wird, wobei das Basiselement tiefgezogen ist, aus Metall besteht und einen offenen oberen Endabschnitt, einen geschlossenen Boden und eine Wand aufweist, die sich von dem offenen oberen Endabschnitt zu dem geschlossenen Boden erstreckt, wobei die Wand rotationssymmetrisch um eine zentrale Längsachse des Basiselements ist, wobei die Wand eine Außenfläche und eine Innenfläche aufweist, die dem Rohgetränkematerial zugewandt ist, wobei das Basiselement eine erste Höhe aufweist, die zwischen dem offenen oberen Endabschnitt und dem geschlossenen Boden definiert ist; einen Flansch, der sich von der Wand am offenen oberen Endabschnitt des Basiselements nach außen erstreckt, wobei der Flansch eine Oberseite und eine gegenüberliegende Unterseite aufweist und die Individualisierungskennung auf der Unterseite des Flansches angeordnet ist; mehrere vertikal ausgerichtete Rillen, die auf der Außenfläche der Wand angeordnet sind, wobei die mehreren vertikal ausgerichteten Rillen jeweils ein gerundetes oberes Ende und ein gerundetes unteres Ende aufweisen und in einem Abstand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden angeordnet sind, wobei die mehreren vertikal ausgerichteten Rillen 20 % bis 80 % der Wand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden bedecken; eine Vielzahl von vertikal ausgerichteten Rippen, die auf der Innenseite der Wand angeordnet sind; eine Sperrschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit oder Aromen aus der Portionskapsel entweichen; eine Abdeckung, die eine Metallfolie umfasst, die mit der Oberseite des Flansches versiegelt ist, wobei die Abdeckung einen zentralen Bereich und einen Umfang aufweist, wobei die Abdeckung im zentralen Bereich relativ zum Umfang auf eine zweite Höhe nach oben gebogen ist, wobei die zweite Höhe der Abdeckung geringer ist als die erste Höhe des Basiselements, die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie einen Dichtungsbereich bereitstellt, der so konfiguriert ist, dass er an einer Dichtung der jeweiligen Kaffeemaschine anliegt, die Abdeckung so dimensioniert und konfiguriert ist, dass sie einen Durchstoßbereich bereitstellt, der so konfiguriert ist, dass er von einem Dorn der jeweiligen Kaffeemaschine durchstoßen wird, wobei der Durchstoßbereich seitlich von der zentralen Längsachse des Basiselements versetzt ist; wobei die Portionskapsel im Inneren des Hohlraums frei von einem Filter ist; und wobei die Individualisierungskennung: i) mindestens zwei Bereiche umfasst, die sich in ihren optisch erkennbaren Reflexionseigenschaften unterscheiden; ii) ein optisch erkennbares, maschinenlesbares Wiederholungsmuster enthält; iii) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine verwendet werden, um die Portionskapsel zu individualisieren, damit die Portionskapsel mit der spezifischen Kaffeemaschine verwendet werden kann; iv) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine verwendet werden, um eine Pumpe der jeweiligen Kaffeemaschine zu aktivieren; v) Informationen kodiert, die von der jeweiligen Kaffeemaschine zur Steuerung eines Getränkezubereitungsprozesses verwendet werden, einschließlich der Einstellung einer Heißwassermenge, des Drucks des Heißwassers und/oder einer Temperatur des Heißwassers; vii) mit einer gespeicherten Referenz verglichen wird, um festzustellen, ob die Portionskapsel für die jeweilige Kaffeemaschine geeignet ist.“
-
bb)
Das Landgericht hat angenommen, dass die Klägerin bereits ihren Erfindungsbesitz nicht dargetan habe. Sie habe insoweit lediglich vorgetragen, ihre Entwicklungen hätten vorgesehen, dass eine Vielzahl vertikal ausgerichteter Rillen jeweils ein abgerundetes oberes Ende und ein abgerundetes unteres Ende hätten und in einem Abstand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden beanstandet seien; zudem sollten diese 20 % bis 80 % der Wand zwischen dem Flansch und dem geschlossenen Boden abdecken. Der Beurteilung des Landgerichts, wonach mit diesem Vorbringen ein Erfindungsbesitz nicht ausreichend dargetan ist, schließt sich der Senat an. Die Klägerin wendet sich hiergegen in der Berufungsinstanz auch nur mit dem bereits erwähnten pauschalen Einwand, der unbeachtlich ist. Wie bereits erläutert, reicht es nicht aus, lediglich darauf zu verweisen, Merkmale hätten keinen technischen Effekt oder es handele sich jedenfalls um eine Abänderung/Abwandlung bzw. Ergänzung im Rahmen des Könnens des Fachmanns, die den Kern der Erfindung unberührt lässt. Dies betrifft im Rahmen des Patentanspruchs 1 des US ‘XXX – und, soweit inhaltsgleich, des Patentanspruchs 8 – eine ganze Reihe von Merkmalen, etwa die gesamte Merkmalsgruppe, die sich mit der Individualisierungskennung befasst, die Vorgabe, wonach die Abdeckung dimensioniert und konfiguriert ist, um einen Dichtungsbereich bereitzustellen, der so konfiguriert ist, um an einer Dichtung der bestimmten Kaffeemaschine anzuliegen und wonach die Abdeckung dimensioniert und konfiguriert ist, um einen Durchstoßbereich bereitzustellen, der so konfiguriert ist, um von einem Dorn der bestimmten Kaffeemaschine durchstoßen zu werden, wobei der Durchstoßbereich von der zentralen Längsachse des Basiselements seitlich versetzt ist. - Im Übrigen fehlt es auch insoweit an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten.
-
z1)
Schließlich steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 1) auch kein Anspruch auf Abtretung der PCT-Anmeldung WO ‘XXX (Anlage K P11) zu, die eine „XXX“ betrifft. - Anspruch 1 der WO ‘XXX lautet:
- „Portionskapsel (1) zur Herstellung eines Getränks mit einem Basiselement (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Getränkerohmaterial vorgesehen ist und der von einer Membran (4) verschlossen wird, die an dem Basiselement befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kennung (5) aufweist, die es ermöglicht die jeweilige Portionskapsel zu individualisieren.“
- Nach der Lehre der WO ‘XXX weist die beanspruchte Portionskapsel demnach eine Kennung auf, wobei diese nicht zwingend als Barcode ausgestaltet sein muss.
- Ob die Klägerin insoweit im Besitz einer fertigen und mit der herausverlangten Lehre wesensgleichen Erfindung war, kann offen bleiben. Es fehlt an der schlüssigen Darlegung, jedenfalls aber an einem Nachweis bzw. Beweisantritt für einen Wissenstransfer von E auf die Beklagten. Vor diesem Hintergrund lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte zu 1) Nichtberechtigte ist und fehlt es jedenfalls an den Voraussetzungen eines Vindikationsanspruchs.
-
2.
Weil nach den vorstehenden Ausführungen die Voraussetzungen eines Vindikationsanspruchs der Klägerin hinsichtlich aller Streitschutzrechte nicht vorliegen, sich insbesondere die fehlende Berechtigung der Beklagten an den auf ihren Namen angemeldeten bzw. erteilten Schutzrechten nicht feststellen lässt und dies auch für etwaige weitere aufgrund der Priorität der Streitschutzrechte anzumeldenden bzw. zu erteilenden Schutzrechte gilt, kann die Klägerin weder Auskunft über das Bestehen weiterer Schutzrechte noch die Abtretung von Schadensersatzansprüchen aus den Streitschutzrechten verlangen. Die Verpflichtung der Beklagten zu 1) bzw. der Beklagten zu 2) zum Schadensersatz aufgrund der Vorenthaltung der Schutzrechte war aus diesem Grund ebenfalls nicht festzustellen. -
3.
Auch die Vorlage von Unterlagen durch die Beklagten oder Dritte war, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht anzuordnen. -
a)
Die Voraussetzungen einer Vorlagepflicht nach §§ 422, 423 ZPO liegen nicht vor. Die Beklagten sind der Klägerin weder materiell-rechtlich zur Herausgabe der begehrten Unterlagen verpflichtet, noch haben sie sich zur Beweisführung auf diese bezogen. -
b)
Die Anordnung einer Vorlage nach § 142 Abs. 1 ZPO war ebenfalls nicht veranlasst. Nach dieser Vorschrift kann das Gericht die Vorlegung einer im Besitz einer Partei oder eines Dritten befindlichen Urkunde anordnen, auf die sich eine Partei bezogen hat. Die Voraussetzungen einer danach zu erfolgenden Anordnung liegen nicht vor. - Zwar setzt eine Vorlageanordnung nach § 142 Abs. 1 S. 1 ZPO keinen materiell-rechtlichen Herausgabeanspruch der beweisbelasteten Partei voraus (BGH, NJW 2007, 2989 Rn. 20). Allerdings ermöglicht § 142 ZPO keine Amtsaufklärung (BGH, NJW 2014, 3312 Rn. 28). Dementsprechend darf das Gericht die Urkundenvorlage nicht bloß zum Zwecke der Informationsgewinnung, sondern nur bei Vorliegen eines schlüssigen, auf konkrete Tatsachen bezogenen Vortrags der Partei anordnen (BGH, NJW 2007, 2989 Rn. 20; Senat, Urt. v. 23.11.2023 – I-2 U 36/17, GRUR-RS 2023, 35703 Rn. 126 – Zusammensetzung auf der Basis von Zirkoniumoxid und Ceroxid = GRUR-RR 2024, 362 (Ls.); vgl. auch BGH, GRUR 2022, 1302 Rn. 104 – Brustimplantat). Vorliegend fehlt es, wie ausgeführt, indes bereits an einem schlüssigen Vorbringen der Klägerin zu dem behaupteten Wissenstransfer II von E auf die Beklagten.
- Soweit es die mit Schriftsatz vom 13.11.2024 gestellten Vorlageanträge betreffend die ungeschwärzte Fassung des Schriftsatzes vom 23.08.2024 aus dem parallelen US-Verfahren gemäß Anlage K 56 samt den dort in Bezug genommenen Dokumenten aus der U.S. Discovery angeht, gilt ergänzend zu den vorstehenden Ausführungen, dass die Relevanz der begehren Vorlage nicht erkennbar ist. Die Klägerin bezieht sich darauf, die Fakten im US-Verfahren zeigten, dass T bestimmte Merkmale der Streitschutzrechte an die Beklagten weitergegeben habe, nämlich zu AH (Kapsel mit einer Zahnradform im Kapselkörper selbst, die in den Patenten als „Rillen“ beschrieben werden, die sich „vertikal“ entlang der Kapsel erstrecken), AI (Kapseln mit Kapselflansch in Form eines Zahnrads) und AJ („einen Dorn, der so konfiguriert ist, dass er die Abdeckung in einem Bereich durchstößt, der von der Mittelachse des Basiselements versetzt ist“, „eine Dichtung, die … so konfiguriert ist, dass sie gegen die Abdeckung in einem Bereich zwischen einer Umfangskante des Flansches und dem Bereich der Abdeckung, der von dem Dorn durchstoßen wird, abdichtet“, „eine Vertiefung, die seitlich von dem abgeschrägten Dorn versetzt ist, in der die Dichtung zumindest teilweise sitzt“, „Haltearme“, „Auswurfkasten“). Diese Informationen belegten mithin den Wissenstransfer von E auf die Beklagten. Jedoch verhält sich der Vortrag der Klägerin nicht dazu, dass es hinsichtlich der genannten Informationen überhaupt zu einem Wissenstransfer von der Klägerin auf E vor der ältesten Priorität der Streitschutzrechte gekommen ist. Die Klägerin macht insbesondere nicht geltend, dass diese Informationen bei den Präsentationen am 02.06.2024 und 24.06.2024 gegenüber E angesprochen worden sein sollen. Dass T an Informationen aus früheren Präsentationen von F – etwa aus der Anlage K E9 – gelangt sein könnte, macht die Klägerin nicht geltend. Vor diesem Hintergrund ist nicht feststellbar, dass die von der Klägerin in dem genannten Schriftsatz und den Unterlagen aus der U.S. Discovery vermuteten Informationen für den vorliegenden Rechtsstreit von Bedeutung sein können.
- III.
- Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
- Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.
- Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO). Soweit es die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Zusammenhang mit Vindikationsansprüchen, insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen Doppelerfindung, angeht, liegen der Entscheidung des Senats höchstrichterlich geklärte Grundsätze zugrunde und war der aus diesem Grund erfolgten Anregung der Klägerin auf Zulassung der Revision nicht nachzukommen.