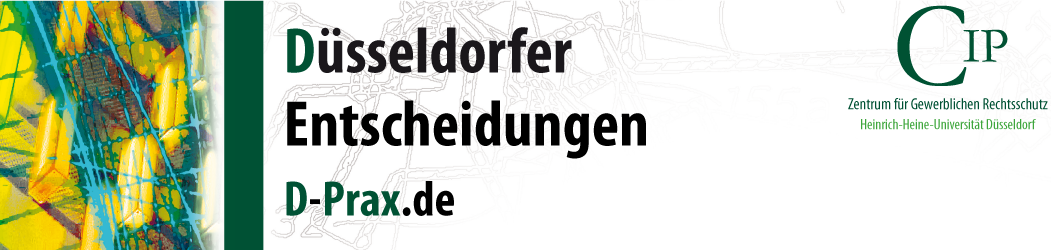Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3400
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 3. September 2024, Az. 4c O 33/22
- I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Auf die Widerklage hin wird die Klägerin verurteilt, an den Beklagten zu 2) einen Betrag von EUR 7.803,67 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, höchstens jedoch Zinsen in Höhe von 5 Prozent, seit dem 26. November 2022 zu zahlen. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.
III. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. - Tatbestand
-
Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Herausgabe zur Vernichtung, Rückruf, Erstattung ihrer Rechtsverfolgungskosten sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus behaupteter Patent-verletzung in Anspruch.
Herr B ist Kommanditist der Klägerin sowie Geschäftsführer der C GmbH, der Komplementärin der Klägerin. Er ist weiter als Inhaber des europäischen Patents EP 3 247 XXA B1 (Anlage KR A1, im Folgenden Klagepatent) im Register eingetragen. Das Klagepatent wurde am 18. Februar 2015 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 29. November 2017 und der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 27. Mai 2020 veröffentlicht. Das Klagepatent steht mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Halterung eines Köders.
Anspruch 1 des Klagepatents lautet:
„Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend:
– ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
– wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist.“
Auf die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage der Beklagten zu 1) wurde das Klagepatent durch (bislang nicht rechtskräftiges) Urteil vom 6. März 2024, Az. 8 Ni 23/23 (EP) (im Folgenden: BPatG-U), hinsichtlich seines Anspruchs 1 auf die nachfolgende Fassung beschränkt:
„Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend:
– ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
– wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann, dadurch gekennzeichnet, dass
sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist,
wobei eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders (2) an einer in einem durch das Gehäuseteil (3) begrenzten Aufnahmeraum (5) ausgebildeten oder angeordneten Aufnahmekammer (31) angeordnet oder ausgebildet ist.“ - Folgende Figur ist dem Klagepatent zur Erläuterung der klagepatentgemäßen Lehre entnommen:
- Figur 4 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Vorrichtung 1 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Darstellung zeigt insbesondere ein Gehäuseteil (3), mehrere Köderplattformen (8) sowie Durchgangsöffnungen (9), einen Köder (2), eine Köderhalteeinrichtung (12), einen Aufnahmeraum (5) und eine Aufnahmekammer (31).
Die Beklagten stellen eine Rattenköderstation unter der Bezeichnung „D“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform) her, bieten diese an und vertreiben sie jeweils bundesweit, insbesondere auch im Bezirk des angerufenen Gerichts. Die angegriffene Ausführungsform wird unter der von der Beklagten zu 1) betriebenen Webseite „https://E.de/“ und unter der von dem Beklagten zu 2) vertriebenen Webseite https://F.de/ angeboten.
Die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform kann der nachfolgenden Darstellung entnommen werden, die die angegriffene Ausführungsform mit geschlossenem Deckel seitlich schematisch im Querschnitt zeigen: - (Abbildung der Klageschrift vom 10. Juni 2022 entnommen, S. 26 = Bl. 26 d.A.)
Die angegriffene Ausführungsform lässt sich in der Kanalisation anbringen und mit einem Giftköder bestücken und ist derart ausgebildet, dass bei richtiger Anbringung gewährleistet ist, dass niemals Wasser in Kontakt mit dem Köder kommt.
Der Deckel der angegriffenen Ausführungsform lässt sich abschrauben. An diesem sind an der der Innenseite zugewandten Seite zwei Drähte befestigt, die ihrerseits mit einem Kunststoffhaken verbunden sind. An dem Kunststoffhaken wird ein Köder aufgebracht. Weiter verfügt der Deckel über eine gelochte Metallplatte mit einer Befestigung, auf der etwas eingesteckt oder aufgehängt werden kann wie nachfolgend gezeigt. - (Doppelabbildung entnommen Anlage KR II, S. 4 = Bl. 69 d. Anlagenbandes Klägerin)
Die Klägerin und Herr B haben den als Anlage KR V vorgelegten und als „Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung“ bezeichneten Vertrag abgeschlossen, welcher auf den 10. Juni 2022 datiert. - Die Klägerin hat den Beklagten zu 2) mit Schreiben vom 11. August 2021 (Anlage KR IIa) auf Grundlage des Klagepatents sowie eines weiteren Schutzrechts, des Europäischen Patents EP 3 282 XXB B1, abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Hierbei hat die Klägerin zu Unrecht sich selbst als Inhaberin des Klagepatents benannt. Der Beklagte zu 2) hat die Abmahnung mit Schreiben vom 13. Oktober 2021 (Anlage KR IIb S. 3-13) zurückgewiesen. Dabei hat er unter anderem auf die Druckschrift US 2008/0302000 A1 als entgegenstehenden Stand der Technik für das Klagepatent hingewiesen. Mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 hat die Klägerin ihren Vortrag zur Aktivlegitimation geändert und nunmehr zu einer ausschließlichen Lizenz zwischen Herrn B und der Klägerin vorgetragen.
Zudem enthält das Schreiben hinsichtlich der Beklagten zu 1) die folgende Passage:
„Zunächst möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir mittlerweile erfahren haben, dass die Verletzungsform nicht nur von Herrn G persönlich angeboten und vertrieben wird, sondern zusätzlich auch von der E GmbH, die ebenfalls in der H Str. XXC, XXXXD I sitzt und deren Geschäftsführer Herr G ist. Die unserer Mandantin aus den beiden genannten Patenten zustehenden Ansprüche werden mithin zusätzlich auch gegen die E GmbH geltend gemacht. Auch von dieser Gesellschaft – sowie von Herrn G persönlich – ist mithin eine hinreichend strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung erforderlich, um die Angelegenheit noch außergerichtlich beizulegen.
[…]
Unsere Mandanten geben Ihrer Mandantschaft angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit noch bis zum
17.01.2022
Zeit, um die entstandene Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer hinreichend strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu beseitigen. Sollte dies nicht geschehen, so behalten sie sich vor, danach ohne weitere Vorwarnung Klage wegen Patentverletzung zu erheben.“
Einen gesondert formulierten Entwurf einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung enthält das Schreiben vom 21. Dezember 2021 nicht.
Die Beklagte zu 1) hat dem Beklagten zu 2) ihr zustehende Schadensersatzansprüche gegen die Klägerin abgetreten.
Die Klägerin meint, sie sei hinsichtlich aller geltend gemachter Ansprüche aktivlegitimiert.
Sie behauptet, sie sei „von Anfang an“, also seit der Hinterlegung der Prioritätsanmeldung des Klagepatents im Januar 2015, durch mündlichen Lizenzvertrag ausschließliche Lizenznehmerin des Klagepatents. Sie sei von Herrn B zusammen mit zwei weiteren Personen gegründet worden, um die Erfindungen unter anderem des Herrn B in Form erfindungsgemäßer Produkte zu vermarkten; dabei seien der Klägerin zu allen Schutzrechten unter anderem des Herrn B ausschließliche Lizenzen eingeräumt worden. Dies sei so ausdrücklich zwischen Herrn B, Herrn J und der Klägerin vereinbart worden. Der insoweit bestehende Lizenzvertrag sei mit Herrn B und der Klägerin fortgeführt worden, als Herr B Alleininhaber des Klagepatents geworden sei.
Die Klägerin ist weiter der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch von der klagepatentgemäßen Lehre. Hieran ändere die vom Bundespatentgericht eingeschränkt aufrechterhaltene Fassung des Klagepatents nichts.
Zunächst sei der Begriff der „Köderplattform“ nach der klagepatentgemäßen Lehre derart auszulegen, dass jeder von einem Schädling zu passierende Bereich, den der Schädling passieren muss, um zu einem Köder zu gelangen, als Köderplattform anzusehen sei. Die Köderplattform sei ein Element, welches als Steighilfe, zur Anordnung von Futter oder zur Beeinflussung des Strömungsverhaltens diene.
Die Durchgangsöffnung nach der klagepatentgemäßen Lehre müsse vom Schädling auf dem Weg zum Köder passiert werden, der Schädling sich also durch die Durchgangsöffnung bewegen. Begrenzt werde die Köderplattform durch eine Durchgangsöffnung. Dass diese „köderplattfomseitig“ sein müsse, sei als Hinweis auf eine bestimmte Seite zu verstehen. Verstehe man die klagepatentgemäße Lehre so, dass die Köderplattform ihrerseits die Durchgangsöffnung begrenze, sei auch dies allerdings von der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht.
Aus der Formulierung des eingeschränkt aufrechterhaltenen Patentanspruchs, dass eine „Köderhalteeinrichtung […] an einer […] Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet ist“, folge nicht, dass die Köderhalterung sich außerhalb der Aufnahmekammer befinden müsse. Vielmehr sei erforderlich aber auch ausreichend, dass die Köderhalteeinrichtung an einer freiliegenden Fläche eines die Aufnahmekammer begrenzenden Bestandteils, wie etwa einer die Aufnahmekammer begrenzenden Wand, angeordnet oder ausgebildet ist. Zudem könne die Aufnahmekammer integral mit dem Gehäuseteil ausgebildet sein. Die Aufnahmekammer müsse auch nicht vollständig (ab)geschlossen sein. Deswegen stelle der Bereich unterhalb des Deckels (farblich hervorgehoben im Klägerschriftsatz vom 01. Juli 2024, S. 5 (= Bl. 393 d.A.)) eine klagepatentgemäße Aufnahmekammer dar.
Die Annahme des Bundespatentgerichtes, dass die Aufnahmekammer eine weitere Kammer, d.h. ein abgegrenzter Bereich gegenüber dem Gehäuseinnenraum sein müsse, sei unzutreffend. Das Bundespatentgericht stütze diese Auslegung maßgeblich auf die Funktion der Aufnahmekammer, elektrische oder elektronische Komponenten aufzunehmen. Diese seien aber nur beispielhaft genannt und könnten die Funktion der Aufnahmekammer nach der patentgemäßen Lehre nicht hierauf beschränken.
Vor diesem Hintergrund verwirkliche die angegriffene Ausführungsform die Lehre des Klagepatents wortsinngemäß.
Bei der angegriffenen Ausführungsform bilde deshalb jedenfalls (d.h. selbst wenn man eine Anordnung der Köderhaltung außerhalb der Kammer verlange) der zentrale obere durch einen ringförmigen Kragen abgegrenzte Teil der oberen Wand des schwarzen Kunststoffdeckels die Aufnahmekammer bzw. einen Bestandteil der Aufnahmekammer.
Eine Köderplattform sei bei der angegriffenen Ausführungsform durch jede Verengung des Innendurchmessers gegeben. Zudem stelle auch der (bei Ausrichtung wie im tatsächlichen Einsatz) waagerechte Bereich hinter der „Futterauffangkante“ der angegriffenen Ausführungsform eine Köderplattform dar. Die entsprechenden Durchgangsöffnungen seien die Bereiche mit verkleinertem Innendurchmesser.
Auch nach der eingeschränkten Anspruchsfassung sei eine Verwirklichung gegeben, da eine entsprechende Aufnahmekammer vorhanden sei.
Der Klägerin stünden zudem die geltend gemachten Abmahnkosten zu. Die zu Beginn unzutreffende Angabe der Aktivlegitimation der Klägerin schade nicht, da von Anfang an eine ausschließliche Lizenz bestanden habe. Die Beklagten hätten im Anschluss weiter die Berechtigung der Klägerin bestritten, obwohl die Klägerin ihre Position als ausschließliche Lizenznehmerin offengelegt habe.
Die Klägerin hat nach dem Urteil des Bundespatentgerichts im Rechtsbestandsverfahren ihren Klageantrag auf die (bislang nicht rechtskräftig) beschränkte Fassung umgestellt.
Sie beantragt zuletzt,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,-– ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1. an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zur Halterung eines Köders für Nagetiere in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen, wenn diese umfassen:
ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil, – wenigstens eine in dem Gehäuseteil angeordnete Köderplattform, welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil angeordneten Köder gelangen kann,
– wobei sich in dem Gehäuseteil bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist,
– wobei eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders an einer in einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum ausgebildeten oder angeordneten Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet ist;
2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 27.06.2020 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 27.06.2020 begangen haben, und zwar unter Angabe
a) der Herstellungsmengen und -zeiten,
a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmenge, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnung, sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage hin mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
5. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 27.06.2020 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rücknahme verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
6. als Gesamtschuldner an die Klägerin € 5.945,25 zzgl. Zinsen daraus in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser und/oder Herrn B durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 27.06.2020 begangenen Handlungen bereits entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise,
den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen;
weiter hilfsweise,
der Beklagten Vollstreckungsschutz zu gewähren und ihnen nachzulassen, eine etwaige Sicherheitsleistung auch durch Bankbürgschaft erbringen zu dürfen. - Widerklagend beantragt der Beklagte zu 2),
die Klägerin zu verurteilen, an den Beklagten zu 2) einen Betrag von EUR 7.803,67 nebst Zinsen 5 Prozent seit Rechtshängigkeit der Widerklage zu zahlen. - Die Beklagten sind der Ansicht, die angegriffene Ausführungsform mache keinen Gebrauch von der Lehre des Klagepatents.
Der Begriff „Köderplattform“ sei nach dem allgemeinen Sprachverständnis so zu verstehen, dass der Köder auf der Plattform aufliegen könne, also eine Plattform im Sinne einer Ebene vorhanden sei, die sich zum Tragen des Köders eigne. Daran ändere sich auch nichts, dass der Köder nicht zwingend auf der Plattform aufliegend angeordnet werden müsse, sondern auch an einer Köderhalteeinrichtung angebracht werden könne. Der Begriff „Plattform“ beinhalte völlig unabhängig von der tatsächlichen Auflage des Köders einen im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Bereich. Die Plattform müsse sich zum Aufenthalt des Schädlings eignen, wie etwa auch aus den Abs. [0018], [0021] und [0078] (Absätze ohne besondere Kennzeichnung sind solche der Klagepatentschrift) folge.
Zudem müsse die Köderplattform eine Durchgangsöffnung begrenzen und andererseits die Durchgangsöffnung einen unterhalb der jeweiligen Köderplattform liegenden unteren Bereich und einen oberhalb liegenden oberen Bereich definieren. Dies ergäbe sich aus Abs. [0012] sowie allen Figuren des Klagepatents. Dies gelte auch für Fälle, in denen die Köderplattform entsprechend Abs. [0019] zumindest abschnittsweise geneigt oder gebogen bzw. gekrümmt sei.
In Abschnitt [0013] sei hierzu ergänzend ausgeführt, dass das Gehäuseteil mit wenigstens einem Durchgang ausgebildet sei, der den Zutritt in einen unteren, d. h. unterhalb der untersten Köderplattform liegenden Bereich des Gehäuseteils ermögliche. Um zu dem Köder zu gelangen, müsse der in das Gehäuseteil gelangte Schädling im Weiteren durch wenigstens eine köderplattformseitig begrenzte Durchgangsöffnung auf die mit dem Köder bestückte Köderplattform gelangen.
Auch hieraus ergebe sich zwingend, dass zum einen der Durchgang des Gehäuseteils unterhalb der Köderplattform liege und sich diese damit senkrecht oberhalb befindet und zum anderen die Köderplattform zur Aufnahme des Köders und des Schädlings geeignet sein müsse.
Das Vorliegen einer Durchgangsöffnung nach der klagepatentgemäßen Lehre setzte voraus, dass die entsprechende Öffnung zum Passieren eines Schädlings vorgesehen sei. Dies folge auch aus Abs. [0012] und [0013] sowie Fig. 6.
Die Durchgangsöffnung müsse auch köderplattformseitig begrenzt sein. Dies sei so zu verstehen, dass die Öffnung durch die Plattform verlaufen müsse, d.h. räumlich vollständig von dieser umschlossen sein müsse. Dies folge aus dem sprachlichen Verständnis von „Begrenzen“, zudem zeigten alle Figuren des Klagepatents eine solche Ausgestaltung. Zwar dürften diese nicht zu einer Auslegung unterhalb des Wortlautes führen, die Figuren bestätigten jedoch insoweit ein allgemeines Verständnis des Fachmannes.
Das durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts beschränkend neu hinzugefügte Merkmal sei entsprechend den Ausführungen des Bundespatentgerichts auszulegen. Insbesondere müsse eine separate Aufnahmekammer vorhanden sein, die dazu geeignet sein müsse, technische Komponenten aufzunehmen und zu schützen. Ebenso müsse die Köderhalteeinrichtung außen an der Aufnahmekammer befestigt sein.
Vor diesem Hintergrund seien die Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre nicht verwirklicht.
Die Beklagten sind ferner der Ansicht, die von dem Beklagten zu 2) widerklagend geltend gemachten Anwalts- und Patentanwaltskosten, die sowohl diesem als auch der Beklagten zu 1) für die Abwehr der Abmahnung entstanden seien, seien dem Beklagten zu 2) von der Klägerin zu zahlen. Denn diese habe mit einer sachlich unzutreffenden Abmahnung in ihr Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen. Die Abmahnung sei unberechtigt gewesen, weil es einerseits an der Verwirklichung der Lehre des Klagepatents fehle und weil andererseits im Schreiben vom 11. August 2021 die Aktivlegitimation der Klägerin unzutreffend dargestellt war.
Die Klägerin beantragt auf den Widerklageantrag des Beklagten zu 2) hin,
die Widerklage abzuweisen.
Sie ist der Ansicht, die Widerklage sei unbegründet. Eine Patentverletzung liege vor. Zudem sei die Frage der Aktivlegitimation richtiggestellt worden, letztlich fehle es der insoweit falschen ersten Abmahnung an einer Kausalität für den geltend gemachten Schaden. Es sei lediglich der Beklagte zu 2) abgemahnt worden, weshalb der Gegenstandswert der Abmahnung – allenfalls – die Hälfte des Streitwerts, also vorliegend maximal 500.000 EUR betragen könne. Allein für das Bestreiten der Aktivlegitimation habe kein Patentanwalt mitwirken müssen.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Juli 2024 verwiesen. - Entscheidungsgründe
-
Die zulässige Klage ist unbegründet.
I.
Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Haltung eines Köders für Tiere, insbesondere Schädlinge.
Derartige Vorrichtungen seien zur Schädlingsbekämpfung, insbesondere zur Bekämpfung von Nagetieren, welche sich in von Wasser durchströmten Kanälen bzw. Leitungen aufhalten und dort beträchtliche Schäden anrichten können, vorgesehen. Solche Vorrichtungen enthielten typischerweise schädlingsspezifische Köder, welche besondere Gifte oder Wirkstoffe beinhalten, die auf verschiedenartige Weise ein Ableben der Schädlinge herbeiführen und/oder eine Vermehrung der Schädlinge verhindern, so das Klagepatent (Abs. [0002]).
Die in den Ködern enthaltenen Gifte oder Wirkstoffe stellten in der Regel für Mensch und Natur ein Gefährdungspotential dar, weswegen darauf zu achten sei, dass diese nicht in das durch entsprechende Kanäle strömende Wasser gelange und dieses kontaminiere. Herkömmliche Vorrichtungen böten gegen eine solche Kontamination jedoch bei großen Wassermengen und somit hohen Wasserständen in den Kanälen und Kanalschächten, wie etwa nach einem Starkregen, keinen ausreichenden Schutz (Abs. [0003]).
Das Klagepatent stellt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe (Abs. [0004]), eine demgegenüber verbesserte Vorrichtung zur Halterung eines Köders bereitzustellen.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor: - A1) Vorrichtung (1) zur Halterung eines Köders (2), insbesondere eines Köders für Nagetiere, umfassend
A2) ein in einen Kanalschacht, insbesondere einen Abwasserkanalschacht oder einen Kabelkanalschacht, einsetzbares Gehäuseteil (3),
A3) wenigstens eine in dem Gehäuseteil (3) angeordnete Köderplattform (8), welche wenigstens eine köderplattformseitige Durchgangsöffnung (9) begrenzt, durch welche ein Nagetier zu einem in dem Gehäuseteil (3) angeordneten Köder (2) gelangen kann,
A4) wobei sich in dem Gehäuseteil (3) bei Einströmen und/oder Aufsteigen von Wasser in das und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufgrund des gegebenen Volumens und der Dichtheit des Gehäuseteils (3) ein Gegendruck ausbildet, welcher dem in das Gehäuseteil (3) einströmenden und/oder in dem Gehäuseteil (3) aufsteigenden Wasser entgegengesetzt ist,
A6) wobei eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders an einer in einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum ausgebildeten oder angeordneten Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet ist - Die eingeschränkte Fassung ist der Entscheidung zugrunde zu legen, da die Klägerin ihre Anträge vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf die von diesem als rechtsbeständig erkannte eingeschränkte Anspruchsfassung beschränkt hat. Dies geschah ersichtlich, um eine Aussetzung des hiesigen Rechtsstreits zu vermeiden und eine Verurteilung der Beklagten auf der Fassung der vom Bundespatentgericht als rechtsbeständig erachteten Anspruchsfassung zu erreichen.
Eine Anspruchsänderung durch das Bundespatentgericht im Rechtsbestandsverfahren bewirkt eine rechtsgestaltende rückwirkende Änderung der Anspruchsfassung (BGH GRUR 1979, 308, 309 – Auspuffkanal für Schaltgase). Die Beschreibung des Patents wird durch das Urteil im Nichtigkeitsverfahren ersetzt, soweit die Beschreibung gegenstandslos geworden ist (BGH GRUR 1999, 145, 146 – Stoßwellen-Lithotripter). Aufgrund der ausdrücklichen Beschränkung der Klägerin lediglich auf die im Rechtsbestandsverfahren neu gefassten Ansprüche ist vorliegend – unbesehen der zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht eingetretenen Rechtskraft des Bundespatentgerichtsurteils – eine Auslegung auf Basis der Rechtsbestandsentscheidung geboten.
II.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre nach dem Klagepatent keinen Gebrauch. Die Kammer kann eine Verwirklichung des Merkmals A6 nicht feststellen, weswegen es keiner weiteren Ausführungen zu den zwischen den Parteien weiter im Streit stehenden Merkmalen bedarf.
Gemäß Merkmal A6 muss eine Aufnahmekammer vorhanden sein. Diese ist an einem durch das Gehäuseteil (Merkmal A2) begrenzten Aufnahmeraum ausgebildet oder angeordnet. An der Aufnahmekammer ist eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders angeordnet oder ausgebildet.
Die Aufnahmekammer muss dabei eine gegenüber dem Aufnahmeraum abgrenzbare weitere Kammer sein.
Dies folgt zunächst aus dem Merkmalswortlaut, nach welchem die Aufnahmekammer in dem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum ausgebildet oder angeordnet sein muss. Dies setzt voraus, dass zwischen Aufnahmeraum und Aufnahmekammer differenziert werden kann.
Weiter bestätigt wird dieses Verständnis durch die Passagen des BPatG-U, welche die Beschreibung des Klagepatents hinsichtlich des beschränkend hinzugefügten Merkmals A6 ergänzen. Die Urteilsgründe des BPatG-U erläutern die verwendeten Begrifflichkeiten näher.
So heißt es im BPatG-U, S. 26 f.:
„Nach Merkmal A6 [Anm. d. Kammer: entspricht dem Merkmal A6 im hiesigen Verfahren] soll eine Köderhalteeinrichtung zur Halterung wenigstens eines Köders an einer Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet sein, wobei die Aufnahmekammer in einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum ausgebildet oder angeordnet ist.
Der Aufnahmeraum wird durch das Gehäuseteil zumindest teilweise begrenzt. Ob der Aufnahmeraum auch durch eine Köderplattform begrenzt wird, wie dies in mehreren Figuren der Patentschrift dargestellt ist, geht aus dem Merkmal A6 nicht hervor.
Die Aufnahmekammer muss in dem Aufnahmeraum angeordnet oder ausgebildet sein. Die in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele zeigen sowohl, dass die Aufnahmekammer nicht vollständig in dem Aufnahmeraum angeordnet oder ausgebildet sein muss (Fig. 1 bis 6), als auch, dass sie vollständig darin angeordnet oder ausgebildet sein kann (Fig. 7 bis 10).
Die Köderhalteeinrichtung muss an, mithin außerhalb der Aufnahmekammer angeordnet oder ausgebildet sein.
Die Aufnahmekammer dient nach der Beschreibung (Abs. [0026] der Patentschrift) dazu, darin elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung, insbesondere Steuereinrichtungen und Erfassungseinrichtungen, vor äußeren Einflüssen, insbesondere klimatischen und mechanischen Einflüssen, geschützt anzuordnen. Zwar ist mit Merkmal A6 nicht zwingend vorgegeben, dass die Aufnahmekammer elektrische und/oder elektronische Komponenten aufnimmt, jedoch entnimmt der Fachmann der Patentbeschreibung, dass die Aufnahmekammer die Funktion aufweisen muss, darin befindliche Komponenten gegenüber äußeren Einflüssen zu schützen.
Aus Sicht des Fachmanns bedeutet Merkmal A6, dass in einem vom Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum, der im weitesten Sinne der ganze Gehäuseinnenraum sein kann, noch eine weitere Kammer, d.h. ein abgegrenzter Bereich, vorgesehen sein muss, an der der Köder gehaltert wird, und die darin aufgenommenen Komponenten gegen äußere Einflüsse schützt.“
Auch in den weiteren Urteilsgründen hebt das Bundespatentgericht hervor, dass die Aufnahmekammer als eine weitere Kammer, das heißt ein abgegrenzter Bereich, ausgebildet sein muss (BPatG-U S. 33), sowie dass der Köder sich nicht innerhalb der Aufnahmekammer befinden darf (BPatG-U S. 35).
Vorstehende Auslegung durch das Bundespatentgericht ist für die Kammer dabei in gleicher Weise beachtlich wie die Beschreibungen der Klagepatentschrift, da sie die vom Bundespatentgericht vorgenommene Beschränkung des Klagepatents betrifft. Die Auslegungsdiskussion der Parteien ist insoweit durch das Urteil im Rechtsbestandsverfahren überholt.
Soweit die Klägerin darüber hinaus vorträgt, aus der Beschreibung „an einer [..] Aufnahmekammer“ bedeute nicht außerhalb dieser, kann sich die Kammer ihrer Ansicht nicht anschließen. Die Klägerin verweist zur Begründung darauf, dass eine Deckenlampe „an“ der Decke eines Raumes befestigt sei, den sie beleuchten solle, aber gerade nicht außerhalb dieses Raumes. Hieraus folgert sie letztlich, dass es ausreiche, wenn die Köderhalteeinrichtung eben nur an einem die Aufnahmekammer begrenzenden Element befestigt sei und – vergleichbar einer Deckenlampe – in die Aufnahmekammer hineinragen (oder gar die Befestigung der Köderhalteeinrichtung durch die Aufnahmekammer hindurchragen) könne. Nach allgemeinem sprachlichem Verständnis ist die Deckenlampe jedoch nicht an einem Raum, sondern an der Decke des jeweiligen Raums angebracht. Damit befindet sich die Lampe – aus funktionalen Gesichtspunkten offenkundig notwendigerweise – außerhalb des Deckenkörpers. Der Sprachvergleich trägt also nicht. Soweit die Klägerin das Bundespatentgericht im vorstehenden Sinne verstehen möchte, steht die Formulierung der Urteilsgründe dem entgegen, die insoweit eindeutig besagen, dass eine Anordnung oder Ausbildung außerhalb der Aufnahmekammer erforderlich ist.
Die Klägerin führt weiter aus, die Auslegung des Bundespatentgerichts, dass die Aufnahmekammer eine weitere Kammer, d.h. ein abgegrenzter Bereich, sein müsse, sei unzutreffend. Die Klagepatentschrift schließe nicht aus, dass auch der Köder in der Aufnahmekammer untergebracht wird.
Da wie geschildert die Urteilsgründe der Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren mit Wirkung für und gegen die Allgemeinheit insoweit die Beschreibung des Klagepatents ergänzen, wie die Wirkung des Patents eingeschränkt ist, hat die Kammer vorliegend die vom Bundespatentgericht vorgenommene Auslegung als Teil der Patentbeschreibung hinzunehmen und als solche bei ihrer Auslegung zu berücksichtigen. Die Urteilsgründe sind auch eindeutig. Die Klägerin muss die ihrer Ansicht nach unzutreffenden Passagen mit dem statthaften Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts angreifen.
Darüber hinaus folgt ein entsprechendes Verständnis nach Ansicht der Kammer allerdings auch aus der Beschreibung des Klagepatents.
So heißt es insoweit
„[0026] In Anbetracht der Vielzahl an gegebenenfalls in dem Gehäuseteil anzuordnenden elektrischen und/oder elektronischen Komponenten, d. h. insbesondere entsprechender Steuerungs- oder Erfassungseinrichtungen, kann es zweckmäßig sein, dass in dem oder einem durch das Gehäuseteil begrenzten Aufnahmeraum wenigstens eine Aufnahmekammer ausgebildet oder angeordnet ist, in welcher elektrische und/oder elektronische Komponenten der Vorrichtung, insbesondere Steuereinrichtungen und Erfassungseinrichtungen, anordenbar oder angeordnet sind. Die Aufnahmekammer bietet sonach einen Schutz dieser Komponenten gegenüber äußeren, d. h. insbesondere klimatischen und mechanischen, Einflüssen.“
Die Aufnahmekammer soll also in technisch-funktionaler Hinsicht einen zusätzlichen (d.h. zum durch das Gehäuseteil bereits gewährleisteten Schutz hinzutretenden) Schutz gegenüber äußeren Einflüssen bieten. Dies bedingt technisch-funktional die Ausgestaltung als weitere Kammer gegenüber dem Aufnahmeraum, der durch das Innere des Gehäuseteils gebildet wird. Ein Einbringen des Köders in die Aufnahmekammer ist dahingegen technisch-funktional nachteilig. Denn dieser soll von Nagetieren erreicht werden, die – so das Klagepatent, Abs. [0002] – erhebliche Schäden anrichten können. Durch äußere Einflüsse mechanisch beschädigt zu werden ist sogar der bestimmungsgemäße Einsatz des Köders. Denn die Nagetiere sollen durch ihn angelockt werden und durch Nagen an ihm mit dem Gift oder Wirkstoff in Kontakt gebracht werden.
III.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die klagepatentgemäße Lehre in der Form, die sie durch die Entscheidung des Bundespatentgerichts erfahren hat, nicht.
1.
Die Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform ist zwischen den Parteien unstreitig und in den im Tatbestand wiedergegebenen Abbildungen dargestellt.
Die Klägerin hat im Nachgang zum Rechtsbestandsverfahren den Subraum des Aufnahmeraums, der sich unterhalb des Deckels, aber oberhalb der Köderhalteeinrichtung befindet, als Aufnahmekammer im Sinne des Merkmals A6 bezeichnet (vgl. die Abbildungen im Klägerschriftsatz vom 01. Juli 2024, S. 5= Bl. 393 d.A. und S. 10 = Bl. 398 d.A.).
2.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht nicht Merkmal A6. Sie weist keine Aufnahmekammer im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre auf.
Eine separate, vom Aufnahmeraum abgrenzbare Aufnahmekammer ist bei der angegriffenen Ausführungsform nicht gegeben. Diese setzt sich in ihrem oberen, den Köder enthaltenden Teil, lediglich aus dem Oben mit einem Deckel verschraubten Gehäuseteil zusammen. Darüber hinaus ist keine abgrenzbare Struktur vorhanden, die zusätzlichen Schutz gegen äußere und mechanische Einflüsse bietet.
Insbesondere stellt der von der Klägerin zuletzt als Aufnahmekammer bezeichnete Bereich unmittelbar unterhalb des Deckels keinen zusätzlichen Schutz bereit.
Die Klägerin hat die nachfolgend bezeichneten Bereiche der angegriffenen Ausführungsform als Aufnahmekammer bezeichnet: -
(Abbildungen dem Klägerschriftsatz vom 01. Juli 2024, links S. 10 (= Bl. 398 d.A.), rechts S. 5 (=Bl. 393 d.A.) entnommen)
Bei diesen Bereichen handelt sich lediglich um einen Teil des Volumens des Aufnahmeraums, der keinerlei (ob integral oder als separates Bauteil) Abgrenzungen erfährt und keinen weiteren Schutz gegen äußere und mechanische Einflüsse bietet.
Es ist letztlich keine vom Aufnahmeraum trennbare Kammer erkennbar.
Zudem ist die Köderhalteeinrichtung am Deckel befestigt. Die Köderhalteeinrichtung muss sich zur Verwirklichung der schutzrechtsgemäßen Lehre außen an der Kammer befinden. Insoweit wäre erforderlich, dass sich eine entsprechende Kammer innerhalb des Teils des Deckels befindet, an dem die Köderhalteeinrichtung befestigt ist. Dies ist vorliegend nicht der Fall.
3.
Mangels Vorliegen einer Patentverletzung stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Vernichtung und Rückruf nicht zu, Art. 64 EPÜ, §§ 139 ff. PatG. Ebenso mangelt es an einer Schadensersatzforderung, deren Bestehen dem Grunde nach festgestellt werden könnte.
Der Klägerin steht auch kein Anspruch auf Erstattung ihrer vorgerichtlichen Abmahnkosten zu. Es mangelt an einer Patentverletzung der Beklagten, die eine entsprechende Schadensersatzforderung nach § 139 Abs. 2 PatG entstehen ließe oder eine Abmahnung als berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag erstattungsfähig machen könnte, §§ 677, 683, 670 BGB.
Da mangels Verwirklichung der Lehre des Klagepatents keine Ansprüche der Klägerin bestehen, bedarf es an dieser Stelle keiner Ausführungen zur Aktivlegitimation der Klägerin (siehe aber im Folgenden sub. IV.).
IV.
Die zulässige Widerklage ist ganz überwiegend begründet. Dem Beklagten zu 2) steht der widerklagend geltend gemachte Anspruch zu, § 823 Abs. 1 BGB.
1.
Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung stellt einen Eingriff in das Recht des Abgemahnten in seinen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar (statt aller Kühnen, Handbuch d. Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. C. Rn. 138). Dieser kann verschiedene Rechte des Abgemahnten zur Folge haben, etwa einen Unterlassungsanspruch oder das Entstehen einer deliktischen Schadensersatzforderung nach § 823 Abs. 1 BGB. Der Geschädigte kann insbesondere Erstattung der Aufwendungen für die Verteidigung gegen eine Schutzrechtsverwarnung verlangen, soweit diese durch einen rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in sein Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb veranlasst wurden (BGH, GRUR 2020, 1116 Rn. 49 – Schutzrechtsverwarnung III).
Ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist dabei jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Schutzrechtsinhaber ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren an den Abgemahnten stellt (vgl. BGH NJW-RR 1997, 1404; OLG Düsseldorf BeckRS 2011, 2161; BeckOK BGB/Förster, 68. Ed. 1.11.2023, BGB § 823 Rn. 203; BeckOGK/Spindler, 1.12.2023, BGB § 823 Rn. 223). Das Unterlassungsbegehren kann dabei auch konkludent, etwa durch die Berühmung von Schadensersatzforderungen zum Ausdruck kommen (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 02.03.2009 – I-2 W 10/09 –, Rn. 5, juris = InstGE 12, 247 – Sonnenkollektor).
Weiter ist die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht durch das Vorliegen des Eingriffs als solchem indiziert, sondern muss stets im Rahmen einer Interessen- und Güterabwägung festgestellt werden (BeckOGK/Spindler, 1.12.2023, BGB § 823 Rn. 214; MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, BGB § 823 Rn. 370).
2.
Gemessen an diesem Maßstab liegt ein rechtswidriger Eingriff in das Recht auf eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Beklagten zu 2) durch das Schreiben vom 11. August 2021 und in das Recht auf eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten zu 1) durch das Schreiben vom 21. Dezember 2021 vor.
Das an den Beklagten zu 2) adressierte Schreiben vom 11. August 2021 forderte den Beklagten zu 2) ausdrücklich zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf. Es ist somit als ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren zu verstehen.
Gegenüber der Beklagten zu 1) stellt sich das Schreiben vom 21. Dezember 2021 als ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren dar. Zwar wird im Wesentlichen auf die Argumentation des Abwehrschreibens des Beklagten zu 2) erwidert. Das Schreiben bringt jedoch auch unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Beklagte zu 1) ihren Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform einstellen und einen strafbewehrten Unterlassungsvertrag abschließen soll. Andernfalls wird eine gerichtliche Auseinandersetzung in Aussicht gestellt.
Die beiden Abmahnungen stellen sich auch als rechtswidrig dar. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Abmahnung eines nicht unter das geltend gemachte Schutzrecht fallenden Produktes eine erlaubte Tätigkeit sein soll. Letztlich stellt ein solches Vorgehen das Berühmen eines nicht bestehenden Rechts der Klägerin gegenüber den Beklagten dar. Es ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass aufgrund der rückwirkenden rechtsgestaltenden Wirkung des Bundespatentgerichtsurteils maßgeblich für die Frage der Rechtswidrigkeit die nunmehrige beschränkte Fassung des Schutzrechts ist. Überdies sind die Abmahnungen aufgrund der zu diesem Zeitpunkt fehlenden Aktivlegitimation der Klägerin unberechtigt (dazu näher im Folgenden sub. 4).
3.
Das Entstehen einer Schadensersatzforderung aus § 823 Abs. 1 BGB setzt ferner ein Verschulden, konkret Vorsatz oder Fahrlässigkeit, voraus.
Vom Verschulden umfasst sein müssen diejenigen Aspekte, welche die Eigenschaft der Abmahnung als rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb begründen.
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 2 BGB. Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt aber ein (vermeintlicher) Gläubiger nicht schon dann, wenn er nicht erkennt, dass seine Forderung in der Sache nicht berechtigt ist (BGHZ 179, 238, 246). Dies würde dem Gläubiger die Durchsetzung seiner Rechte unzumutbar erschweren, da seine Berechtigung nur in einem Rechtsstreit sicher zu klären ist (BGHZ 179, 238, 246; BGH GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh). Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entspricht der Gläubiger vielmehr regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist (BGH GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh; vgl. BGHZ 179, 238, 246; BGH NJW 2011, 1063, 1065; NJW 2008, 1147, 1148). Dies gilt nicht nur hinsichtlich tatsächlicher Voraussetzungen des geltend gemachten Rechts, sondern auch bei einer unklaren Rechtslage (BGH GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh; NJW 2011, 1063, 1065; Staudinger/Caspers (2019) BGB § 276, Rn. 58). Ein Schutzrechtsinhaber setzt sich deshalb im Falle einer unberechtigten Verwarnung nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns aus, wenn er sich seine Überzeugung durch gewissenhafte Prüfung gebildet oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen (BGH GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh).
4.
Gemessen an diesem Maßstab hat die Klägerin die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und damit schuldhaft gehandelt.
Es entspricht der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, über den Umfang der einen selbst zustehenden Schutzrechte im Klaren zu sein und auch nur entsprechend abzumahnen.
Die Klägerin war indes, anders als in der Abmahnung gegenüber dem Beklagten zu 2) behauptet, nicht Inhaberin des Klagepatents.
Eine Berechtigung der Klägerin ist dabei nicht aufgrund einer behaupteten ausschließlichen Lizenz anzunehmen. Die Klägerin hat nicht ausreichend zu einer ausschließlichen Lizenz vorgetragen.
Das Zustandekommen eines ausschließlichen Lizenzvertrags zwischen Herrn B und der Klägerin ist als anspruchsbegründende Tatsache von der Klägerin darzulegen und zu beweisen. Sie hat dazu vorgetragen, dass „von Anfang an“, also seit Hinterlegung der Prioritätsanmeldung im Januar 2015, eine ausschließliche Lizenz an den Schutzrechten von Herrn B und dem weiteren Gründer der Klägerin, Herrn J, mündlich begründet worden sei und hierfür Zeugnis des Herrn J und des Herrn B angeboten. Die Beklagten haben dies bestritten.
Vor diesem Hintergrund ist der Sachvortrag der Klägerin nicht ausreichend, um in eine Beweisaufnahme einzutreten. Es hätte ihr nach dem Bestreiten der Beklagten oblegen, derart räumlich und zeitlich zu einem Handeln der beteiligten Personen vorzutragen, das hierüber Beweis erhoben werden kann. Zwar ist zutreffend, dass ein ausschließlicher Lizenzertrag mündlich oder sogar konkludent durch schlüssiges Verhalten geschlossen werden kann. Jedoch ist auch in diesem Fall grundsätzlich stets eine Willenserklärung der Parteien in Form eines äußeren Verhaltens erforderlich. Im Bestreitensfalle ist sodann hierüber Beweis zu erheben. Diesen Anforderungen genügt der Klägervortrag nicht. Es ist zu keinerlei konkretem äußeren Verhalten der beteiligten Personen vorgetragen, über das Beweis erhoben werden könnte. Die Angabe, es sei ein mündlicher Lizenzvertrag geschlossen worden, bedarf im Bestreitensfalle konkreter Ergänzung hinsichtlich der räumlich-zeitlichen Umstände zu den abgegebenen Willenserklärungen. Die Klägerin hat jedoch weder einen konkreten Zeitpunkt eines entsprechenden Gesprächs noch einen konkreten Äußerungsinhalt der beteiligten Personen vorgetragen. Damit liefe jede Beweiserhebung auf einen unzulässigen Ausforschungsbeweis hinaus.
Der vorgelegte Vertrag vom 10. Juni 2022 (Anlage KR V) kann hieran nichts ändern. Zwar bestätigt er unter Ziffer 1. eine Lizenzvergabe an die Klägerin. Er spricht indes nicht von einer „ausschließlichen“ Lizenz. Bereits deshalb kann hieraus nicht auf eine solche geschlossen werden.
Damit fehlte der Klägerin jedenfalls bis zum 10. Juni 2022 jede Berechtigung, Rechte aus dem Klagepatent gegen die Beklagten geltend zu machen. Dies war auch fahrlässig, da die Klägerin wissen musste, dass sie nicht Inhaberin des Klagepatents ist.
5.
Der Beklagten sind als adäquat kausaler Schaden ihre Rechtsverfolgungskosten, konkret sowohl Rechtsanwalts- als auch Patentanwaltskosten, zu erstatten. Die unberechtigte Abmahnung hat die Beauftragung beider verursacht. Es ist bei der Abmahnung aus einem technischen Schutzrecht, jedenfalls soweit ernstlich Fragen der Schutzrechtsverwirklichung aufgeworfen werden, aus Sicht des Abgemahnten erforderlich, sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt zu mandatieren. Auf das erst im Nachhinein vorliegende Ergebnis der Beratung durch diese kann es nicht ankommen. Da eine Abmahnung beider Beklagter erfolgt ist, war der Gegenstandswert nicht auf die Hälfte zu begrenzen.
Gegen die Höhe der Schadensersatzforderung im Übrigen und die Abtretung an den Beklagten zu 2) hat die Klägerin keine Bedenken erhoben.
Die Höhe der Zinszahlungen folgt aus §§ 288 Abs. 1 S. 2, 291 BGB. Soweit Zinsen in Höhe von fünf Prozent unabhängig vom Basiszinssatz beantragt wurden, war die Widerklage mangels Rechtsgrundlage für die Zinsforderung insoweit abzuweisen, wie der in § 288 Abs. 1 S. 2 BGB bestimmte Zinssatz fünf Prozent unterschreitet.
V.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO, diejenige über die Kosten aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.
Der Streitwert wird auf 507.803,67 EUR festgesetzt, §§ 43 Abs. 2, 45 Abs. 1 S. 1, 51 Abs. 1 GKG. Widerklagend geltend gemachte vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten wirken streitwerterhöhend (OLG Rostock BeckRS 2012, 19785; Binz/Dörndorfer/Zimmermann, GKG, 5. Aufl. 2021, § 43 Rn. 4).