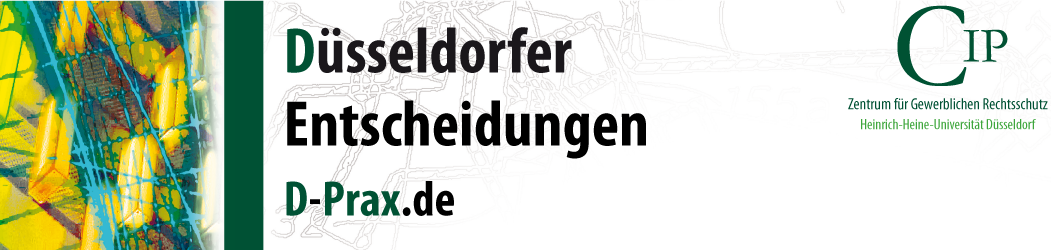Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3399
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 25. Juli 2024, Az. 4c O 26/23
- I. Die Beklagten werden verurteilt,
1. es bei Meidung eines für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, an dessen Stelle im Falle der Uneinbringlichkeit eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten tritt, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern der jeweiligen Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen
Druckwellenmassagegeräte für die Klitoris, mit einer Druckfelderzeugungseinrichtung, die mindestens einen Hohlraum mit einem ersten Ende und einem dem ersten Ende gegenüberliegenden und vom ersten Ende entfernt gelegenen zweiten Ende aufweist, wobei der Hohlraum von einer seine beiden Enden miteinander verbindenden Seitenwandung begrenzt wird und das erste Ende mit einer Öffnung zum Aufsetzen auf die Klitoris versehen ist, und einer Antriebseinrichtung, die ausgebildet ist, eine Änderung des Volumens des mindestens einen Hohlraumes zwischen einem Minimalvolumen und einem Maximalvolumen derart zu bewirken, dass in der Öffnung ein stimulierendes Druckfeld erzeugt wird,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu diesen Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,
bei denen der Hohlraum von einer einzigen durchgehenden Kammer gebildet ist, die den Hohlraum begrenzende und seine beiden Enden miteinander verbindende Seitenwandung der Kammer frei von Unstetigkeitsstellen ist, der Hohlraum der Kammer an seinem zweiten Ende mit einer flexiblen Membran verschlossen ist, die sich im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes erstreckt und von der Antriebseinrichtung abwechselnd in Richtung auf die Öffnung und in hierzu entgegengesetzter Richtung bewegt wird, und das Verhältnis von Volumenänderung zum Minimalvolumen nicht kleiner als 1/10 und nicht größer als 1 ist;
2. Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über Handlungen gemäß vorstehender Ziff. I.1., die seit dem 17. August 2019 begangen worden sind, und zwar unter Angabe
a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
b) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen und bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse gezahlt wurden,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
wobei
zum Nachweis der Angaben zu b) die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen und den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziff. I.1. bezeichneten, seit dem 17. August 2019 begangenen Handlungen entstanden ist und zukünftig noch entstehen wird.
III. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
IV. Das Urteil ist im Hinblick auf die Ziffer I. gegen einheitliche Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 5.000.000,- und im Hinblick auf die Kosten (Ziffer III.) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. - Tatbestand
-
Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus behaupteter Patentverletzung in Anspruch.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 228 XXA B1 (Anlage K7, im Folgenden: Klagepatent). Unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 04. April 2016 (DE 102016106XXB, Anlage CC 17, im Folgenden: P1) und einer weiteren Priorität vom 12. Mai 2016 (EP 16169444, im Folgenden: P2) wurde das Klagepatent am 05. Oktober 2016 angemeldet. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte unter dem 11. Oktober 2017 und der Hinweis auf die Erteilung wurde am 17. Juli 2019 bekannt gemacht. Das Klagepatent steht mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Es betrifft ein Druckwellenmassagegerät für die Klitoris.
Die Beklagte zu 1) hat – neben weiteren Einsprechenden – gegen die Erteilung des Klagepatents Einspruch eingelegt, welcher mit Entscheidung vom 18. Oktober 2022 zurückgewiesen worden ist. Die Einsprechenden, darunter die Beklagte zu 1), haben gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Das Beschwerdeverfahren dauert derzeit an (Az. T2614/22-3.2.02).
Anspruch 1 des Klagepatents lautet:
„Druckwellenmassagegerät für die Klitoris, mit einer Druckfelderzeugungseinrichtung (10), die mindestens einen Hohlraum (12) mit einem ersten Ende (12a) und einem dem ersten Ende (12a) gegenüberliegenden und vom ersten Ende (12a) entfernt gelegenen zweiten Ende (12b) aufweist, wobei der Hohlraum (12) von einer seine beiden Enden (12a, 12b) miteinander verbindenden Seitenwandung (12c) begrenzt wird und das erste Ende (12a) mit einer Öffnung (8) zum Aufsetzen auf die Klitoris versehen ist,
und
einer Antriebseinrichtung (20, 22), die ausgebildet ist, eine Änderung des Volumens des mindestens einen Hohlraumes (12) zwischen einem Minimalvolumen und einem Maximalvolumen derart zu bewirken, dass in der Öffnung (8) ein stimulierendes Druckfeld erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum (12) von einer einzigen durchgehenden Kammer (14) gebildet ist,
die den Hohlraum (12) begrenzende und seine beiden Enden (12a, 12b) miteinander verbindende Seitenwandung (12c) der Kammer (14) frei von Unstetigkeitsstellen ist,
der Hohlraum (12) der Kammer (14) an seinem zweiten Ende (12b) mit einer flexiblen Membran (18) verschlossen ist, die sich im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes (12) erstreckt und von der Antriebseinrichtung (20, 22) abwechselnd in Richtung auf die Öffnung (8) und in hierzu entgegengesetzter Richtung bewegt wird, und
das Verhältnis von Volumenänderung zum Minimalvolumen nicht kleiner als 1/10 und nicht größer als 1 ist.“
Dem Klagepatent sind folgende Figuren zur Erläuterung der klagepatentgemäßen Lehre entnommen: -
(Fig. 3 gegenüber der Abbildung in der Klagepatentschrift um 90°
im Uhrzeigersinn gedreht)
Die Fig. 1 zeigt eine perspektivische Seitenansicht des erfindungsgemäßen Druckwellenmassagegerätes gemäß einer bevorzugten Ausführungsform. Insbesondere ist am ersten Endabschnitt 2a des Gehäuses 2 ein sich quer zur Längserstreckung des Gehäuses 2 erstreckender vorspringender Fortsatz 4 angeformt, welcher zusammen mit dem ersten Endabschnitt 2a des Gehäuses 2 einen Kopf des Druckwellenmassagegerätes 1 bildet, während der zweite Endabschnitt 2b des Gehäuses 2 bevorzugt als Griff dient, um das Druckwellenmassagegerät 1 während der Anwendung zu halten.
Die Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch das Druckwellenmassagegerät von Fig. 1. In dem von dem ersten Endabschnitt 2a des Gehäuses 2 und dem Fortsatz 4 gebildeten Kopf des Druckwellenmassagegerätes 1 ist eine Druckwellenerzeugungseinrichtung 10 untergebracht, mit deren Hilfe in der Öffnung 8 ein stimulierendes Druckfeld erzeugt wird. Die Druckfelderzeugungseinrichtung 10 weist einen Hohlraum 12 mit einem äußeren ersten Ende und einem dem ersten Ende gegenüberliegenden und vom ersten Ende entfernt gelegenen inneren zweiten Ende auf, wobei das erste Ende gleichzeitig auch die Öffnung 8 in der Tülle 6 bildet. Der Hohlraum 12 wird von einer einzigen durchgehenden Kammer 14 gebildet und von einer seine beiden Enden miteinander verbindenden Innen- bzw. Seitenwandung begrenzt.
Die Klägerin und die Beklagten sind Wettbewerber unter anderem auf dem Gebiet des Vertriebs von Sextoys.
Die Beklagten vertreiben verschiedene Druckwellenvibratoren, so die Modelle E, B, D, C (nachfolgend gemeinsam angegriffene Ausführungsform E), G, F (nachfolgend gemeinsam angegriffene Ausführungsform G) sowie I und H (nachfolgend gemeinsam angegriffene Ausführungsform I).
Die Beklagte zu 2) betreibt die Webseite www.J.com, auf welcher sie die streitgegenständlichen Produkte vertreibt. Der Vertrieb erfolgte in der Vergangenheit durch die Beklagten gemeinschaftlich in Europa. Aktuell erfolgt der Verkauf maßgeblich durch die Beklagte zu 2).
Die angegriffene Ausführungsform E verfügt über einen Antriebsmotor, der an eine Pleuelstange angeschlossen ist: -
(Darstellung zeigt D, Klageschrift, S. 21 = Bl. 22)
Der Antriebsmotor wirkt über die Pleuelstange auf die Silikonschicht des Druckwellenvibrators ein und verändert das Volumen des von dieser gebildeten Hohlraums, welcher zum Aufsatz auf die Klitoris gedacht ist, indem die Silikonschicht an der Seite, an welcher die Pleuelstange befestigt ist, durch diese ausgelenkt wird.
Der Aufbau des Hohlraums ist nachfolgend im Querschnitt gezeigt: -
(Aufnahme der Beklagten, Anlage CC 5 = Bl. 368 Anlagenband Beklagte)
Die angegriffene Ausführungsform G ist in ihrem Aufbau – soweit vorliegend für den Streit zwischen den Parteien relevant – baugleich zur angegriffenen Ausführungsform E.
Bei der angegriffene Ausführungsform I handelt es sich ebenfalls um einen „Druckwellenvibrator“, dessen Aufbau nachfolgend gezeigt ist. -
(Verschiedene Darstellungen und Schnitte, Replik vom 27. Dezember 2023, S. 15 = Bl. 175 d.A.)
Der Betrieb der angegriffenen Ausführungsform I ist in nachfolgenden Abbildungen gezeigt, die jeweils unterschiedliche Zeitpunkte des Betriebs und damit unterschiedliche Auslenkungen der Pleuelstange darstellen. -
(Klageerwiderung vom 29. September 2023, S. 12 = Bl. 116)
Hinsichtlich der Volumina aller angegriffenen Ausführungsformen in voller und minimaler Ausdehnung des Hohlraums wird auf die Anlage K11 verwiesen.
Die klagepatentgemäße Lehre wird von dem von der Klägerin zwischen den Prioritätsdaten P1 und P2 der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Produkt K verwirklicht. -
Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen machten wortsinngemäß Gebrauch von der Lehre des Klagepatents.
Der Begriff der „Unstetigkeitsstellen“, von denen die Seitenwandung frei sein müsse, sei der Analysis, einem Teilgebiet der Mathematik, entlehnt. An dieses Verständnis knüpfe der Fachmann bei der Erfassung der klagepatentgemäßen Lehre jedenfalls an. Als Unstetigkeitsstelle bezeichne man eine Stelle, an der eine Funktion unstetig sei. Im Kontext der klagepatentgemäßen Lehre bezeichne dieses Erfordernis, dass die Seitenwandung keine (scharfen) Kanten aufweisen dürfe. Der Verlauf der Wandung müsse „stetig“ erfolgen, d.h. ohne Sprünge oder Kanten. Änderungen des Querschnitts des Hohlraumes hinderten eine Stetigkeit für sich genommen nicht. Ein funktionales Verständnis des Merkmals ergebe, dass eine gleichmäßige und ungehinderte Luftströmung jedenfalls dann vorliege, wenn die Luft ohne durch Unstetigkeitsstellen in der Wand ausgelöste Verwirbelungen, Ablösungen oder Abrisse ströme. Eine wirkungsvolle Luftströmung sei dann gegeben, wenn es nicht zu einer in der DE 10 2013 110 XXE A1 (im Folgenden auch: D29), die das Klagepatent als vorbekannten Stand der Technik zitiere, beschriebenen Loslösung der Wandströmung von der Seitenwand komme.
Hinsichtlich der von der klagepatentgemäßen Lehre vorgesehenen Membran sei die von der Beklagten vorgetragene Differenzierung zwischen einstückig (im Sinne mehrerer stoffschlüssig verbundenen Teile) und einteilig (im Sinne eines einzelnen, monolithischen Teils) nicht maßgeblich. Maßgeblich sei vielmehr der technische Sinngehalt, der sich unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung mit dem Begriff der Membran verbinde. Damit sei allein entscheidend, dass das den Hohlraum an seinem zweiten Ende verschließende Element ausreichend dünn sei und funktional als Druckfelderzeugungseinrichtung fungiere.
Die Membran müsse sich im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes erstrecken, wobei auf den Querschnitt am zweiten Ende, also dort, wo die Membran das zweite Ende verschließe, abzustellen sei. Die Vermeidung von „Taschenbildung“ an den Seitenrändern der Membran sei, anders als die Beklagten meinten, nicht Gegenstand der klagepatentgemäßen Lehre.
Die Rechtsbestandsangriffe der Beklagten würden überdies ohne Erfolg bleiben, weshalb eine Aussetzung nicht in Betracht komme.
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen, wie geschehen.
Die Beklagten beantragen,
die Klage abzuweisen;
hilfsweise
den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Erledigung des gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs auszusetzen.
Die Beklagten sind der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten die Lehre des Klagepatents nicht.
Der Begriff des von einer einzigen durchgehenden Kammer gebildeten Hohlraums sei derart auszulegen, dass Hohlraum als Unterfall eines Rohres zu verstehen sei. Dies ergebe sich aus der in Anspruch genommenen Prioritätsanmeldung P1, bei der allenfalls ein durchgehendes Rohr offenbart sei, nicht aber eine durchgehende Kammer. Komme man zu einem anderen Auslegungsergebnis, so sei die Priorität P1 nicht wirksam in Anspruch genommen.
Für den Begriff der „Unstetigkeitsstellen“ komme ein mathematisches Begriffsverständnis nicht in Frage. Vielmehr sei der Begriff technisch-funktional, anhand der Strömungsmechanik, zu bestimmen. Frei von Unstetigkeitsstellen sei eine Ausgestaltung der Seitenwandung, bei der eine gleichmäßige, ungehinderte und somit wirkungsvolle Luftströmung gegeben sei. Damit sei eine Unstetigkeitsstelle bei jedem Wandungsverlauf gegeben, der die Luftströmung aufgrund von Änderungen in der Kontur der Seitenwandung in ihrer Strömungsgeschwindigkeit verändere. Dies gelte daher auch für jede Verjüngung der Seitenwand, da diese zu einer Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit führe. Dass es zu einem Strömungsabriss o.ä. oder zu einer Strömungsablösung von der Wandung komme, sei nicht erforderlich, um eine Unstetigkeitsstelle anzunehmen.
Die Lehre des Klagepatents verlange weiter, dass die den Hohlraum an seinem zweiten Ende verschließende Membran klar von der die beiden Öffnungen verbindenden Seitenwandung abgrenzbar sei. Keinesfalls könne eine Kammer nach der klagepatentgemäßen Lehre einzig durch ein einzelnes Bauteil, das zugleich eine Membran darstelle, gebildet werden. Zwar könnten die Seitenwandung und die Membran einstückig ausgeführt sein. Dies umfasse eine stoffschlüssige Verbindung der einzelnen Teile Wandung und Membran. Eine einteilige Ausführung (gleichbedeutend: eine monolithische Ausführung), also die Ausbildung eines einheitlichen Bauteils ohne verschiedene, wenn auch stoffschlüssig verbundene Einzelteile für Wandung und Membran, sei nicht klagepatentgemäß. Jedenfalls aber müsste eine technisch-funktionale Differenzierung gegeben sein, da die Merkmalsteile Seitenwandung und Membran nach der Lehre des Klagepatents unterschiedliche technische Funktionen erfüllten.
Dass die Membran sich im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes erstrecken müsse, bedeute, dass sie sich auch über den wesentlichen Querschnitt des Hohlraumes bewegen müsse. Nicht entsprechend der klagepatentgemäßen Lehre sei eine Membran ausgebildet, bei der sich, ohne Abgrenzung der Membran zur Seitenwandung, an den Seiten des der Membran zugewandten Endes der Kammer Taschen bildeten, in denen die Luft nicht von der Membran weggedrückt werde.
Die Befestigung der Pleuelstange am unteren Ende der Silikonkammer führe bei der angegriffenen Ausführungsform zu einer Bewegung, die allenfalls wellenförmig und ungleichmäßig sei und nicht in den Schutzbereich der klagepatentgemäßen Lehre falle.
Das Klagepatent sei überdies nicht rechtsbeständig und werde auf die Beschwerde unter anderem der Beklagten zu 1) gegen die Einspruchsentscheidung in der hier geltend gemachten Fassung vernichtet werden.
Die Lehre des Klagepatents sei nicht neu gegenüber dem Stand der Technik. Die Druckschrift JP 2011-083XXC A (Anlage CC 14, XXC im Verfahren vor dem EPA, im Folgenden: XXC), sei neuheitsschädlich. Insbesondere offenbare die XXC auch entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung (s. Einspruchsentscheidung S. 42, Rz. 33) eine flexible Membran, die mit dieser interagierende Druckfelderzeugungseinrichtung und die beanspruchten Volumenänderungen der klagepatentgemäßen Lehre.
Ebenso neuheitsschädlich sei die Patentschrift Nr. 278733 XXD (Anlage CC 8, XXD im Verfahren vor dem EPA, im Folgenden: XXD). Insbesondere seien entgegen der Ansicht der Einspruchsabteilung (s. Einspruchsentscheidung S. 22, Rz. 25 ff., S. 46, Rz. 36.1.1) eine klagepatentgemäße Antriebseinrichtung sowie die beanspruchten Volumenänderungen offenbart.
Jedenfalls sei die klagepatentgemäße Lehre insoweit nicht erfinderisch. Die genannte Elemente der klagepatentgemäßen Lehre lägen gegenüber der XXC nahe.
Anspruch 1 sei auch nicht neu gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung K. Dieser sei neuheitsschädlich, da das Klagepatent die Priorität P1 vom 04. April 2016 nicht wirksam in Anspruch nehme. Diese sehe an keiner Stelle eine „einzige durchgehende Kammer“ vor. Vielmehr erwähne sie nur, „dass der Hohlraum der Kammer die Form eines durchgehenden Rohres aufweist“ (siehe Anspruch 6), was nicht dasselbe sei. Der von der Klägerin selbst auf den Markt gebrachte K nehme deshalb der klagepatentgemäßen Lehre die Patentierbarkeit.
Weiter fehle die erfinderische Tätigkeit gegenüber der Druckschrift DE 10 2013 110 XXE A1 (Anlage CC 10, XXE im Verfahren vor dem EPA, entspricht inhaltlich der dortigen D5, im Folgenden: XXE) allein oder in Verbindung mit der XXC.
Vor dem Hintergrund dieser Rechtsbestandsangriffe stelle sich die Einspruchsentscheidung als nicht vertretbar dar und die Beschwerdekammer werde den Erteilungsakt aufheben, weswegen eine Aussetzung zwingend geboten sei.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitigen Eingaben der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2024 verwiesen. - Entscheidungsgründe
-
Die zulässige Klage ist begründet.
I.
Das Klagepatent betrifft ein Druckwellenmassagegerät für die Klitoris.
Ein solches Gerät sei etwa, so das Klagepatent in Abs. [0002] (Absätze hier und im Folgenden ohne anderweitigen Zusatz sind solche der Klagepatentschrift), aus der XXE und der parallelen WO 2015/039XXF A1 (im Folgenden auch XXF) bekannt.
Bei diesem bekannten Gerät werde der Hohlraum von einer ersten Kammer und einer zweiten Kammer gebildet. Die zweite Kammer weise eine Öffnung zum Aufsetzen auf ein Körperteil bzw. auf eine erogene Zone auf. Die beiden Kammern seien über einen engen Verbindungskanal miteinander verbunden. Die Antriebseinrichtung sei so ausgebildet, dass sie nur das Volumen der ersten Kammer verändere, und zwar derart, dass über den Verbindungskanal in der zweiten Kammer ein stimulierendes Druckfeld erzeugt werde. Diese bekannte Konstruktion habe jedoch erhebliche Nachteile. Eine Benutzung mit Gleitgel oder unter Wasser sei nicht möglich, da das Gleitgel oder das Wasser im engen Verbindungskanal dessen Drosselwirkung so stark erhöhe, dass die Antriebseinrichtung abgewürgt werde. Außerdem erfülle das bekannte Gerät nicht die strengen Anforderungen an die notwendige Hygiene, da der Verbindungskanal aufgrund seines sehr geringen Querschnittes eine Reinigung der innen liegenden ersten Kammer verhindere, sodass sich dort Schmutz und Bakterien ansammeln könnten, deren Entfernung nicht möglich sei.
Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe (Abs. [0003]), ein Druckwellenmassagegerät der eingangs genannten Art mit einer einfachen und zugleich wirkungsvollen Konstruktion bereitzustellen, die außerdem den strengen Anforderungen an die Hygiene genügt.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in seinem unabhängigen Anspruch 1 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
1.1 Druckwellenmassagegerät für die Klitoris, mit
1.2 einer Druckfelderzeugungseinrichtung (10),
1.3 die mindestens einen Hohlraum (12) mit einem ersten Ende (12a)
1.4 und einem dem ersten Ende (12a) gegenüberliegenden und vom ersten Ende (12a) entfernt gelegenen zweiten Ende (12b) aufweist,
1.5 wobei der Hohlraum von einer seine beiden Enden (12a, 12b) miteinander verbindenden Seitenwandung (12c) begrenzt wird
1.6 und das erste Ende (12a) mit einer Öffnung (8) zum Aufsetzen auf die Klitoris versehen ist, und
1.7 einer Antriebseinrichtung (20, 22), die ausgebildet ist, eine Änderung des Volumens des mindestens einen Hohlraumes (12) zwischen einem Minimalvolumen und einem Maximalvolumen derart zu bewirken, dass in der Öffnung (8) ein stimulierendes Druckfeld erzeugt wird
dadurch gekennzeichnet, dass
1.8 der Hohlraum (12) von einer einzigen durchgehenden Kammer (14) gebildet ist,
1.9 die den Hohlraum (12) begrenzende und seine beiden Enden (12a, 12b) miteinander verbindende Seitenwandung (12c) der Kammer (14) frei von Unstetigkeitsstellen ist,
1.10 der Hohlraum (12) der Kammer (14) an seinem zweiten Ende (12b) mit einer flexiblen Membran (18) verschlossen ist,
1.11 die sich im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes (12) erstreckt und von der Antriebsreinrichtung (20, 22) abwechselnd in Richtung auf die Öffnung (8) und in hierzu entgegengesetzter Richtung bewegt wird,
1.12 und das Verhältnis von Volumenänderung zum Minimalvolumen nicht kleiner als 1/10 und nicht größer als 1 ist.
II.
Die Parteien streiten – zu Recht – allein über die Auslegung und Verwirklichung der Merkmale 1.1, 1.8, 1.9, 1.10 und 1.11, weshalb es zu diesen Merkmalen Ausführungen bedarf.
1.
Gemäß Merkmal 1.1 muss es sich bei einer klagepatentgemäßen Vorrichtung um ein Druckwellenmassagegerät für die Klitoris handeln. Dabei ist erforderlich aber für Merkmal 1.1 auch ausreichend, dass eine Massage der Klitoris durch Druckwellen erfolgt. Nicht erforderlich ist die alleinige Stimulation durch eine Druckwellenmassage der Klitoris. Es steht der Verwirklichung von Merkmal 1.1 nicht entgegen, wenn zusätzlich eine Stimulation durch von der Vorrichtung auf den Körper der Anwenderin übertragene mechanische Vibrationen erfolgt.
2.
Gemäß Merkmal 1.8 wird der Hohlraum (12) von einer einzigen durchgehenden Kammer gebildet. Das Klagepatent gibt insoweit die Form einer Kammer vor, nicht jedoch die eines Rohres.
Dies folgt zunächst aus dem Wortlaut des Anspruchs selbst, der ein Rohr nicht nennt. Auch die Klagepatentbeschreibung stützt dieses Verständnis.
In dieser ist eine Ausgestaltung des Hohlraumes der Kammer in der Form eines durchgehenden Rohres nur in den Abs. [0013] und [0026] erwähnt, wo es heißt:
„[0013] Zweckmäßigerweise kann der Hohlraum der Kammer die Form eines durchgehenden Rohres aufweisen. […]
[0026] […] Der Hohlraum 12 der Kammer 14 weist im Wesentlichen die Form eines Rotationskörpers mit einem kreisförmigen Querschnitt auf, wobei der quer zu seiner Länge L zwischen seinen beiden Enden 12a, 1215 definierte Querschnitt des Hohlraumes 12 im dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen über die gesamte Länge L zwischen seinen beiden Enden 12a, 12b nahezu gleichbleibend ist und sich nur geringfügig zur Öffnung 8 hin erweitert, sodass auch der Öffnungsquerschnitt der Öffnung 8 annähernd dem Querschnitt des Hohlraumes 12 entspricht. Alternativ ist es aber auch denkbar, beispielsweise den Hohlraum 12 mit einem elliptischen Querschnitt zu versehen. Somit bildet die Kammer 14 ein durchgehendes Rohr mit nahezu über seine gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt, wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel der Hohlraum in Richtung seiner Länge L etwa quer zur Längserstreckung des Gehäuses 2 orientiert ist.“
Die Ausgestaltung des Hohlraumes der Kammer in der Form eines durchgehenden Rohres wird also als zweckmäßig und damit optional beschrieben. Zudem zeigt lediglich das in der Klagepatentschrift dargestellte Ausführungsbeispiel einen Hohlraum in Form eines durchgehenden Rohres. Damit sieht die Lehre des Klagepatents eine solche Ausgestaltung lediglich als bevorzugten Unterfall aller möglichen Gestaltungsmöglichkeiten des Hohlraumes der Kammer vor.
Weiter gestützt wird dieses Verständnis durch den abhängigen Unteranspruch 2, welcher lautet:
„Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (12) der Kammer (14) die Form eines durchgehenden Rohres aufweist.“
Dieser Anspruch grenzt sich also vom Anspruch 1 gerade durch die Ausgestaltung des Hohlraumes der Kammer als durchgehendes Rohr ab.
Ein anderes Verständnis lässt sich – entgegen den Ausführungen der Klägerin – auch nicht aus der vom Klagepatent in Anspruch genommenen Priorität P1 ableiten. Denn dem Patentanspruch darf nicht deshalb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt werden, weil sein Gegenstand andernfalls gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert oder aus anderen Gründen nicht rechtsbeständig wäre (BGHZ 194, 107, 113 Rn. 28 = GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum; BGH GRUR 2015, 875, 876 Rn. 17 – Rotorelement; Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 14 Rn. 26). Entsprechend diesen Grundsätzen muss die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität Folgefrage der vorangehenden Auslegung des Patentanspruchs sein und kann diese nicht mitbestimmen.
Hinsichtlich des Merkmals einer einzigen durchgehenden Kammer grenzt sich die Lehre des Klagepatents von der in der Beschreibung in Bezug genommenen Druckschrift XXE ab. Das dortige Zwei-Kammer-Prinzip wird in Abs. [0002] der Klagepatentschrift als nachteilig beschrieben. Der geringe Querschnitt des Verbindungskanals führe zu einer unerwünschten Drosselwirkung und erschwere die Reinigung der aus der Perspektive der Öffnung der Vorrichtung hinteren Kammer. Auch in Abs. [0005] wird für die Ausgestaltung als eine durchgehende Kammer auf die Nachteile der in der XXE dargestellten Zwei-Kammer-Lösung implizit Bezug genommen. Damit ist die Abgrenzung von Ein-Kammer-Ausgestaltungen zu Mehr-Kammer-Ausgestaltungen über das Vorhandensein eines Verbindungskanals oder eines ähnlichen Verbindungselements mit erheblich kleinerem Durchmesser als die übrige Kammer vorzunehmen. Führt dieses Verbindungselement zu einer Drosselwirkung und erschwert die Reinigung, so liegt keine einzige durchgehende Kammer mehr vor.
3.
Merkmal 1.9 trifft räumlich-konstruktive Vorgaben für Ausgestaltung der Seitenwandung der Kammer. Diese begrenzt den Hohlraum und verbindet seine beiden Enden miteinander. Sie muss nach der klagepatentgemäßen Lehre frei von Unstetigkeitsstellen sein.
Das Klagepatent versteht unter einer Ausgestaltung einer Wandung frei von Unstetigkeitsstellen einen Wandungsverlauf, der frei von Sprüngen und Lücken ist. Zwar bringt das Klagepatent den Wandungsverlauf frei von Unstetigkeitsstellen mit strömungsmechanischen Erwägungen in Zusammenhang, bestimmte strömungsmechanische Vorgaben macht die klagepatentgemäße Lehre aber nicht.
Der Anspruchswortlaut setzt am Begriff der Unstetigkeitsstelle an. Diese Begrifflichkeit ist der Analysis, einem Teilbereich der Mathematik entlehnt. Der Fachmann wird ein entsprechendes Verständnis jedenfalls als Ausgangspunkt zugrunde legen, da mathematische Begrifflichkeiten in sämtlichen Naturwissenschaften Verwendung finden. Der Begriff der Unstetigkeitsstelle kennzeichnet das Verhalten von Funktionen. Funktionen, die Unstetigkeitsstellen aufweisen, sind sog. unstetige Funktionen. Wie die Beklagten zutreffend ausführen, sind verschiedene Arten von Unstetigkeitsstellen bekannt, etwa Sprungstellen, Unendlichkeits- oder Polstellen und Definitionslücken. Allgemeiner wird formuliert, eine Funktion sei dann stetig (und damit frei von Unstetigkeitsstellen), wenn sie nachgezeichnet werden kann, ohne den Stift abzuheben (so z.B. explizit das Verständnis des Begriffes im Einspruchsverfahren, s. Anlage CC 1 Rn. 31.1 ff.).
Ausgehend von dieser sprachlichen Bedeutung wird aus der Gesamtbedeutung des Merkmals 1.9 deutlich, dass ein bestimmtes mathematisches Verständnis von vornherein auszuscheiden hat. Frei von Unstetigkeitsstellen soll die von dem Merkmal vorgegebene Seitenwandung sein. Dies wird der Fachmann sprachlich genauer dahingehend verstehen, dass ihr Verlauf, gleich einer als Graph dargestellten Funktion in der Mathematik, frei von Unstetigkeitsstellen, mithin stetig, sein muss. Eine Unendlichkeitsstelle oder eine Polstelle sind bei der Ausgestaltung eines Bauteils schon aus naturgesetzlichen Gründen ausgeschlossen, da ein real existierendes Bauteil nicht ins Unendliche streben kann. Damit wird der Fachmann die Umschreibung der Seitenwandung als frei von Unstetigkeitsstellen derart verstehen, dass der Verlauf der Seitenwandung frei von Sprüngen und Lücken ist, also ohne Absetzen des Stiftes gezeichnet werden kann. Eine Wandungsstelle, die senkrecht abknickt, ist als Sprung zu verstehen, da, wenn man sich den Wandungsverlauf als Graph einer Funktion denkt, der Funktionswert übergangslos von einem niedrigeren auf einen höheren Wert springt.
Aus vorstehender Erwägung ergibt sich auch, dass ein senkrechter Sprung im Wandungsverlauf eine Unstetigkeitsstelle darstellt, obwohl er ohne Absetzen gezeichnet werden könnte. Denn an der Sprungstelle verändert sich der Wert einer gedachten entsprechenden Funktion in einem unendlich kleinen Bereich (vgl. Duplik vom 28. März 2024, S. 12 f. = Bl. 229 f. d.A.; vgl. a. im Übrigen die Ausführungen der Einspruchsabteilung, die über den Begriff der Wandung zum selben Merkmalsverständnis kommt, Anlage CC 1, S. 39 ff. Rn. 31.3).
Ausgehend von diesem sprachlichen Verständnis ergibt sich aus der Beschreibung des Klagepatents, welche zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen ist, Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ, kein engeres Verständnis.
So führt das Klagepatent aus:
„[0009] Für die Erzielung einer gleichmäßigen, ungehinderten und somit wirkungsvollen Luftströmung ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die den Hohlraum begrenzende und seine beiden Enden miteinander verbindende Seitenwandung der Kammer frei von Unstetigkeitsstellen ist. […]
[0013] Zweckmäßigerweise kann der Hohlraum der Kammer die Form eines durchgehenden Rohres aufweisen. […]
[0026] Wie die Figuren 3 und 4 des Weiteren erkennen lassen, ist die Anordnung von Tülle 6 und ringförmigem Element 16 derart getroffen, dass der erste Abschnitt 12c1 des Hohlraumes 12 mit dem zweiten Abschnitt 12c2 des Hohlraumes 12 fluchtet, sodass die Seitenwandung 12c des Hohlraumes 12 frei von Unstetigkeitsstellen ist. Der Hohlraum 12 der Kammer 14 weist im Wesentlichen die Form eines Rotationskörpers mit einem kreisförmigen Querschnitt auf, wobei der quer zu seiner Länge L zwischen seinen beiden Enden 12a, 12b definierte Querschnitt des Hohlraumes 12 im dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen über die gesamte Länge L zwischen seinen beiden Enden 12a, 12b nahezu gleichbleibend ist und sich nur geringfügig zur Öffnung 8 hin erweitert, sodass auch der Öffnungsquerschnitt der Öffnung 8 annähernd dem Querschnitt des Hohlraumes 12 entspricht. Alternativ ist es aber auch denkbar, beispielsweise den Hohlraum 12 mit einem elliptischen Querschnitt zu versehen. Somit bildet die Kammer 14 ein durchgehendes Rohr mit nahezu über seine gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt, wobei im dargestellten Ausführungsbeispiel der Hohlraum in Richtung seiner Länge L etwa quer zur Längserstreckung des Gehäuses 2 orientiert ist. […]
[0034] Da, wie weiter oben bereits beschrieben, der Querschnitt des Hohlraumes 12 der Kammer 14 im Wesentlichen über die gesamte Länge L nahezu gleichbleibend ist, führt dies im Betrieb dazu, dass die Luftströmungsgeschwindigkeit über die gesamte Länge L des Hohlraumes 12 im Wesentlichen gleichbleibend ist. Auf diese Weise lässt sich ein besonders wirkungsvoller Luftstrom für eine effektive Stimulierung des zu stimulierenden Körperteils bei verhältnismäßig geringem Energieverbrauch des Antriebsmotors 22 erzeugen.“
Das Klagepatent beschreibt also zunächst, dass die Freiheit von Unstetigkeitsstellen technisch-funktional dafür sorgen soll, dass eine gleichmäßige, ungehinderte und damit wirkungsvolle Luftströmung gewährleistet werden soll. Weiter soll jedenfalls die Ausgestaltung des Hohlraumes als durchgehendes Rohr zweckmäßig sein. Letztlich beschreibt das Klagepatent die Ausgestaltung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in den Absätzen [0026] und [0034]. Dieses Ausführungsbeispiel ist auch in den Figuren des Klagepatents gezeigt. Mit Blick auf die Darstellung des Ausführungsbeispiels in Fig. 4 des Klagepatents wird ausgeführt, dass der erste Abschnitt 12c1 mit dem zweiten Abschnitt 12c2 fluchtet, also in einer geraden Linie verbunden ist, und deswegen eine Freiheit von Unstetigkeitsstellen gegeben ist. Bei dem Ausführungsbeispiel tritt insgesamt eine geringe Verbreiterung des Querschnitts von dem zweiten Ende hin zum ersten Ende hin auf. Schließlich erörtert das Klagepatent noch die Möglichkeit, den Hohlraum nicht als Rotationskörper mit im Wesentlichen über die gesamte Länge gleichbleibendem Querschnitt auszugestalten, sondern als Körper mit elliptischem Querschnitt. Auch bei diesem soll der Querschnitt zwar nahezu über die gesamte Länge gleichbleiben, was dazu führt, dass auch die Luftströmungsgeschwindigkeit über die gesamte Länge des Hohlraumes im Wesentlichen gleichbleibend ist und sich auf diese Weise ein besonders wirkungsvoller Luftstrom mit verhältnismäßig geringem Energieverbrauch erzeugen lässt.
Diese Beschreibungsstellen tragen kein engeres Merkmalsverständnis.
Eine Luftströmung wird durch die Beschreibung in Verbindung mit der Freiheit von Unstetigkeitsstellen gebracht. Diese Freiheit soll dafür sorgen, dass eine gleichmäßige, ungehinderte und somit wirkungsvolle Luftströmung erzielt werden kann. Damit definiert das Klagepatent sprachlich nicht den Begriff der Unstetigkeitsstelle, sondern erklärt vielmehr jede Luftströmung als ausreichend effektiv und ungehindert, die bei einem entsprechenden Wandungsverlauf ohne Unstetigkeitsstellen erzielt wird. Würde man hingegen das Vorliegen von Unstetigkeitsstellen allein technisch-funktional davon abhängig machen, dass der entsprechende Wandungsverlauf zu einem entsprechenden Luftstrom führen kann, bliebe völlig unklar, wie die Wandung beschaffen sein muss. So ist zunächst die Einstufung eines Luftstroms als wirkungsvoll an sich nur auf die Beschreibung als gleichmäßig und ungehindert gerichtet. Stellt man auf einen gleichmäßigen und ungehinderten Luftstrom ab, so läge das Erfordernis eines stets gleichbleibenden Wandungsverlaufs und -querschnitts nahe. Allerdings wäre bei einem solchen Verständnis das einzige Ausführungsbeispiel des Klagepatents gerade nicht durch seine solcherart verstandene Lehre umfasst. Denn dort findet eine Verbreiterung des Querschnitts des Hohlraums statt, wie sich etwa Fig. 4 entnehmen lässt. Zudem spricht auch die Beschreibung einer lediglich vorteilhaften Ausgestaltung als durchgehendes Rohr gegen einen zwingend gleichbleibenden Innendurchmesser. Da für den Fachmann aber auf der Hand liegt, dass eine Verbreiterung oder Verkleinerung des Durchmessers des Hohlraums gewisse Auswirkungen auf den Luftstrom hat, andererseits aber die Ausführungsbeispiele vorliegend als klagepatentgemäß zu erachten sind, bleibt bei einem solchen Verständnis völlig unklar, in welchem Maße eine Beeinflussung des Luftstroms durch die Änderung des Verlaufs der Seitenwandung noch von der klagepatentgemäßen Lehre umfasst wäre.
Aus den Absätzen [0026] und [0034] kann ebenfalls kein entsprechender Rückschluss auf den Begriff der Unstetigkeitsstelle gezogen werden. Zunächst handeln diese von Ausführungsbeispielen, die grundsätzlich nicht geeignet sind, die Lehre des Klagepatents zu beschränken.
Zwar kann sich im Einzelfall im Wege der Auslegung durchaus ergeben, dass bestimme Vorteilsangaben oder ähnliches, was im Bereich der Ausführungsbeispiele aufgeführt wird, gerade kein bloßes Ausführungsbeispiel, sondern zwingendes Element der Lehre des jeweiligen Patentes ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.8.2015 – I-15 U 2/14, BeckRS 2015, 16355 Rz. 58 – Interfaceschaltung; Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 14 Rn. 41). So liegt es hier indes nicht. In Abs. [0026] wird eine konkrete Ausgestaltung der Wandung beschrieben (fluchtend), welche als frei von Unstetigkeitsstellen bezeichnet wird. Hier lässt sich von der konkreten Ausgestaltung her bereits keine allgemeine, einschränkende Definition einer Freiheit von Unstetigkeitsstellen ableiten, wonach ein Wandungsverlauf nur dann frei von Unstetigkeitsstellen sei, wenn er fluchte. Gleiches gilt im Ergebnis für den Abs. [0034]. Dieser nimmt zunächst sprachlich Bezug auf eine vorangegangene Passage („wie weiter oben bereits beschrieben“). Diese Bezugnahme erfolgt allerdings nicht auf den allgemeinen Teil der Klagepatentschrift, sondern auf das in Abs. [0026] näher beschriebene Ausführungsbeispiel. Zudem wird von einem besonders effektiven Luftstrom gesprochen, was auf die Beschreibung eines besonders vorteilhaften Ausführungsbeispiels schließen lässt, aber keinen allgemeinen Rückschluss auf die Lehre des Klagepatents erlaubt. Letztlich lässt sich auch aus der Formulierung in Abs. [0034], dass ein „im Wesentlichen über die gesamte Länge L nahezu gleichbleibend“ ausgestalteter Querschnitt des Hohlraums zu einer Luftströmungsgeschwindigkeit führe die „im Wesentlichen gleichbleibend ist“, kein allgemeines Erfordernis der klagepatentgemäßen Lehre ableiten. Insbesondere konkretisiert dieser Satz nicht eine gleichmäßige und ungehinderte Luftströmung dahingehend, dass diese nur bei gleichbleibendem Querschnitt gegeben ist. Es ist wiederum nur eine konkrete Ausgestaltung beschrieben, die keine Unstetigkeitsstellen aufweist. Zudem weist der Satz mit den Elementen „im Wesentlichen“ und „nahezu“ verschiedene Relativierungen auf. Im Ergebnis kann damit dieses Ausführungsbeispiel nicht als zwingendes Element der klagepatentgemäßen Lehre betrachtet werden.
Vorstehendes Verständnis wird durch die XXE, welche zulässiges Auslegungsmaterial darstellt, bestätigt.
Die XXE ist entgegen der Auffassung der Beklagten als Auslegungsmaterial heranzuziehen. Anhaltspunkte für das Verständnis eines Merkmals können sich außer aus seiner Funktion auch aus dem von der Patentschrift zitierten Stand der Technik ergeben (BGH NJW-RR 1999, 546, 548 – Sammelförderer; Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 14 Rn. 52; Busse/Keukenschrijver/Werner, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 14 Rn. 18, 50). Der zitierte Stand der Technik stellt insoweit einen Teil der Beschreibung dar, welche nach § 14 S. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ zulässigerweise zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden kann. Die XXE ist in Abs. [0002] als vorbekanntes Druckwellenmassagegerät beschrieben.
Die XXE zeigt auch, wie von der Klagepatentschrift hervorgehoben wird, einen aus zwei Kammern gebildeten Hohlraum. Die Klagepatentschrift erachtet (in Abs. [0002]) an der XXE als nachteilig, dass diese aufgrund ihrer Zwei-Kammer-Konstruktion eine Benutzung mit Gleitgel oder Wasser nicht ermögliche und außerdem schlecht zu reinigen sei. Die Abgrenzung zur XXE erfolgt dementsprechend nach der klagepatentgemäßen Lehre vor allem über das Merkmal 1.8, welches eine Konstruktion des Hohlraumes mit zwei Kammern ausschließt. Darüber hinaus zeigt die XXE in allen Figuren eine Ausgestaltung, bei der die Verbindung zwischen beiden Kammern Unstetigkeitsstellen aufweist. Weiter zeigt die XXE aber auch Ausgestaltungen einzelner Kammern mit Unstetigkeitsstellen, so etwa die Fig. 10a, 10b und 10c. Deswegen ist auch keinesfalls zutreffend, dass die XXE keine Unstetigkeitsstellen in einer Kammer, sondern nur am Verbindungskanal zeige. Auch die von der Klägerin in Bezug genommene Ablösung des Luftstroms in der XXE, etwa beschrieben im dortigen Abs. [0078] als Medienströmung erfolgt an Sprungstellen. Im Übrigen wird diese Ablösung als vorteilhaft von der XXE beschrieben. Die Nachteile, die die Klagepatentschrift mit der Lösung der XXE verbindet, werden lediglich mit Blick auf den geringen Querschnitt des Verbindungskanals hervorgehoben (Drosselwirkung, schwierige Reinigung), nicht aber bezüglich des Verlaufs der Wandung. Es ist also kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass die klagepatentgemäße Lehre sich über eine Vermeidung eines entsprechenden Ablösens von der XXE abgrenzen möchte.
Eine Auslegung, die über die im vorstehenden Sinne beschriebene Freiheit von Unstetigkeitsstellen hinaus konkrete konstruktive Vorgaben des Wandungsverlaufs im Hinblick auf bestimmte strömungsmechanische Mechanismen verlangt, findet damit im Patentanspruch auch unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Figuren keine Stütze.
Die von den Beklagten zitierte parallele Teilanmeldung EP XXG ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Art. 69 Abs. 1 EPÜ kein Auslegungsmaterial. Aufgrund der vom Gesetzgeber insoweit getroffenen Entscheidung über den Umfang des Auslegungsmaterials kommt es auf die Ähnlichkeit der Teilanmeldung zum Klagepatent nicht an. Gleiches gilt für die Ausführungen der Parteien in den Rechtsbestandsverfahren sowie die zitierten Unterlagen aus dem Erteilungsverfahren.
Ebenfalls kein Auslegungsmaterial, aber durchaus Indiz für ein entsprechendes fachmännisches Verständnis für den Begriff der Unstetigkeitsstelle stellen die Ausführungen der Einspruchsabteilung in der Einspruchsentscheidung dar (Anlage CC 1), welche durchgehend das zuvor geschilderte Verständnis der Unstetigkeitsstelle als Sprungstelle zugrunde legt. Die Einspruchsabteilung führt in den Rn. 27.5-27.6 (S. 36 f. der Entscheidung), 31-31.3 (S. 39 f.) und 34.2 (S. 45) zu einem entsprechenden Merkmalsverständnis aus.
4.
Gemäß Merkmal 1.10 muss der Hohlraum der Kammer an seinem zweiten Ende mit einer flexiblen Membran verschlossen sein.
Die Bestandteile Seitenwandung und flexible Membran müssen jedenfalls funktional abgrenzbar sein, wobei die flexible Membran gemäß Merkmal 1.11 bewegt wird, die Seitenwandung jedoch nicht. Die Seitenwandung dient als feststehende räumliche Begrenzung, die das zu ändernde Volumen festlegt und in dieser Beziehung zur technischen Gesamtwirkung beiträgt.
Dieses Verständnis folgt zunächst aus dem Begriff der „flexiblen“ Membran. Diese muss also zerstörungsfrei verformbar sein. Für die Seitenwandung wird kein entsprechendes Erfordernis aufgestellt.
Weiter wird auch die Volumenänderung, die in Merkmal 1.12 gelehrt wird, allein in Beziehung zu Merkmal 1.11 und der Bewegung der Membran gesetzt.
Auch die Klagepatentbeschreibung deutet in diese Richtung.
So heißt es im Klagepatent:
„[0008] Bei Verwendung einer von der Antriebseinrichtung in eine reziproke Bewegung zu versetzenden flexiblen Membran zur abwechselnden Erzeugung von Unter- und Überdrücken wird das Minimalvolumen des Hohlraumes als das Volumen definiert, wenn die Öffnung des Hohlraumes imaginär mit einer virtuellen planen Fläche verschlossen ist und sich die Membran in einem Betriebszustand bzw. einer Position mit dem geringsten Abstand zur Öffnung befindet. Demgegenüber wird das Maximalvolumen des Hohlraumes der Kammer als das Volumen definiert, wenn die Öffnung des Hohlraumes imaginär mit einer virtuellen planen Fläche verschlossen ist und sich die Membran in einem Betriebszustand bzw. einer Position mit dem größten Abstand zur Öffnung befindet.“
Das Klagepatent sieht also vor, dass die Membran in eine reziproke Bewegung versetzt wird, um Unter- und Überdrücke zu erzeugen. Maßgeblich für die Bestimmung des Minimalvolumens sowie des Maximalvolumens ist die Position der Membran. Die Seitenwandung wird nicht erwähnt. Nach der klagepatentgemäßen Lehre trägt sie damit zur Volumenveränderung nicht bei. Eine Auslenkung der Seitenwandung zur Volumenveränderung ist nicht vorgesehen. Sie wäre auch, jedenfalls in einem Umfang der im Vergleich der Volumenänderung durch die Auslenkung der Membran nicht vernachlässigbar ist, nicht klagepatentgemäß. Denn in diesem Falle wäre die Bestimmung des Minimal- bzw. Maximalvolumens nicht mehr über die Auslenkung der Membran allein, so wie im Klagepatent beschrieben, ermittelbar.
Ferner differenziert das Klagepatent nicht zwischen einstückig und einteilig.
So heißt es im Klagepatent:
„[0016] Bei einer Weiterbildung der zuvor angegebenen bevorzugten Ausführung bildet die innere Seitenwandung der Tülle eine im Wesentlichen durchgehende, das erste Ende mit dem zweiten Ende des Hohlraumes und somit die Öffnung der Tülle mit der Membran verbindende Seitenwandung des Hohlraumes und die Tülle zusammen mit der Membran gemeinsam ein einstückiges Bauteil. Eine solche bevorzugte Weiterbildung bietet aufgrund der einstückigen Verbindung von Tülle und Membran eine besonders einfach herzustellende Konstruktion und hat auch zusätzliche hygienische Vorteile, da sich das gesamte Bauteil aus Membran und Tülle auswechseln lässt, was nur mit der erfindungsgemäß realisierten Einkammer-Lösung möglich ist.“
Das Klagepatent erachtet demnach eine Ausbildung der Seitenwandung und der Membran als einstückiges Bauteil als bevorzugte Weiterbildung der zuvor genannten Ausführungsform. Die Weiterbildung wird ausdrücklich als erfindungsgemäß realisierte Lösung bezeichnet. Dabei liegt der besondere Vorteil darin, dass eine besonders einfach herzustellende Konstruktion vorliegt und das gesamte Bauteil auswechselbar ist.
Dabei bietet das Klagepatent, welches insoweit sein eigenes Lexikon darstellt, keinerlei Anhaltspunkte für eine Differenzierung zwischen einstückig und einteilig. Einer Differenzierung zwischen Seitenwandung und Membran steht es nicht entgegen, wenn beide in einem monolithischen Bauteil verwirklicht sind. Maßgeblich ist die technische Abgrenzung über die unterschiedlichen Funktionen, die die klagepatentgemäße Lehre mit den Merkmalselementen Seitenwandung und Membran verbindet.
Die von den Beklagten herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 31. Januar 2023 – X ZR 19/21, GRUR 2023, 877) ist für die hier maßgeblichen Fragen ohne Erkenntnisgewinn. Im dortigen Verfahren ging es um die Frage, ob eine stoffschlüssig (nicht-monolithisch) ausgeführte Verbindung nach den Begrifflichkeiten des dortigen Streitpatentes als mechanische Kopplung anzusehen sei. Demgegenüber stellt sich vorliegend die Frage der begrifflichen Unterscheidung zwischen Einstückigkeit und Einteiligkeit, die überdies zuvorderst nach der Terminologie des hiesigen Klagepatents zu beurteilen ist.
Auch der Verweis der Beklagten auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung (Rn. 20.6.1, Anlage CC 1) stützt keine entsprechende Aussage. Selbst wenn der Aufzählung der Einspruchsabteilung, dass „eine durchgehende Kammer […] nicht gleichzusetzen [ist] mit einer einstückigen oder monolithisch geformten Seitenwandung“ eine strenge Differenzierung zwischen einstückig einerseits und monolithisch (d.h. einteilig nach dem Verständnis der Beklagten) zu entnehmen sein sollte, so trifft diese Passage keinerlei Aussage darüber, dass eine klagepatentgemäße Ausgestaltung von Membran und Seitenwand, solange funktional abgrenzbar, nicht auch monolithisch ausgebildet sein darf.
Ob es sich bei der funktional abgrenzbaren Membran auch um eine Struktur handeln muss, die im Verhältnis zu ihrer Dicke eine große flächige Ausdehnung hat, braucht für den vorliegenden Streit nicht entschieden zu werden.
Auch keine Rückschlüsse lassen sich nach Ansicht der Kammer aus den zwischen den Parteien diskutierten Figuren der XXE, welche vom Klagepatent als vorbekannter Stand der Technik angeführt wird (Abs. [0002]) ziehen. Die XXE verwendet den Begriff der Membran nicht. Die XXE offenbart auch keine klagepatentgemäße Vorrichtung, da es an einer einzigen durchgehenden Kammer mangelt.
5.
Merkmal 1.11 sieht vor, dass sich die Membran im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes erstreckt. Zwischen den Parteien besteht insoweit – zu Recht – Einigkeit, dass der Querschnitt des Hohlraumes an der Stelle maßgeblich ist, wo die Membran den Hohlraum verschließt, also am zweiten Ende.
Eine Querschnittsänderung des Hohlraumes ist dagegen nicht Gegenstand von Merkmal 1.11. Vielmehr wird die zulässige Querschnittsänderung, soweit vorliegend für den Streit der Parteien relevant, von anderen Merkmalen des Anspruchs 1 (Merkmal 1.9 hinsichtlich der Freiheit von Unstetigkeitsstellen, Merkmal 1.8 hinsichtlich des Erfordernisses einer durchgehenden Kammer) vorgegeben.
Diese Erstreckung muss im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes an dieser Stelle erfolgen. Ein fest umrissenes Verständnis der Bedeutung von „im Wesentlichen“ wird von der Klagepatentschrift nicht vorgegeben. Inwieweit das mit „im Wesentlichen“ relativierte Merkmal gegeben sein muss, richtet sich damit nach den technisch-funktionalen Anforderungen, die die Lehre des Klagepatents dem entsprechenden Merkmal beimisst.
Keine Voraussetzung von Merkmal 1.11 ist, dass sich bei der Bewegung der Membran keine Taschen an den Seiten der der Membran zugewandten Teilen der Seitenwandung bilden.
Der Wortlaut des Anspruchs verlangt keine solche Einschränkung.
Dies gilt zunächst deswegen, weil für die vorstehend geschilderten Elemente, nämlich unbewegliche Seitenwandung und bewegbare flexible Membran, stets der Teil der Membran, welcher der Seitenwandung näher ist, weniger ausgelenkt wird, als ein weiter mittig liegender Teil der Membran.
Dies lässt sich auch der Abbildung des angeführten Ausführungsbeispiels entnehmen. So zeigen die Fig. 3 und Fig. 4 des Klagepatents eine Ausgestaltung, bei der die an die Seitenwandung angrenzenden Teile der Membran weniger stark in Richtung der ersten Öffnung ausgelenkt sind.
Die Bewegung in Richtung auf die Öffnung zu und in hierzu entgegengesetzter Richtung schließt nicht aus, dass sie eine wellenförmige Bewegung der Membran beinhaltet. Maßgeblich ist nach der klagepatentgemäßen Lehre, dass das Volumen des Hohlraumes abwechselnd verkleinert und vergrößert wird. Dies erfolgt durch Verkleinerung des Hohlraumes derart, dass die Membran auf die Öffnung zu bewegt und von dieser wieder entfernt wird, was zu einer Vergrößerung führt. Zusätzliche seitliche Komponenten einer Membranauslenkung lassen diese technische Wirkung unbeeinflusst. Der genaue Ablauf der Auslenkung wird auch, anders als die Volumenänderung insgesamt, welche im Merkmal 1.12 vorgegeben ist, von der klagepatentgemäßen Lehre nicht vorgegeben.
Die von den Beklagten in Bezug genommene Druckschrift FR 2 746 XXH A1 (nachfolgend D12, Anlage CC 12) wird vom Klagepatent nicht in Bezug genommen. Insoweit ist sie nicht als Auslegungsmaterial heranzuziehen. Dass sie allgemeines, geläufiges Fachwissen auf dem hier einschlägigen Stand der Technik darstellt (vgl. BGH GRUR 1978, 235, 236 – Stromwandler; Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 14 Rn. 52) ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Auch die von den Beklagten angeführten behaupteten Äußerungen der Klägerin als Patentinhaberin in Erteilungs- und Rechtsbestandsverfahren sind nicht geeignet, ein anderes Auslegungsergebnis herbeizuführen. Die Frage der Rechtsbeständigkeit ist vielmehr von der durch Auslegung zu gewinnenden Lehre des Klagepatents zu unterscheiden.
III.
Sämtliche angegriffenen Ausführungsformen, d.h. die angegriffenen Ausführungsformen E und G, aber auch die angegriffene Ausführungsform I, machen von der Lehre des Klagepatents Gebrauch.
1.
Die Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsformen ist ihrem grundsätzlichen Aufbau nach unstreitig.
Nachfolgend erneut wiedergegeben ist ein Schnitt durch die angegriffene Ausführungsform E. -
(Aufnahme der Beklagten, Anlage CC 5 = Bl. 368 Anlagenband Beklagte)
Weiterhin nachfolgend dargestellt sind verschiedene Darstellungen der angegriffenen Ausführungsform I. -
(Verschiedene Darstellungen und Schnitte, Replik vom 27. Dezember 2023, S. 15 = Bl. 175 d.A.)
2.
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen alle Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre.
a.
Die angegriffenen Ausführungsformen sind Druckwellenmassagegeräte für die Klitoris nach der klagepatentgemäßen Lehre. Soweit die Beklagten ausführen, es erfolge zusätzlich noch eine Stimulation durch mechanische Vibrationen, weshalb die angegriffenen Ausführungsformen auch als „Druckwellenvibratoren“ bezeichnet würden, kann dies eine Verwirklichung des Merkmals 1.1 nicht hindern.
b.
Der Hohlraum der angegriffenen Ausführungsformen wird von einer einzigen durchgehenden Kammer gebildet. Im Rahmen der Vorgaben des Merkmals 1.9 („frei von Unstetigkeitsstellen“) sowie des Erfordernisses lediglich einer Kammer schließen Querschnittsänderungen des Innendurchmessers des Hohlraumes die Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre nicht aus.
Ebenso weisen die angegriffenen Ausführungsformen eine einzige durchgehende Kammer auf. Der zur Öffnung hin sich erst verjüngende und sodann über einen kurzen Abschnitt wieder verbreiternde Wandungsverlauf führt weder zur Reinigungsschwierigkeiten noch zu einer Drosselwirkung, die die angegriffenen Ausführungsformen als Zwei-Kammer-Systeme nach dem Verständnis der klagepatentgemäßen Lehre kennzeichnen würden. Die Relation der Verjüngung des Innendurchmessers ist gänzlich anders dimensioniert als die Ausgestaltung des Verbindungskanals etwa der XXE.
c.
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen das Merkmal 1.9. Die Seitenwandung ist bei allen angegriffenen Ausführungsformen frei von Unstetigkeitsstellen.
Dass die Seitenwandung und die Membran als monolithisches Bauteil ausgestaltet sind, steht dem Vorhandensein einer Seitenwandung nicht entgegen. Maßgeblich ist die funktionale Abgrenzbarkeit der Seitenwandung von der beweglichen Membran einerseits sowie von der ersten Öffnung andererseits. Vorliegend wird durch die in den Rippen des Kunststoffgehäuses gelagerte seitliche Fläche der Silikonkammer durch das Gehäuse so fixiert, dass sie anders als der untere, mit der Pleuelstange verbundene Bereich durch die Stangenbewegung nicht oder nicht maßgeblich ausgelenkt wird. Damit ist eine Seitenwandung als solche bei den angegriffenen Ausführungsformen vorhanden.
Diese Seitenwandung ist auch frei von Unstetigkeitsstellen im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre. Sie weist keine Sprünge oder Lücken auf. In ihrem Verlauf entspricht sie dem Graphen einer stetigen Funktion. Eine Verjüngung und eine Änderung des Querschnittsdurchmessers jeweils als solche stehen der Annahme einer Seitenwandung frei von Unstetigkeitsstellen nicht entgegen. Auf die von den Beklagten vorgetragenen, durchaus erheblichen Reduzierungen der Innendurchmesser der Hohlräume über den Verlauf der Seitenwandungen der angegriffenen Ausführungsformen zu den jeweiligen Öffnungen hin kommt es nicht entscheidend an, weil die klagepatentgemäße Lehre insoweit keine Vorgaben macht.
d.
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch die Merkmale 1.10 und 1.11.
Der jeweilige Boden der Kammer bildet die Membran, die aus biegsamem und damit flexiblem Material besteht. Die sich bewegende Membran erstreckt sich auch im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt des Hohlraumes. Im Betrieb des Massagegerätes wird sie entsprechend Merkmal 1.11 ausgelenkt. Die Membran stellt bei der jeweiligen angegriffenen Ausführungsform den gesamten von der Pleuelstange ausgelenkten Bereich des Silikonkörpers dar. Die Bildung von „Taschen“ an den Seiten der Membran hin zur Seitenwandung steht der Verwirklichung des Merkmals 1.11 nicht entgegen.
Dort, wo der Silikonkörper im ordnungsgemäßen Betrieb der Vorrichtung keine Bewegung mehr erfährt, weil er durch das Plastikgehäuse fixiert ist, findet der Übergang von Membran zu Seitenwandung statt.
Die von den Beklagten geschilderte wellenförmige Bewegung der Pleuelstange ändert an der grundlegenden Bewegungsrichtung der Membran in Richtung zur Öffnung und zurück nichts. Die Membran wird deshalb von der Pleuelstange als Antriebseinrichtung abwechselnd in Richtung auf die Öffnung und in hierzu entgegengesetzter Richtung bewegt.
Dies gilt insbesondere auch für die angegriffene Ausführungsform I. Die von den Beklagten als nahezu kugelförmig beschriebene Konstruktion wird an ihrem der Öffnung entgegengesetzten Ende vollflächig derart auf die Öffnung zubewegt, dass eine funktional klar abgrenzbare Membran erkennbar ist. Die Ränder der Kuppel werden hingegen durch das Gehäuse (funktional vergleichbar den Rippen bei der angegriffenen Ausführungsform E) derart fixiert, dass sie nicht ausgelenkt werden und eine anspruchsgemäße Seitenwandung bilden.
Mit der Membran ist auch ein abgrenzbares zweites Ende des Hohlraumes nach der Lehre des Klagepatents gegeben (von den Parteien zum Teil unter Merkmal 1.4 erörtert).
e.
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch das Merkmal 1.12.
Die Klägerin hat zu den angegriffenen Ausführungsformen Volumenmessungen vorgelegt, die im von Merkmal 1.12 beanspruchten Bereich liegen. Die Beklagten haben lediglich die Messmethode angegriffen, nicht aber die Ergebnisse bestritten. Damit steht die Verwirklichung des Merkmals 1.12 fest.
IV.
Aufgrund der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre durch die angegriffenen Ausführungsform bestehen die folgenden Rechtsfolgen, Art. 64 Abs. 1 EPÜ.
1.
Da die Beklagten das Klagepatent widerrechtlich benutzt haben, sind sie gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet.
2.
Die Beklagten trifft auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Denn die Beklagten als Fachunternehmen bzw. ihre Geschäftsführer hätten bei Anwendung der von ihnen im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents schulden die Beklagten daher Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, § 139 Abs. 2 PatG.
Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten ihr gegenüber dem Grunde nach festgestellt wird.
3.
Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz zu beziffern, sind die Beklagten verpflichtet, im zuerkannten Umfang über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, §§ 140b PatG, 259, 242 BGB.
V.
Der Rechtsstreit ist nicht auszusetzen. Die Kammer kann nicht feststellen, dass die Einspruchsabteilung das Klagepatent mit unvertretbarer Begründung aufrecht erhalten hat.
Ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung der Nichtigkeitsklage als solche stellt noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen (BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; GRUR 2014, 1237 ff. – Kurznachrichten), da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen.
Wenn das Klagepatent mit einer Patentnichtigkeitsklage angegriffen ist, verurteilt das Verletzungsgericht, wenn es eine Verletzung des in Kraft stehenden Patents bejaht, grundsätzlich nur dann wegen Patentverletzung, wenn es eine Nichtigerklärung nicht für (überwiegend) wahrscheinlich hält; andernfalls hat es die Verhandlung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO auszusetzen, bis jedenfalls erstinstanzlich über die Nichtigkeitsklage entschieden ist (BGH GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Denn eine – vorläufig vollstreckbare – Verpflichtung des Beklagten zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung sowie Vernichtung patentgemäßer Erzeugnisse ist regelmäßig nicht zu rechtfertigen, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten steht, dass dieser Verurteilung durch die Nichtigerklärung des Klagepatents die Grundlage entzogen werden wird. Der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbürgte Justizgewährungsanspruch gebietet, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvollen Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Gegenangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Dies erfordert nicht nur eine effektive Möglichkeit, diesen Angriff selbst durch eine Klage auf Nichtigerklärung führen zu können, sondern auch eine angemessene Berücksichtigung des Umstands, dass in diesem Angriff auch ein – und gegebenenfalls das einzige – Verteidigungsmittel gegen die Inanspruchnahme aus dem Patent liegen kann. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer Widerklage auf Nichtigerklärung geführt werden. Dies darf indessen nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH GRUR 2014, 1237, 1238 – Kurznachrichten). Vergleichbares gilt für einen im Einspruchsverfahren geführten Rechtsbestandsangriff (vgl. Schulte/Voß, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 311).
Dabei gilt, dass das Verletzungsgericht die im Rechtsbestandsverfahren erstinstanzlich aufrechterhaltende Entscheidung, die unter Beteiligung technischer Fachleute zustande gekommen ist, grundsätzlich hinzunehmen hat (Kühnen, Hbd. Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. E Rn. 973). Wenn die Argumentation im Rechtsbestandsverfahren jedenfalls vertretbar erscheint, hat es bei der getroffenen Entscheidung im Einspruchsverfahren zu bleiben, sofern nicht besondere Umstände, bei denen etwa beispielsweise ein neuer geltend gemachter Stand der Technik maßgeblich sein kann, geltend gemacht werden (Kühnen, aaO). Die Entscheidung muss für eine Aussetzung offenbar unrichtig sein (Schulte/Voß, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 311).
Gemessen an diesem Maßstab ist der vorliegende Rechtsstreit nicht auszusetzen.
1.
Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass die klagepatentgemäße Lehre als neu einzuordnen ist, ist gemessen an diesem Maßstab jedenfalls vertretbar.
a.
Die Einspruchsabteilung hat in vertretbarer Weise die XXC als nicht neuheitsschädlich eingeordnet.
aa.
Die XXC ist am 24. April 2011, und damit vor dem 04. April 2016, dem frühesten Prioritätsdatum des Klagepatents, veröffentlicht.
Die XXC bezieht sich auf eine Stimulationsvorrichtung für den lebenden Körper (Anspruch 1 der XXC). Diese Stimulationsvorrichtung kann insbesondere ein Massagegerät sein (Abs. [0038] der XXC). Dieses wirkt auf die Haut (Abs. [0057] der XXC). Durch eine Volumenänderung in einer auf die Haut aufgesetzten Kammer wird ein Drücken und Saugen der Haut durch Unter- bzw. Überdruck bewirkt (Abs. [0045], [0051] der XXC).
Dies wird durch die folgenden Figuren 2, 3, 4a, und 4b der XXC verdeutlicht: -
(Anlage CC 14, S. 20 f. = Bl. 567 f. d. Anlagenbandes Beklagte)
Nach der Offenbarung der XXC wird eine Druckveränderung erzeugt, indem ein Papierkonus 42 in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung bewegt wird. Dargestellt ist dies u.a. in Fig. 3a der XXC im Querschnitt und in Fig. 3b der XXC in Frontalansicht. Dieser Papierkonus 42 ist mit einem Gummiring 43 verbunden, der wiederum den Hohlraum der Kammer an seinem Ende verschließt.
bb.
Die XXC offenbart unstreitig die Merkmale 1.1-1.9 des Anspruchs 1 des Klagepatents. Die Einspruchsabteilung sieht in ihrer Entscheidung die Merkmale 1.10, 1.11 und 1.12 nicht offenbart.
Die Einspruchsabteilung erachtet die Merkmale 1.10 und 1.11 deswegen nicht als offenbart, weil es an der Offenbarung einer flexiblen Membran fehle (Einspruchsentscheidung, S. 44 ff.). Der Papierkonus 42 erstrecke sich zwar im Wesentlichen über den Querschnitt des Hohlraumes. Der Papierkonus 42 bleibe jedoch, wie aus Abbildung 3 der XXC ersichtlich sei, verformungsfrei. Deshalb sei er nicht als flexible Membran anzusehen. Der Gummiring 43 sei flexibel, aber erstrecke sich nicht im Wesentlichen über den Querschnitt des Hohlraumes.
Die Beklagten greifen diese Argumentation im Kern damit an, die Einspruchsabteilung habe nicht erörtert, ob sich nicht aus Gesamtheit von Papierkonus 42 und Gummielement 43 eine sich im Wesentlichen über den Querschnitt des Hohlraumes erstreckende flexible Membran ergebe.
Dies ist nach Ansicht der Kammer nicht geeignet, die Argumentation der Einspruchsabteilung als nicht mehr vertretbar erscheinen zu lassen. Die Ausführungen der Einspruchsabteilung lassen erkennen, dass sie als Erfordernis einer flexiblen Membran die Flexibilität über die gesamte Fläche für erforderlich hält (Einspruchsentscheidung, S. 51). Vor diesem Hintergrund war es folgerichtig, dass die Zusammenfassung von Papierkonus 42 und Gummielement 43 in ihrer Gesamtheit als flexible Membran nicht in Frage kommt, da, wie von der Einspruchsabteilung bereits erörtert, der Papierkonus 42 als nicht flexibel angesehen wurde. Eine solche Auslegung des Merkmals der „flexiblen Membran“ erscheint der Kammer jedenfalls nicht unvertretbar. Vor dem Hintergrund einer solchen Auslegung ist es folgerichtig, dass die Einspruchsabteilung eine Zusammenfassung von Papierkonus und Gummielement nicht ausdrücklich diskutiert hat. Ebenfalls erscheint es letztlich nicht unvertretbar, dass die fachkundig besetzte Einspruchsabteilung die von der XXC offenbarte Lautsprechermembran in Form des Papierkonus als nicht flexibel erachtet hat. Ob die Kammer eine entsprechende Einschätzung teilt, ist vorliegend nicht maßgeblich, da es nicht Aufgabe des Verletzungsgerichtes ist, seine eigenen Erwägungen anstelle derjenigen der fachkundig besetzten Einspruchsabteilung zu setzen. Vielmehr kann nur eine Vertretbarkeitsprüfung stattfinden.
Nicht entscheidend ist, welchen Vortrag die Klägerin in parallelen Verfahren im europäischen Ausland gemacht hat.
Die Einspruchsabteilung erachtet auch das Merkmal 1.12 als nicht durch die XXC offenbart an (Einspruchsentscheidung, S. 43 f.).
Die Abbildung 3 der XXC sei eine schematische Darstellung. Damit offenbare sie keine konkreten Dimensionsverhältnisse, die im Wege einer Ausmessung aus ihr abgeleitet werden könnten.
Die Beklagten greifen diese Argumentation der Einspruchsabteilung damit an, dass sich das Verhältnis der Volumina, bzw. Volumenänderung mühelos ermitteln lasse und die Druckänderung innerhalb der in Merkmal 1.12 offenbarten Bandbreite auch ohne Messungen unmittelbar ersichtlich sei. Entsprechende Messungen waren bereits im Einspruchsverfahren vorgebracht worden (vgl. S. 5 der Einspruchsentscheidung und die dort in Bezug genommenen Unterlagen D39, D40, D41, welche der hiesigen Anlage CC 15 entsprechen, s. Bl. 142 d.A.). Die Beklagten nennen weiter die Entscheidung T 748/91 (Verbundgleitlager), mit welcher sich die Einspruchsabteilung auch auf S. 43 auseinandersetzt. Zudem sei auch ein Bindeglied in der Beschreibung der XXC zu den in der Fig. 3 gezeigten Verhältnissen gegeben. Denn die zu erzielende stimulierende Wirkung hänge selbstverständlich von der entsprechenden Volumenänderung ab (siehe Bl. 143 f. d.A.). Schließlich führe auch die praktische Umsetzung der in der Fig. 3 gezeigten Vorrichtung zwingend zu den beanspruchten Volumenverhältnissen (s. Bl. 144 d.A.).
Auch insoweit ist die Entscheidung der Einspruchsabteilung nach Ansicht der Kammer jedenfalls nicht unvertretbar.
Die Einspruchsabteilung stuft die Fig. 3 der XXC vertretbar als schematische Darstellung ein. Hieran ändert die Achse, auf der die Positionen P1 und P2 eingezeichnet sind, nach Ansicht der Kammer nicht zwingend etwas. Die Achse ist mit keinerlei Skala versehen, die einen Rückschluss auf den Umfang der Auslenkung zulassen würde. Auch die Bauteile sind schematisch dargestellt. Die Fig. 3 wird auch in Abs. [0038] der XXC ausdrücklich als schematische Darstellung bezeichnet. Es erscheint jedenfalls somit vertretbar, der Fig. 3 keine konkreten Abmessungen oder Abmessungsrelationen entnehmen zu können. Dass grundsätzlich die Maße einer Volumenänderung für die Druckverhältnisse und damit auch die Stimulationswirkung bestimmend sein mögen, führt nicht dazu, dass gerade die Maßstäbe der Fig. 3 (oder einer anderen schematischen Figur der XXC) als konkreter Hinweis auf entsprechende Dimensionen verstanden werden können. Auch dem von den Beklagten geltend gemachten Verweis von der Beschreibung auf die Fig. 3 durch Anspruch 1 sowie die Absätze [0009] und [0051] der XXC ist kein konkreter Verweis auf die Maßgeblichkeit der in den Figuren abgedruckten Dimensionen zu entnehmen. Dass der Fachmann bei der Nacharbeitung der Fig. 3 zu entsprechenden Dimensionierungen gelangen würde, erscheint jedenfalls nicht derart zwingend, dass die Auffassung der Einspruchsabteilung vor diesem Hintergrund unvertretbar erscheinen würde. Denn unterstellt man die Prämisse der Einspruchsabteilung, dass die Fig. 3 eine rein schematische Darstellung ohne konkrete Offenbarung zu den beanspruchten Abmessungen ist, so gelangt der Fachmann nicht zwingend zu den Maßen der Fig. 3, die denen der Abbildung entsprechen. Vielmehr entsprächen auch abweichende Dimensionen dem Gehalt, den der Fachmann Fig. 3 entnimmt.
Die Ausführungen der Einspruchsabteilung werden auch nicht dadurch unvertretbar, dass diese an anderer Stelle Figuren der XXD (nach der Darstellung der Klägerin) konkrete Volumenverhältnisse entnehmen mag. Sollte hier eine Widersprüchlichkeit in der Argumentation der Einspruchsabteilung zu sehen sein, worüber es an dieser Stelle keiner Entscheidung bedarf, so bleibt der Standpunkt der Einspruchsabteilung zur XXC doch plausibel. Dies mag nicht unbedingt für die entsprechenden Ausführungen zu den Figuren der XXD gelten, auf die es jedoch nicht entscheidend ankommt (dazu im Folgenden).
b.
Die Einspruchsabteilung hat in vertretbarer Weise die XXD als nicht neuheitsschädlich eingeordnet.
aa.
Die XXD (Anlage CC 8) ist eine Patentschrift des Deutschen Reiches, deren Erfindung im Jahr 1912 patentiert wurde. Die XXD ist damit vor dem 04. April 2016, dem frühesten Prioritätsdatum des Klagepatents, veröffentlicht. Die XXC bezieht sich auf einen Massageapparat mit elastischem Saugnapf.
Ein solcher Massageapparat ist in den Figuren der XXD abgebildet: -
(Anlage CC 8, S. 4 = Bl. 405 d. Anlagenbandes Beklagte)
Durch Eindrücken der Druckstange c, d, kann vor dem Aufsetzen des Massagegerätes die Saugkraft bestimmt werden, die nach dem Lösen der Druckstange c, d nach dem Aufsetzen auf die zu massierende Stelle auf die Haut ausgeübt wird. Denn je nachdem, wie weit die Druckstange eingedrückt wird, wird durch die Rückstellung der Druckstange c, d durch die Feder f eine unterschiedlich große Saugwirkung auf die Haut ausgeübt.
bb.
Die XXD offenbart nach Ansicht der Einspruchsabteilung jedenfalls nicht die Merkmale 1.7 und 1.12 in neuheitsschädlicher Weise (Einspruchsentscheidung S. 22, 46).
Die Beklagten wenden sich gegen die Argumentation der Einspruchsabteilung hinsichtlich Merkmal 1.12, nicht jedoch hinsichtlich Merkmal 1.7.
Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob das zusätzlich von der Einspruchsabteilung in Zweifel gezogene Merkmal 1.12 mit vertretbarer Argumentation von der Einspruchsabteilung verneint worden ist. Zwar ist es nicht ohne weiteres überzeugend, dass die Einspruchsabteilung der nach Auffassung der Kammer ebenfalls schematischen Figur der XXD Volumenverhältnisse entnehmen will. Dennoch kommt es hierauf nicht entscheidend an, da die von der Einspruchsabteilung angenommene mangelnde Offenbarung von Merkmal 1.7 die Entscheidung eigenständig trägt. Zudem dürfte die von den Beklagten angegriffene Passage eher eine Art Hilfserwägung der Einspruchsabteilung darstellen (S. 22: „scheint so zu sein“).
c.
Die Einspruchsabteilung hat die wirksame Inanspruchnahme der Priorität P1 durch das Klagepatent vertretbar angenommen, womit sie zulässigerweise die Vorbenutzung K nicht als Stand der Technik eingeordnet hat.
aa.
Die offenkundige Vorbenutzung K ist ein von der Klägerin zwischen dem ersten Prioritätsdatum P1, dem 04. April 2016, und dem zweiten Prioritätsdatum P2, dem 12. Mai 2016, auf den Markt gebrachtes Produkt. Die Verwirklichung sämtlicher Anspruchsmerkmale der klagepatentgemäßen Lehre durch die offenkundige Vorbenutzung K ist unstreitig.
bb.
Die Einspruchsabteilung hat vertretbar die Inanspruchnahme der Priorität P1 als wirksam erachtet und dementsprechend die Vorbenutzungsform K nicht als maßgeblichen Stand der Technik zugrunde gelegt (Einspruchsentscheidung S. 33, 36 f. mit Verweis auf S. 12 ff.).
Die Beklagten wenden sich dagegen, dass die Einspruchsabteilung eine Offenbarung des Merkmalsbestandteils „einzige durchgehende Kammer“, Merkmal 1.8, durch die P1 angenommen hat. Es werde einzig offenbart, „[…], dass der Hohlraum der Kammer die Form eines durchgehenden Rohres aufweist“ (siehe Anspruch 6 der P1). Dies verlange einen im Wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt. Zudem sei ein Rohr stets länger als breit, für eine Kammer gelte dies nicht unbedingt.
Die von der Einspruchsabteilung vorgebrachte Beurteilung erscheint gegenüber diesen Angriffen der Beklagten jedenfalls vertretbar.
Die Einspruchsabteilung (Einspruchsentscheidung, S. 13 f.) stützt die Offenbarung des Merkmalsbestandteils „einzige durchgehende Kammer“, Merkmal 1.8, auf Anspruch 6 der Prioritätsanmeldung P1 (Anlage CC 17). Hierbei legt die – fachkundig besetzte – Einspruchsabteilung dem Begriff „Rohr“ eine weitere Bedeutung bei als die Beklagten und ordnet auch Kammern mit sich veränderndem Querschnitt als „Rohr“ im Sinne des Anspruchs 6 der Prioritätsanmeldung P1 ein. Eine Kammer, die durchgehend sei, und deren Seitenwandung zwischen beiden Enden frei von Unstetigkeitsstellen sei, müsse somit als „rohrförmig“ betrachtet werden. Dieses technische Verständnis ist nicht unvertretbar.
Ob die Kammer diese Auslegung teilt, ist vorliegend nicht maßgeblich. Es ist Aufgabe des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, eine entsprechende vollumfängliche Prüfung insoweit herbeizuführen. Das Einspruchsbeschwerdeverfahren kann nicht durch das Verletzungsgericht im Rahmen der Prüfung einer Aussetzung vorweggenommen werden. Maßstab einer Aussetzungsentscheidung muss allein sein, ob die von der Einspruchsabteilung vorgenommene Auslegung noch vertretbar erscheint. Dies ist hier der Fall.
2.
Die Einspruchsabteilung hat vertretbar eine Einordung der klagepatentgemäßen Lehre als dem Stand der Technik gegenüber naheliegend abgelehnt.
a.
Die Einspruchsabteilung hat vertretbar ein Naheliegen der klagepatentgemäßen Lehre ausgehend von der XXC abgelehnt.
Die Einspruchsabteilung hat wie zuvor geschildert die Merkmale 1.10, 1.11 und 1.12 als von der XXC als nicht offenbart und im Anschluss hieran (Einspruchsentscheidung S. 49 ff.) auch als nicht naheliegend ausgehend von der XXC angesehen.
Die Beklagten greifen diese Ausführungen der Einspruchsabteilung als unrichtig und nicht vertretbar an. Die Ersetzung des scheibenförmigen Papierkonus und des Gummielements durch eine Silikonmembran sei für den Fachmann naheliegend. Die XXC lehre in Abs. [0125] f. sogar die Verwendung anderer Materialien und Wirkmechanismen. Bei den in Merkmal 1.12 beanspruchten Volumenänderungen handele es sich schlicht um eine willkürliche Festlegung eines Bereichs. Die Grenzen der Volumenänderung, einerseits erste Spürbarkeit, andererseits die Schmerzgrenze, seien selbstverständlich. Die Annahme einer technischen Lehre durch die Einspruchsabteilung, konkret die Passage: „Aus den im Verfahren zitierten Dokumenten als Ganzes geht eindeutig hervor, dass es sich bei erogenen Klitorisstimulatoren um ein kommerziell erfolgreiches Massenprodukt handelt. Ein technischer Effekt kann dem Druckfeld somit nicht abgesprochen werden. Somit kann auch einer unterschiedlichen Ausgestaltung des Druckfeldes kein technischer Effekt abgesprochen würden.“ (S. 50, Rn. 41.4) sei ein Fehlschluss.
Die Auswahl sei auch deshalb willkürlich, weil die Vorrichtung auf der Klitoris positioniert werden müsse und das Volumen damit ohnehin je nach Benutzerin und Positionierung der Öffnung schwanke. Zudem hätten die Beschwerdekammern des EPA zahlreich dahingehend entschieden, dass eine rein willkürliche Auswahl aus einer Vielzahl von technischen Lösungen nicht als erfinderisch zu beurteilen sei.
Die Klägerin wendet gegen diese Angriffe einzig ein, dass die Beklagten hier ihre Auffassung an die Stelle derjenigen der Einspruchsabteilung setzen, ohne neue Argumente vorzubringen.
Maßgeblich ist, wie vorstehend geschildert, ob die Entscheidung der Einspruchsabteilung vertretbar ist. Ist sie dies nicht, so ist mit einer Abänderung zu rechnen und eine Aussetzung gerechtfertigt.
aa.
Die Annahme, die Merkmale 1.10 und 1.11 des Klagepatents seien durch die XXC nicht nahegelegt, stellt sich als vertretbar dar.
Die XXC offenbart ein Massagegerät, welches die Einspruchsabteilung seinem konstruktiven Aufbau nach vorwiegend als Lautsprecher einstuft. Es sei nicht ersichtlich, dass ein Lautsprecher die Druckbereiche, welche die klagepatentgemäße Lehre erfordere, überhaupt erreichen könne. Vielmehr sei zumindest fraglich, ob nicht konstruktive Änderungen bis hin zu einer grundlegenden Neukonstruktion der Druckfelderzeugungseinrichtung vorgenommen werden müssten. Es gäbe auch keinen Grund, den Papierkonus durch eine flexible Membran aus Silikon zu ersetzen, da so die Lautsprecher-Eigenschaft verloren ginge. Vielmehr würde der Fachmann etwa eine Silikonbeschichtung auf dem Papierkonus aufbringen, um die Eigenschaft als Lautsprecher zu erhalten.
Die Beklagten wenden gegen diese Argumentation ein, dass die XXC bereits einen Einsatz unter Wasser sowie die Verwendung von Silikon offenbare. Ebenso sei die Möglichkeit der Musikwiedergabe letztlich kein zentrales Element der XXC. Auch seien von der XXC andere Antriebsarten zur Druckerzeugung offenbart. Weiter wenden die Beklagten ein, die XXC offenbare etwa auch eine Anwendung an den Füßen (Abs. [0104] f. der XXC, konkret allerdings der Fußsohlen). Auch beim Klagepatent sei im Rahmen der Ausführungsbeispiele etwa ein elektromagnetischer Antrieb beschrieben (Abs. [0028]). Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass die von der XXC offenbarte Vorrichtung ebenso zuverlässig in den vom Klagepatent beanspruchten Volumen- und Druckverhältnissen arbeiten könne.
Die Einschätzung der Einspruchsabteilung zur XXC erweist sich auch vor dem Hintergrund der Angriffe der Beklagten nicht als unvertretbar. Zwar ist zutreffend, wie die Beklagten ausführen, dass die XXC andere Formen und Materialien sowie andere Antriebsmechanismen, auch explizit Kurbelkolbenkonstruktionen, als Lautsprecher offenbart (Abs. [0125] f. der XXC). Auch wird ein Einsatz in einem anderen Fluid als Luft, etwa Wasser beim Einsatz in der Badewanne, genannt (Abs. [0129] der XXC). Welchen Anlass der Fachmann aber konkret haben sollte, den Papierkonus bei Beibehaltung der sonstigen konstruktiven Elemente durch eine Silikonmembran zu ersetzen, kann die Kammer nicht feststellen. Die XXC offenbart auch an keiner Stelle konkrete Druckverhältnisse. Die Kammer sieht sich deswegen nicht in der Lage, die Ansicht der Einspruchsabteilung, dass in der XXC keine Vorrichtung mit einer Antriebseinrichtung offenbart oder auch nur nahegelegt ist, mit der ein Betrieb in den von der klagepatentgemäßen Lehre konkret vorgesehenen Druckverhältnissen stattfinden kann, als unvertretbar oder offenbar unrichtig anzusehen.
bb.
Die Kammer kann ebenso nicht feststellen, dass die Annahme der Einspruchsabteilung, dem Merkmal 1.12 liege ein technischer Zweck zugrunde, im Ergebnis unvertretbar ist.
Die Einspruchsabteilung hat ausgeführt, jeder unterschiedlichen (beliebigen) Ausgestaltung eines Druckfelds könne ein technischer Effekt nicht abgesprochen werden.
Es ist, wie die Beklagten ausführen, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass eine willkürliche Auswahl ohne erkennbaren technischen Effekt eine erfinderische Tätigkeit nicht begründen kann (EPA, T 939/92, GRUR Int. 1996 1049 – Triazole/AGREVO; bestätigend BeckRS 2011, 146803 Rz. 41; BeckRS 2017, 138570 Rz. 25 f; GRUR-RS 2020, 40374 Rz. 72; GRUR-RS 2021, 2717 Rz. 37). Die Annahme der Einspruchsabteilung, dass jeder Ausgestaltung des Druckfeldes ein technischer Effekt zugrunde läge, allein deshalb, weil dem Druckfeld selbst ein technischer Effekt zugrunde liegt, dürfte im Widerspruch zu vorstehend zitierter Rechtsprechung stehen.
Allerdings kann die Kammer nicht feststellen, dass die Annahme eines technischen Effektes durch die Einspruchsabteilung sich im Ergebnis als unvertretbar darstellt. Selbst wenn die von den Beklagten angegriffene konkrete Passage Zweifeln begegnet und möglicherweise im Beschwerdeverfahren abweichend begründet werden wird, so bietet das Klagepatent doch gewisse Ausführungen zur Auswahl der beanspruchten Druckverhältnisse. So führt das Klagepatent (Abs. [0006] f.) aus, die Auswahl der Volumenverhältnisse berücksichtige einerseits, dass die Saugwirkung nicht zu gering werden dürfe, und andererseits, dass kein zu starker Unterdruck entstehen und der Leistungsbedarf der Antriebseinrichtung nicht zu groß sein dürfe. Weiter wird in Abs. [0017] ausgeführt, dass Überdrucke unter normalen Anwendungsbedingungen weitgehend entweichen können. Vor diesem Hintergrund stellt sich für die Kammer die Annahme eines technischen Effektes durch das Merkmal 1.12 im Ergebnis als jedenfalls nicht unvertretbar dar. Soweit die Beklagten auf die im Klagepatent als vorbekannter Stand der Technik zitierte XXE oder die Produkte „L“ und „M“ verweisen, welche ähnliche Volumenverhältnisse zeigen würden, so ist zu beachten, dass diese abweichende Konstruktionsmechanismen für den Hohlraum vorsehen (vgl. XXE nebst Figuren sowie etwa S. 39 Rn. 31 ff. für „L“ und „M“). Der Einwand der Beklagten, dass die Saugwirkung einerseits nicht zu gering sein solle und andererseits keine Schmerzen hervorrufe, sei eine platte Selbstverständlichkeit, berücksichtigt zudem nicht den Leistungsbedarf der Antriebseinrichtung. Vor diesem Hintergrund ist nach Ansicht der Kammer im Ergebnis die Annahme eines technischen Effekts durch das Merkmal 1.12 jedenfalls nicht unvertretbar.
b.
Die Betrachtung der XXC in Verbindung mit der XXE ändert an vorstehender Beurteilung nichts.
aa.
Die XXE entspricht inhaltlich der XXF. Die XXE ist eine deutsche Offenlegungsschrift, die am 26. März 2015, und damit vor dem 4. April 2016 als frühestem Prioritätstag des Klagepatents offengelegt wurde. Die XXE wird, wie bereits geschildert, vom Klagepatent als vorbekannter Stand der Technik erörtert.
bb.
Die XXE betrifft eine Stimulationsvorrichtung für erogene Zonen, insbesondere für die Klitoris.
Dabei lehrt die XXE, anders als die Klagepatentschrift, einen Aufbau und eine Druckerzeugung über zwei Kammern, siehe die nachfolgende Abbildung sowie Anspruch 1. -
(Duplik vom 28. März 2024, S. 86 = Bl. 303, Gegenüberstellung und Kolorierung durch die Beklagten)
Die Einspruchsabteilung erachtet die XXE als nächstliegenden Stand der Technik in Kombination mit der XXC nicht als einer erfinderischen Tätigkeit entgegenstehend. Vor dem Hintergrund, dass die Einspruchsabteilung – nach Ansicht der Kammer vertretbar – die Düsenwirkung und einen Zwei-Kammer-Aufbau der XXE als wesentlich erachtet, erscheint die Auffassung der Einspruchsabteilung vertretbar.
c.
Die XXE steht auch für sich genommen einer erfinderischen Tätigkeit der klagepatentgemäßen Lehre nicht entgegen.
Die Einspruchsabteilung erörtert die XXE nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der XXC (Einspruchsentscheidung, S. 51 f.). Die XXE offenbart, wie die Einspruchsabteilung schildert, Merkmal 1.9 nicht. Weiter erläutert die Einspruchsabteilung, dass die XXE auch keinen Anlass liefere, eine Verbesserung der Hygiene vorzunehmen. Diese Ausführungen sind vertretbar. Der Angriff der Beklagten auf das ebenfalls nicht gezeigte und nicht naheliegende Merkmal 1.12 entspricht dem oben bereits zur XXC Ausgeführten.
d.
Auch die von den Beklagten vorgelegten weiteren Druckschriften D17 und D19 gebieten keine andere Betrachtung. Die Dokumente waren bereits Gegenstand des Einspruchsverfahrens (S. 3, Anlage CC 1). Die Beklagten führen diese heran, um Merkmal 1.12 als offenbart, jedenfalls naheliegend und als Teil des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns zu belegen. Vor dem Hintergrund, dass die Einspruchsabteilung jedenfalls vertretbar ein Naheliegen hinsichtlich der Merkmale 1.10, 1.11 und 1.12 verneint hat, können diese Druckschriften selbst dann, wenn man ihnen eine Offenbarung des Merkmals 1.12 entnehmen sollte, die Entscheidung der Einspruchsabteilung insgesamt nicht unvertretbar machen, da es insoweit an einem Naheliegen der Merkmale 1.10 und 1.11 weiter fehlt.
VI.
1.
Die mündliche Verhandlung war nicht wiederzueröffnen, § 156 Abs. 1 ZPO. Insbesondere die Ausführungen der Klägerin im Schriftsatz vom 04. Juli 2024 bieten dazu keinen Anlass. Da Merkmal 1.9 keine konkreten strömungsmechanischen Vorgaben macht, kommt es auf die vorgelegten Untersuchungsergebnisse ebenso wenig entscheidend an wie auf die entsprechenden Berechnungen der Klägerseite. Gleiches gilt für die von der Klägerin nunmehr vorgetragenen Unterschiede zwischen thermodynamischen Druckänderungen (d.h. Änderung der Fluiddichte) in der Kammer und dynamischen Druckänderungen (d.h. Druckänderungen durch Wandlung von kinetischer Energie bzw. Geschwindigkeit in Druck). Auch der Vortrag zur näheren Beschaffenheit von Lautsprechern bietet keinen Anlass zur Wiedereröffnung. Maßgeblich ist insoweit lediglich, ob der Offenbarungsgehalt, den die Einspruchsabteilung der XXC entnimmt, vertretbar ist.
2.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO, diejenige über die Kosten aus § 91 ZPO.
Der Antrag der Beklagten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden, konnte bereits mangels Vortrag zu den Voraussetzungen und entsprechender Glaubhaftmachung keinen Erfolg haben, §§ 712, 714 ZPO.
Der Streitwert wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt, § 51 Abs. 1 GKG.