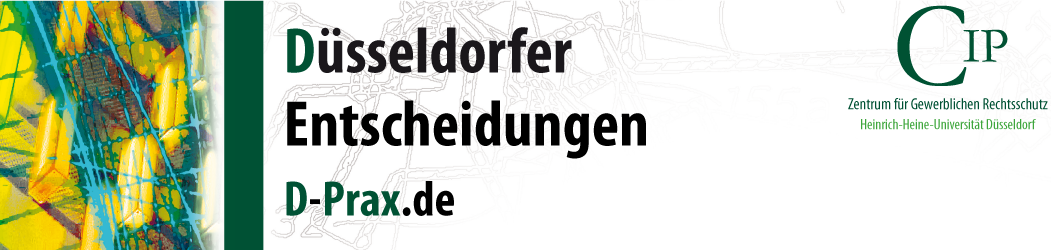Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3398
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 9. Juli 2024, Az. 4c O 12/23
- I. Die Beklagten werden verurteilt,
- 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft im Hinblick auf die Beklagte zu 1) am gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu 1) zu vollziehen ist, zu unterlassen,
-
eine langgestreckte Verhülsung zum Abgeben von Beuteln, welche geeignet ist für eine Kassette zur Verwendung mit einer Einrichtung, die Einrichtung umfassend:
einen Behälter, der ein Oberteil und ein Unterteil aufweist, wobei das Oberteil eine Öffnung zum Aufnehmen von Einwegartikeln durch diese hindurch definiert; eine Halterung zum Halten der Kassette, wobei sich die Halterung innerhalb des Oberteils nächstliegend zur Öffnung befindet; und einen Schließmechanismus, der sich unter der Halterung befindet und einen fixen Abschnitt umfasst, der ein oberes Ende beinhaltet, das sich nach oben in die Öffnung des Behälters erstreckt;
wobei die Kassette Folgendes umfasst:
eine ringförmige Aufnahme, die eine Länge einer langgestreckten Verhülsung in einem akkumulierten Zustand aufnimmt, eine ringförmige Öffnung an einem oberen Ende der ringförmigen Aufnahme zum Abgeben der verlängerten Verhülsung, wobei die ringförmige Aufnahme eine zentrale Öffnung definiert, durch welche ein verknotetes Ende der langgestreckten Verhülsung hindurchgeführt wird, um einen Beutel zu bilden, der durch die ringförmige Aufnahme gestützt ist, wobei die Einwegartikel durch die zentrale Öffnung durchgeführt werden, um in dem Beutel aufgenommen zu werden und die Kassette gekennzeichnet ist durch einen abgefasten Freiraum an der Unterseite der zentralen Öffnung, wobei der abgefaste Freiraum angeordnet ist, um zu ermöglichen, dass sich das obere Ende des Schließmechanismus nach oben in die Öffnung des Behälters und in die zentrale Öffnung der Kassette erstreckt, wenn die Kassette in der Halterung derart positioniert wird, um sicherzustellen, dass die Kassette ordnungsgemäß orientiert ist, wenn diese in der Halterung installiert ist, wenn die Einrichtung in Betrieb ist, - Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,
- ohne ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass die langgestreckte Verhülsung nicht ohne Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des EP 2 818 XXA B1 mit Kassetten verwendet werden darf, die mit den vorstehend bezeichneten Merkmalen ausgestattet sind
- und insbesondere mit Kassetten, die in den Eimern „B“, „C“, „D“, „E“, „F“ und G“, „H“, „I“ und „J“ zum Einsatz kommen;
-
2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziff. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 06. Mai 2020 begangen haben, und zwar unter Angabe:
a. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
b. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
c. der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellen Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, - wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
-
3. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziff. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 06. Juni 2020 begangen haben und zwar unter Angabe:
a. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
b. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
c. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
d. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, - wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten sind.
- 4. an die Klägerin den Betrag von EUR 8.008,40 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 14. Dezember 2022 zu zahlen.
- II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die zu Ziff. I.1. bezeichneten in der Zeit seit dem 06. Juni 2020 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- IV. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten.
- V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich Ziff. I.1 gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 130.000 Euro, hinsichtlich Ziff. I.2. und 3. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 30.000 Euro und der Ziff. I.4 und III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Der Klägerin wird gestattet, die jeweilige Sicherheitsleistung in Form einer Bank- oder Sparkassenbürgschaft zu erbringen.
- Tatbestand
- Die Klägerin verfolgt aus Patentrecht gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Erstattung von Abmahnkosten sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung.
- Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 2 818 XXA B1 (Anlage K7; im Folgenden: Klagepatent). Es wurde am 05. Oktober 2007 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Der Hinweis auf die Anmeldung wurde am 21. Dezember 2014 offengelegt und der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 06. Mai 2020. Das Klagepatent steht auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das Klagepatent hat ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) unverändert überstanden (vgl. Anlage B 4). Das Klagepatent betrifft eine Kassette zur Abgabe von Beuteln aus einem Folienschlauch.
- Anspruch 1 des Klagepatents lautet in englischer Verfahrenssprache:
- „A cassette (30) for dispensing bags from an elongated tubing (32) and for use with an apparatus (10) comprising: a bin (12) having a top portion (14) and a bottom portion, the top portion (14) defining an opening (22) for receiving disposable objects therethrough; a holder (26) for holding the cassette (30), the holder (26) being located within the top portion (14) proximate the opening (22); and a closing mechanism (50) located below the holder (26) and comprising a fixed portion (52’) including an upper end (54’) extending upwardly in the opening (22) of the bin (12); the cassette (30) comprising: an annular receptacle (38) accommodating a length of the elongated tubing (32) in an accumulated condition, an annular opening at an upper end of the annular receptacle (38) for dispensing the elongated tubing (32), the annular receptacle (38) defining a central opening (34) through which a knotted end (40) of the elongated tubing (32) passes to form a bag supported by the annular eceptacle (38) with the disposable objects passing through the central opening (34) to be received in the bag, and the cassette (30) being characterized by a chamfer clearance (41) at the bottom of the central opening (34), the chamfer clearance (41) arranged to allow the upper end (54’) of the closing mechanism (50) to extend upwardly in the opening (22) of the bin (12) and into the central opening (34) of the cassette (30) when the cassette (30) is positioned in the holder (26) so as to ensure that the cassette (30) is properly oriented when installed in the holder (26) when the apparatus (10) is in use.“
- Die Übersetzung des Anspruchs 1 hat nachfolgenden Wortlaut:
- „Kassette (30) zum Abgeben von Beuteln aus einer langgestreckten Verhülsung (32) und zur Verwendung mit einer Einrichtung (10), umfassend: einen Behälter (12), der ein Oberteil (14) und ein Unterteil aufweist, wobei das Oberteil (14) eine Öffnung (22) zum Aufnehmen von Einwegartikeln durch diese hindurch definiert; eine Halterung (26) zum Halten der Kassette (30), wobei sich die Halterung innerhalb des Oberteils (14) nächstliegend zur Öffnung (22) befindet; und einen Schließmechanismus (50), der sich unter der Halterung (26) befindet und einen fixen Abschnitt (52’) umfasst, der ein oberes Ende (54’) beinhaltet, das sich nach oben in die Öffnung (22) des Behälters (12) erstreckt; wobei die Kassette (30) Folgendes umfasst: eine ringförmige Aufnahme (38), die eine Länge einer langgestreckten Verhülsung (32) in einem akkumulierten Zustand aufnimmt, eine ringförmige Öffnung an einem oberen Ende der ringförmigen Aufnahme (38) zum Abgeben der verlängerten Verhülsung (32), wobei die ringförmige Aufnahme (38) eine zentrale Öffnung (34) definiert, durch welche ein verknotetes Ende (40) der langgestreckten Verhülsung (32) hindurchgeführt wird, um einen Beutel zu bilden, der durch die ringförmige Aufnahme (38) gestützt ist, wobei die Einwegartikel durch die zentrale Öffnung (34) durchgeführt werden, um in dem Beutel aufgenommen zu werden und die Kassette (30) gekennzeichnet ist durch einen abgefasten Freiraum (41) an der Unterseite der zentralen Öffnung (34), wobei der abgefaste Freiraum (41) angeordnet ist, um zu ermöglichen, dass sich das obere Ende (54’) des Schließmechanismus (50) nach oben in die Öffnung (22) des Behälters (12) und in die zentrale Öffnung (34) der Kassette (30) erstreckt, wenn die Kassette (30) in der Halterung (26) derart positioniert wird, um sicherzustellen, dass die Kassette (30) ordnungsgemäß orientiert ist, wenn diese in der Halterung (26) installiert ist, wenn die Einrichtung (10) in Betrieb ist.“
- Folgende Figuren sind der Klagepatentschrift entnommen und veranschaulichen die erfindungsgemäße Lehre anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele:
- Das Unternehmen der Klägerin ist in Barbados ansässig und gehört zur internationalen K-Firmengruppe. Über die Unternehmen L GmbH & Co. KG und M GmbH & Co. KG, beide in N ansässig, vertreibt sie ihre Produkte, insbesondere Windeleimer und Katzenstreueimer unter den Bezeichnungen K bzw. O.
- Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um ein in Polen ansässiges Unternehmen, das auf den Vertrieb von Nachfüllfolie für Windeleimer (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform), insbesondere unter der Bezeichnung „P“ bzw. „Q“ spezialisiert ist. Geschäftsführer der Beklagten zu 1) war die Beklagte zu 2). Sie wurde am 17. Juni 2021 als Geschäftsführerin im Handelsregister gelöscht und ist seitdem Prokuristin der Beklagten zu 1) mit Einzelprokura. Die Produkte der Beklagten werden insbesondere über die Internet-Plattform www.R.de beworben und angeboten (Anlage K 3). Die angegriffene Ausführungsform wird einzeln als Folienschlauch sowie auch als Kombination aus Folienschlauch, Papphülse sowie einer Anleitung, wie der Folienschlauch mithilfe der Papphülse in aufgebrauchte Kassetten eingefüllt werden kann, angeboten. Die angegriffene Ausführungsform ist in den Längen 200m und 400m erhältlich. Zu ihrer Benutzung muss die angegriffene Ausführungsform in eine Kassette eingesetzt werden.
- Zur Veranschaulichung der angegriffenen Ausführungsform werden nachfolgend entsprechende Ablichtungen, wie sie die Klägerin mit der Klageschrift eingereicht hat, eingeblendet:
- Mit anwaltlichem Schreiben vom 29. November 2022 mahnte die Klägerin die Beklagten bezüglich der Angebotshandlungen unter dem Gesichtspunkt einer mittelbaren Patentverletzung ab (Anlage K 4). Die Beklagten gaben in der Folgezeit aber keine Unterlassungserklärung ab.
- Die Klägerin hat das Klagepatent vor der Kammer gegen andere Anbieter von Folienschläuchen inkl. Nachfüllkassetten durchgesetzt (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 16. März 2023, I-2 U 17/21, Anlage B 3).
- Die Klägerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäßen mittelbaren Gebrauch von der Lehre des Klagepatents machen würden. Für das Vorliegen einer mittelbaren Patentverletzung könne auf die bereits ergangenen Gerichtsentscheidungen Bezug genommen werden. Danach handele es sich bei der Nachfüllfolie um ein wesentliches Element der Erfindung.
- Die angegriffene Ausführungsform sei nicht erschöpft, wenn sie mit unberechtigt in den Verkehr gebrachten Kassetten verwendet werde. Die Anleitung der Beklagten sei generisch formuliert und gelte für alle Nachfüllkassetten, solange sie auf die Windeleimer der Klägerin passen würden; so bewerbe die Beklagte zu 1) die angegriffene Ausführungsform auch. Aber auch hinsichtlich der von der Klägerin vertriebenen Originalkassetten liege keine erschöpfte Ware vor. Bei dem Verbrauch der Folie handele es sich nicht um einen herkömmlichen Verschleiß, vielmehr würden die Originalkassetten wertlos, nachdem die Folie aufgebraucht sei. Die Kassetten seien ein Wegwerfartikel, deren Lebensdauer mit dem Aufbrauchen der Folie beendet sei.
- Die Beklagte zu 2) sei auch für Patentverletzungen verantwortlich, da diese bereits im Oktober 2017 begonnen hätten, also zu einer Zeit als die Beklagte zu 2) Geschäftsführerin der Beklagten zu 1) gewesen sei. Zudem sei die Beklagte zu 2) nach ihrer Abberufung als Geschäftsführerin als Prokuristin mit Einzelprokura bei der Beklagten zu 1) beschäftigt. Die Verantwortlichkeit ergebe sich zudem aus der nur geringen Unternehmensgröße sowie daraus, dass sie auf die Abmahnung von ihrer privaten E-Mail-Adresse geantwortet habe, und zwar auch im Namen der Beklagten zu 1).
- Für die streitgegenständlichen Annexansprüche lägen jedenfalls unmittelbare Patentverletzungen im privaten Bereich vor. Sobald für K oder O kompatible Folie geliefert würde, sei ohnehin zwangsläufig mit einer unmittelbaren Benutzung zu rechnen.
- Die angesetzten Abmahngebühren seien der Höhe nach nicht zu beanstanden; eine über 2,0 liegende Gebühr sei angemessen, da es sich um einen komplexen patentrechtlichen Fall handele. Die Hinzuziehung von patentrechtlichem Rat sei insbesondere hinsichtlich des parallelen Einspruchsverfahrens erforderlich gewesen.
-
Die Klägerin beantragt,
zu erkennen, wie geschehen, im Hinblick auf die geltend gemachten Abmahnkosten, beantragt sie, an die Klägerin den Betrag von EUR 8.896,00 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.11.2022 zu zahlen.
- Die Beklagten beantragen,
- die Klage abzuweisen.
-
Sie meinen, dass die Rechte der Klägerin, um gegen die angegriffene Ausführungsform vorzugehen, erschöpft seien. Die angegriffene Ausführungsform solle gerade in von der Klägerin bereits in den Verkehr gebrachte Kassetten eingesetzt werden, also in Kassetten, die aus berechtigter Quelle stammen würden. Daher liege keine Neuherstellung einer Kassette vor, sondern ein bloßes unter den Erschöpfungseinwand fallendes Wiederbefüllen. In der Ausgestaltung der Kassette und deren Zusammenwirken mit dem Behälter liege gerade die Neuheit der erfindungsgemäßen Lehre, hingegen nicht in der Folie. Diese sei ein herkömmliches Austauschteil, der selbst keinen spezifischen Ausgestaltungsmerkmalen unterliege.
Sofern die angegriffene Ausführungsform auch in solchen Kassetten zum Einsatz komme, welche keinen abgefasten Freiraum aufweisen würden, könne die Klägerin dies bereits deshalb nicht untersagen, da es an einer Patentbenutzung fehle. Die Beklagte zu 1) würde auf ihrem Internetauftritt nicht zu einem Einsatz der angegriffenen Ausführungsform in passenden, aber nicht autorisierten Systemen anleiten. Sofern eine Kompatibilität mit anderen System als demjenigen der Klägerin herausgestellt würde, handele es sich um nicht unter den Patentschutz fallende Kassetten. Ein solcher Einsatz der angegriffenen Ausführungsform ergebe sich auch nicht aus den Kundenkommentaren unterhalb des Angebots. Aus Sicht des beteiligten Verkehrskreises würde die Originalkassette nach dem Verbrauch der Folie gerade nicht wertlos, weil durch deren Wiederverwendung der Plastikverbrauch erheblich reduziert würde. Daher setze das Angebot der Beklagten das Vorhandensein einer (leeren) Kassette gerade voraus. - Eine unmittelbare Patentverletzung sei im Inland nicht festzustellen. Es sei insbesondere nicht nachzuvollziehen, ob die Käufer die angegriffene Ausführungsform in patentfreien oder patentgeschützten Systemen einsetzen würden.
- Die Beklagte zu 2) sei zudem nicht passivlegitimiert, da sie seit dem 17. Juni 2021 nicht mehr die Geschäftsführerin der Beklagten zu 1) sei. Seit dieser Zeit sei sie nur noch in der Buchhaltung der Beklagten zu 1) tätig. Eine Verantwortlichkeit für von der Beklagten zu 1) vertriebene Produkte treffe sie nicht.
- Die Annexansprüche bestünden nicht, da es insbesondere für einen Auskunftsanspruch an einer unmittelbaren Patentverletzung fehle. Die vorgerichtlichen Anwaltskosten seien der Höhe nach mit einer 2,0-fachen Gebühr übersetzt. Durch die Vielzahl gleichgelagerter Fälle habe der hiesige Sachverhalt keine besondere Komplexität für die Klägerin aufgewiesen.
- Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlage Bezug genommen.
- Entscheidungsgründe
-
A.
Die zulässige Klage ist im Wesentlichen begründet. -
I.
Das Klagepatent betrifft eine Kassette zum Abgeben von Beuteln aus einer langgestreckten Verhülsung und zur Verwendung mit einer Einrichtung zur Verpackung von Einwegmaterial in einen Schlauch aus flexibler Kunststofffolie (vgl. Abs. [0001]). Durch eine solche Verpackung von Abfällen, wie z.B. Wegwerfwindeln, soll eine hygienische Lagerung des Abfalls ermöglicht werden, die zudem weitgehend geruchlos bis zur Entsorgung ist. - Aus dem Stand der Technik sind, wie das Klagepatent in Abs. [0002] erläutert, schon ähnliche Vorrichtungen bekannt, die einen Behälter mit einem offenen/zu öffnenden Oberteil, in das der zu entsorgende Abfall eingelegt wird, und einem Unterteil, in dem der Abfall gelagert wird, aufweisen. Das Oberteil sah zudem eine ringförmige Kassette mit einem Schlauch aus zusammengefalteter flexibler Kunststofffolie vor, der an einem Ende verknotet ist und in welchen das Abfallprodukt eingeführt und temporär aufbewahrt werden kann. Die vorbekannten Vorrichtungen sahen ferner einen Schließmechanismus vor, um den Schlauch, in welchen der Abfall eingebracht wurde und der sodann durch die Öffnung der Kassette in Richtung des Unterteils des Behälters geschoben wurde, unterhalb der Kassette zu verschließen und zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus dem Schlauch austreten (Abs. [0003]).
- Das Klagepatent führt in Abs. [0004] das kanadische Patent Nr. 1,298,191 insoweit an, um einen vorbekannten Verschließmechanismus zu beschreiben; dort war er als drehbarer Kern ausgestaltet. Mithilfe einer Kappe über einen Zylinder konnte eine Drehbewegung ausgeführt werden, um den Schlauch in regelmäßigen Abständen in fortlaufende Beutel zu formen, die während der Aufbewahrung versiegelt bleiben. Als weitere vorbekannte Vorrichtungen würdigt das Klagepatent in den Abs. [0005] und [0006] die kanadischen Druckschriften Nr. 2,383,799 und 2,441,837. Auch diese wiesen eine Kassette mit einem Schlauch auf und eine Quetschvorrichtung innerhalb des Behälters, welche den zu entsorgenden Artikel enthaltenden Schlauch zusammendrückt und in das Unterteil des Behälters zu befördern und dort zu verwahren.
- Hieran kritisiert das Klagepatent in Abs. [0007] als nachteilig, dass die vorbekannten Vorrichtungen aus vielen Teilen bestehen und anfällig für Bruchschäden sind. Sie sind nicht benutzerfreundlich und in der Erstbenutzung schwer verständlich. Hinzukamen hohe Herstellungskosten sowie hohe Nutzungskosten, weil übermäßig viel Folie aus den Kassetten gezogen wurde. Weiterhin als nachteilig beschreibt das Klagepatent, dass die Kassetten nicht immer richtig ausgerichtet waren und zudem die Kassettenwände verschmutzt wurden.
- Das Klagepatent stellt sich daher die Aufgabe, eine Kassette zum Abgeben von Beuteln aus einer langgestreckten Verhülsung bereitzustellen (Abs. [0009]). Insbesondere sollte die Kassette einen abgefasten Freiraum an der Unterseite der zentralen Öffnung der ringförmigen Aufnahme, die eine Länge einer langgestreckten Verhülsung aufnimmt, haben (Abs. [0010]).
- Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent deshalb eine Vorrichtung mit den nachfolgenden Merkmalen vor:
-
1. Kassette (30)
2. zur Verwendung mit einer Einrichtung (10), umfassend:
2.1 einen Behälter (12), der ein Oberteil (14) und ein Unterteil aufweist, wobei das Oberteil (14) eine Öffnung (22) zum Aufnehmen von Einwegartikeln durch diese hindurch definiert;
2.2 eine Halterung (26) zum Halten der Kassette (30), wobei sich die Halterung innerhalb des Oberteils (14) nächstliegend zur Öffnung (22) befindet; und
2.3 einen Schließmechanismus (50), der sich unter der Halterung (26) befindet und einen fixen Abschnitt (52’) umfasst, der ein oberes Ende (54’) beinhaltet, das sich nach oben in die Öffnung (22) des Behälters (12) erstreckt;
3. zum Abgeben von Beuteln aus einer langgestreckten Verhülsung (32) umfassend
3.1 eine ringförmige Aufnahme
3.1.1 die eine Länge einer langgestreckten Verhülsung (32) in einem akkumulierten Zustand aufnimmt,
3.1.2 die an einem oberen Ende zum Abgeben der verlängerten Verhülsung (32) eine ringförmige Öffnung (38) aufweist
3.1.3 die eine zentrale Öffnung (34) definiert
3.1.3.1 durch welche ein verknotetes Ende (40) der langgestreckten Verhülsung (32) hindurchgeführt wird, um einen Beutel zu bilden, der durch die ringförmige Aufnahme (38) gestützt ist,
3.1.3.2 wobei die Einwegartikel durch die zentrale Öffnung (34) durchgeführt werden, um in dem Beutel aufgenommen zu werden
3.2 einen abgefasten Freiraum (41) an der Unterseite der zentralen Öffnung (34),
3.2.1 wobei der abgefaste Freiraum (41) angeordnet ist, um zu ermöglichen, dass sich das obere Ende (54’) des Schließmechanismus (50) nach oben in die Öffnung (22) des Behälters (12) und
3.2.2 in die zentrale Öffnung (34) der Kassette (30) erstreckt,
3.2.3 wenn die Kassette (30) in der Halterung (26) derart positioniert wird, um sicherzustellen, dass die Kassette (30) ordnungsgemäß orientiert ist, wenn diese in der Halterung (26) installiert ist, wenn die Einrichtung (10) in Betrieb ist. -
II.
Die Parteien streiten zu recht nicht über das Verständnis des Klagepatents, sondern nur über die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung sowie den Erschöpfungseinwand. -
1.
Die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung gem. § 10 PatG sind erfüllt.
Danach ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. -
a.
Die angegriffene Nachfüllfolie ist ein Mittel im vorbeschriebenen Sinne, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. - „Die Bedeutung der angegriffenen Ausführungsform (Nachfüllfolie) für die erfindungsgemäße Lehre ergibt sich bereits durch die mehrfache Nennung der erfindungsgemäß aus der Folie herzustellenden Beutel im Anspruch, wodurch deutlich wird, dass sie mit der beanspruchten Kassette technisch-funktional zusammenwirken soll. Aufgrund dieses Funktionszusammenhangs handelt es sich auch nicht um eine beliebige Folie, sondern gerade um eine langgestreckte Verhülsung entsprechend der erfindungsgemäßen Lehre. Insoweit schließt sich die Kammer im Übrigen nach eigener Überprüfung den inhaltlichen Ausführungen des OLG Düsseldorf (Urt. v. 16. März 2023, I-2 U 17/21, Anlage B 3) in einem vergleichbaren Sachverhalt an.
- Hiergegen vermögen die Beklagten nicht erfolgreich anzuführen, dass es sich um herkömmliche Folie handele und der wesentliche Erfindungsgedanke in der Gestalt der Kassette zum Ausdruck komme. Denn, um als Mittel für ein wesentliches Element der Erfindung angesehen zu werden, genügt das technisch-funktionale Zusammenwirken. Ein eigener Erfindungsgedanke muss in dem Mittel nicht zum Ausdruck kommen, umso weniger ist dies erforderlich, wenn die angegriffene Ausführungsform wie vorliegend, ausdrücklich Eingang in den Anspruch gefunden hat.
- Ebenso wenig ist erforderlich, dass eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents festzustellen ist, weil es im Rahmen des § 10 PatG ausreichend ist, wenn es jedenfalls zur unmittelbaren Verletzung kommen kann. Denn die Mittel müssen grundsätzlich nur objektiv geeignet sein, im Rahmen einer unmittelbaren Patentverletzung zum Einsatz zu kommen. Beim Gebrauch der mittelbar verletzenden Vorrichtung muss es zur Herstellung des geschützten Gegenstandes kommen können, wobei dies nicht restlos vorhersehbar sein muss, sondern auch nur lediglich vereinzelt der Fall sein kann. Grundsätzlich muss sich bei der Bereitstellung nur eines Teils einer geschützten Kombination, bei der Zusammenfügung mit dem Rest eine Patentverletzung an der Gesamtkombination ergeben (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. A, Rn. 613).
- Vorliegend ist die Kammer davon überzeugt, dass es im Inland zu unmittelbaren Patentverletzungen kommt bzw. jedenfalls kommen kann. Die angegriffene Ausführungsform dient dazu, in eine vorhandene Kassette eingesetzt zu werden, welche ihrerseits auf einen – zu konstruierenden – Behälter gesetzt werden kann. Die Internetangebote der Beklagten lassen nicht erkennen, dass die angegriffene Ausführungsform ausschließlich zur Auffüllung von Originalkassetten, welche von der Klägerin in den Verkehr gebracht wurden, benutzt werden sollen. Die überreichten Screenshots von Angeboten der Beklagten enthalten Hinweise wie „Kompatibel mit K“, „100 % Kompatibel“, „es wird keine leere Kassette mitgeliefert“ (vgl. Anlage K 3, S. 1) oder auch „Kompatibel mit K für Nachfüllkassetten“ (Anlage K 3, S. 7). Diesen Angaben ist aber gerade nicht objektiv zu entnehmen, dass allenfalls originale Kassetten der Klägerin wiederbefüllt werden dürften. Durch die Hinweise auf die Kompatibilität erhält der Abnehmerkreis eine Information auf passende Behältersysteme, in denen die angegriffene Folie in den entsprechenden Kassetten eingesetzt werden kann. Es macht dabei keinen Unterschied, ob es sich um originale Kassetten handelt. Denn, wenn eine Nachahmerkassette für das ausgewiesene Behältersystem passend ist, passt auch die Nachfüllfolie in die Nachahmerkassette. Gerade die Herausstellung, dass keine Kassette mitgeliefert wird, macht umso deutlicher, dass die Nachfüllfolie für ihre Benutzung auf das Vorhandensein einer Kassette angewiesen ist, wobei es technisch keinen Unterschied macht, ob es eine originale Kassette ist. Demnach unterscheidet auch die Handhabungsanweisung der Beklagten nicht zwischen verschiedenen Kassettenmodellen und kann nicht von einer unmittelbaren Patentverletzung wegleiten. Denn die bebilderte Anleitung zeigt überhaupt nur Kassetten mit abgefaster Unterseite, ohne zwischen autorisierten und nicht autorisierten Produkten zu unterscheiden.
-
b.
Der erforderliche doppelte Inlandsbezug ist gegeben. Die Beklagten bieten an und liefern die angegriffene Nachfüllfolie unstreitig auch in der/die Bundesrepublik Deutschland. -
c.
Auch die subjektiven Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung sind erfüllt.
Die mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt neben der objektiven Eignung des Mittels als subjektives Tatbestandsmerkmal voraus, dass das Mittel durch den Dritten dazu bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und dass der Lieferant weiß oder auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass dieses Mittel dazu geeignet und auch dazu bestimmt ist, für die patentierte Erfindung benutzt zu werden. Es wird demnach ein positives Wissen von der Eignung und Bestimmung des Mittels seitens des Lieferanten verlangt, wobei aber eine Beweiserleichterung in der Weise vorgesehen ist, dass dieses schwer zu beweisende Wissen durch den Nachweis der auf Grund der Umstände offensichtlichen Eignung und Bestimmung der Mittel ersetzt werden kann. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt damit einen Handlungswillen des Belieferten voraus. Der Abnehmer muss die Benutzung des Gegenstands wollen, d.h. er muss die ihm gelieferte Vorrichtung so zusammenfügen und herrichten wollen, dass sie patentverletzend verwendet werden kann. Über die Bestimmung zur patentverletzenden Benutzung entscheidet demnach der Angebotsempfänger oder Abnehmer; er besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand (BGH, GRUR 2001, 228 – Luftheizgerät; Schulte/Mes, PatG, 11. Aufl., § 10, Rn. 17 ff.). - Die Beklagten wissen und wollen, dass die angebotene Folie in Kassetten eingesetzt werden kann, welche ihrerseits wiederum auf einen Behälter wie einen Windeleimer oder Katzenstreueimer aufgesetzt werden kann, um Einwegartikel zu entsorgen. Sie leitet in ihrer Internetpräsenz dazu an, wie die nachgekauften Folien zu händeln sind, um sie ordnungsgemäß und einsatzbereit in eine Kassette nachfüllen zu können (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. A, Rn. 620 ff.). Zur Überzeugung der Kammer beabsichtigen die Abnehmer insbesondere auch, die Folie in nicht autorisierten Kassetten zu verwenden. Dies folgt zum einen bereits daraus, dass die Abnehmer in der Angebotsgestaltung der Beklagten keine Hinweise finden, wonach ein solcher Einsatz ausgeschlossen sein sollte. Aus der Kompatibilität der Nachfüllfolie für insbesondere K-Windelsysteme und wiederum der Kompatibilität bestimmter nachgeahmter Nachfüllkassetten mit diesen Systemen resultiert die Kompatibilität der Nachfüllfolie mit nicht autorisierten Kassetten. Dies erkennt der angesprochene Abnehmerkreis.
- Hinsichtlich der vorgelegten R-Rezensionen ist auch nicht die Behauptung der Beklagten überzeugend, dass es sich um gefälschte Kundenbewertungen handeln könnte. Es fehlen jegliche, konkrete Anhaltspunkte, die diese Annahme tatsächlich belegen könnten. Ebenso wenig überzeugt es, wenn die Beklagten annehmen, dass die Rezensionen nicht auf Verkäufe nach Deutschland bezogen waren. Dies überzeugt zum einen schon deshalb nicht, weil die Beklagten nicht in Abrede stellen, grundsätzlich die angegriffene Ausführungsform auch in Deutschland anzubieten, weshalb nach der Lebenserfahrung anzunehmen ist, dass auch Lieferungen dorthin erfolgen. Zum anderen sind den Kommentaren (vgl. Anlage K 11) die Zusätze „verified purchase“ und „reviewed in Germany“ zu entnehmen, was auf einen durchgeführten Verkauf sowie eine Überprüfung des Kommentars hinweist. Außerdem sind die Kommentare, mit Ausnahme einer Meinung, originär in deutscher Sprache verfasst, sodass es aufgrund dieser Umstände an den Beklagten gewesen wäre, durch erhebliches Tatsachenvorbringen etwaig gefälschte Rezensionen konkret darzulegen. Dass allein abstrakt die Möglichkeit von Manipulationen besteht und R Kundenbewertungen unter bestimmten Umständen zusammenfassen kann, ist vorliegend nicht geeignet, Zweifel an der Echtheit der Kommentare zu begründen. Jedenfalls wäre es an der Beklagten zu 1) als Inhaberin eines R-Shops gewesen, Anstrengungen zu unternehmen, um den Hintergrund der Rezensionen aufzuklären, da diese zu ihrer betrieblichen Sphäre gehören.
-
2.
Die privaten Endabnehmer sind nicht berechtigt, die angegriffene Ausführungsform zu benutzen. Grundsätzlich sind private Endabnehmer aufgrund der Regelung des § 11 Nr. 1 PatG nicht in die Wirkungen des Patentschutzes einbezogen, diese Regelung gilt gem. § 10 Abs. 3 PatG aber nicht bei der Prüfung einer mittelbaren Patentverletzung. -
3.
Die Rechte der Klägerin an einer Vorrichtung wie in Klagepatentanspruch 1 beschrieben, sind durch die von ihr in den Verkehr gebrachten Kassetten nicht erschöpft. Der Erschöpfungseinwand der Beklagten greift nicht durch. Die Beklagten sind nicht berechtigt, die angegriffene Ausführungsform ohne Zustimmung der Klägerin dergestalt anzubieten oder zu liefern, dass sie beispielsweise in K bzw. O Kassetten, welche mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht wurden, verwendet werden könnte. Der Austausch der aufgebrauchten Folie in einer (originalen) Kassette durch eine neue Folie bzw. einen neuen Folienschlauch stellt eine unberechtigte Benutzung der erfindungsgemäßen Lehre dar, weil in diesem Austausch eine Neuherstellung einer erfindungsgemäßen Kassette, bestehend aus der Kassette selbst und der langgestreckten Verhülsung, liegt, die über den bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Kassette hinausgeht. - Das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnispatent ist hinsichtlich solcher Exemplare des geschützten Erzeugnisses erschöpft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden sind. Die rechtmäßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritterwerber sind befugt, diese Erzeugnisse bestimmungsgemäß zu gebrauchen, an Dritte zu veräußern oder zu einem dieser Zwecke Dritten anzubieten (BGH, GRUR 2023, 474 Rn. 44 – CQI-Bericht II). Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines patentgeschützten Erzeugnisses gehört auch die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit, wenn die Funktions- oder Leistungsfähigkeit des konkreten Erzeugnisses ganz oder teilweise durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigt oder aufgehoben ist. Von der Wiederherstellung einer aufgehobenen oder beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit eines mit Zustimmung des Patentinhabers in den Verkehr gelangten Erzeugnisses kann jedoch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn die getroffenen Maßnahmen darauf hinauslaufen, tatsächlich das patentgemäße Erzeugnis erneut herzustellen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 185 – Espressokapseln). Denn die ausschließliche Herstellungsbefugnis liegt beim Patentinhaber und er begibt sich dieser nicht mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses (BGH, GRUR 2018, 170 Rn. 35 f. – Trommeleinheit).
- Für die Abgrenzung zwischen (zulässiger) Reparatur und (unzulässiger) Neuherstellung ist maßgeblich, ob die getroffenen Maßnahmen noch die Identität des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschützten Erzeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgemäßen Erzeugnisses gleichkommen. Das kann regelmäßig nur unter Berücksichtigung der Eigenart des Gegenstands der Erfindung und unter Abwägung der einander widerstreitenden Interessen beurteilt werden (BGH, GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler). Einzustellen sind dabei die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits (vgl. BGH, GRUR 2023, 47 – Scheibenbremse II). Soweit eine Verkehrsauffassung festgestellt werden kann und die in Rede stehende Maßnahme danach als Neuherstellung anzusehen ist, kommt dem in der Regel ausschlaggebende Bedeutung zu (BGH, GRUR 2018, 170 – Trommeleinheit).
- Ist der Austausch eines Teils nach der Verkehrsauffassung als Neuherstellung des geschützten Erzeugnisses anzusehen, kann eine Patentverletzung in der Regel auch nicht mehr mit der Erwägung verneint werden, das ausgetauschte Teil spiegele nicht die technischen Wirkungen der Erfindung wider. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Vorhandensein eines solchen Teils im Patentanspruch zwingend vorgesehen ist (BGH, GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II). Die Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht wird, ist in der Regel nur dann ausschlaggebend, wenn mit dem Austausch des in Rede stehenden Teils während der Lebensdauer des geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu rechnen ist (BGH, GRUR 2018, 170 – Trommeleinheit). Die Erhaltung der angestrebten Lebensdauer gehört aber zu denjenigen Handlungen, zu denen ein rechtmäßiger Erwerber und dessen Nachfolger grundsätzlich befugt sind. Im Übrigen handelt es sich bei der Frage, ob sich gerade in den ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der Erfindung widerspiegeln und deshalb durch den Austausch dieser Teile der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht, aber nur um einen von mehreren für die Abwägung erheblichen Gesichtspunkten, dem nur in bestimmten Fallkonstellationen ausschlaggebende Bedeutung zukommt (BGH, GRUR 2012, 1118 – Palettenbehälter II).
- Nach der Verkehrsauffassung ist üblicherweise die Lebenserwartung einer Kassette mit Folie, wie sie von der Klägerin auch nur als Gesamtvorrichtung in den Verkehr gebracht wird, nach Abgabe der letzten langgestreckten Verhülsung zur Bildung eines Beutels ausgeschöpft. Der Austausch der Folie ist keine herkömmliche Erhaltungsmaßnahme; die geleerte Kassette ist für sich genommen kein verkehrsfähiges Wirtschaftsgut mehr. Allenfalls die befüllten Kassetten als solche stellen ein Austauschmittel für einen zu dem System passenden Behälter dar und sind regelmäßig zu ersetzen, wodurch die Lebensdauer des Behälters selbst verlängert wird. Dem Verkehr ist indessen bewusst, dass es nach dem Verbrauch der Folien regelmäßig eines Neukaufs befüllter Kassetten bedarf. Indem in originale Kassetten Nachfüllfolie gegeben wird, wird daher nicht lediglich ein Verschleißteil einer erfindungsgemäßen Vorrichtung erneuert. Nach der erfindungsgemäßen Lehre unterfallen eine Kassette und eine langgestreckte Verhülsung als Einheit dem Klagepatentanspruch 1. Die Kassette und die Folie, ausgebildet als langgestreckte Verhülsung, bilden die geschützte Gesamtvorrichtung und bedingen einander in technischer Hinsicht. Die Folie partizipiert an der erfindungsgemäßen Wirkung des Klagepatents. Insoweit handelt es sich, wie auch das OLG Düsseldorf in der genannten Entscheidung (Anlage B 3, Seite 24) festgestellt hat, nicht um eine beliebige Folie, die in die Kassetten eingefüllt werden kann. Vielmehr muss es eine langgestreckte Verhülsung sein, die vom Inneren der Kassette aufgenommen werden kann und den räumlich-körperlichen Gegebenheiten der Kassette angepasst ist. Dies macht die Klagepatentschrift in den Abs. [0020] und [0022] deutlich. Die Verhülsung muss demnach den richtigen Durchmesser aufweisen, um aus der oberen ringförmigen Öffnung austreten zu können und so an Aufnahme und Schließmechanismus vorbeizugehen, dass eine Isolierung der Einwegartikel nach Aufnahme in die Verhülsung durch diese erfolgen kann. Ohne eine dergestalt ausgebildete Verhülsung kämen die angestrebten Verbesserungen an der Kassette nicht vollends zum Tragen, weil die Verwendung der erfindungsgemäßen Kassetten problembehaftet wäre und dem sicheren Einlegen von Einwegartikeln in den Behälter entgegenstehen könnte.
- Sobald die Kassette geleert ist und keine Teile der langgestreckten Verhülsung mehr abgegeben werden können, ist die Gesamtvorrichtung folglich funktionsuntauglich geworden. Durch die Neubefüllung der Kassette wird deren Gebrauchstauglichkeit neu hergestellt.
- Hieran vermögen die Ausführungen der Beklagten nichts zu ändern. Insbesondere haben sie nicht schlüssig dargelegt, dass einer geleerten Kassette ein wirtschaftlicher Wert zukommen und es einen Markt für leere Kassetten geben könnte. Der Verweis auf ein einzelnes Verkaufsangebot ist kein geeigneter Nachweis. Außerdem ist nicht zu erkennen, dass es sich um anspruchsgemäße Kassetten mit abgefastem Freiraum (vgl. Anlage B 5) handelt. Das Argument, bei der Wiederverwendung geleerter Kassetten Müll einzusparen, überzeugt ebenso wenig, da der maßgebliche Müll bei Benutzung von erfindungsgemäßen Vorrichtungen auf Behältern zur Entsorgung von Einwegartikeln, gerade durch die abgegebene Folie anfällt. Die Kassette fällt dagegen kaum mehr ins Gewicht. Im Übrigen gestehen die Beklagten mit diesem Argument ein, dass eine geleerte Kassette grundsätzlich eben keiner Verwendung mehr zugeführt werden kann, sie mithin wirtschaftlich wertlos und die Lebensdauer ausgereizt ist.
- Dass der Verkehr in der Wiederbefüllung der geleerten Kassetten maßgeblich eine Neuherstellung erkennt, zeigen insbesondere die Kundenrezensionen: ein Abnehmer greift auf die angegriffene Folie zurück, um die Kassette wieder gebrauchsfähig zu machen und somit zu vermeiden, eine neue Kassette, befüllt mit Folie, kaufen zu müssen. Ohne Nachfüllfolie aber hätte die Kassette für ihn keinen wirtschaftlichen Wert mehr, sondern wäre nutzlos, da sie keine langgestreckten Verhülsungen mehr abgeben könnte, in die Einwegartikel eingebracht werden könnten. Zudem spricht die Art und Weise des Einfüllens der Folie in die Kassette für eine Neuherstellung einer erfindungsgemäßen Kassette. Denn ausweislich der Handlungsanleitung der Beklagten (vgl. Abbildung in der Klageschrift S. 7) und wie auch der Kundenmeinungen, bedarf es der Zuhilfenahme eines Papprohres, auf welches die aufgerollte Nachfüllfolie zunächst „aufzufädeln“ ist, bevor sie sich als langgestreckte Verhülsung im Inneren der Kassette wiederfindet und anschließend über die ringförmige Öffnung der Aufnahme der Kassette entlang deren äußeren Umfangs abgegeben wird. Dies geht mit Problemen wie dem Reißen der Folie einher und wird häufig als „fummelig“ beschrieben, was zeigt, dass die Neubefüllung nicht planmäßig vorgesehen ist. Des Weiteren bestätigen die Kundenmeinungen, dass es bei der Verwendung einer erfindungsgemäßen Kassette eben auch auf die konkrete Ausgestaltung der Folie ankommt; dort wird nämlich teilweise der zu geringe Umfang der angegriffenen Folie kritisiert, was das Wiederbefüllen erschwert. Solche Schwierigkeiten und sogar die gelegentliche Zerstörung der einzufüllenden Folie sind untypisch für ein reguläres Verschleißteil. Dieses zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass es leicht zugänglich und sein Austausch gelingsicher ist.
- Der Unteranspruch 2 des Klagepatents steht dieser Bewertung nicht entgegen. Dort ist eine Kassette (30) nach Anspruch 1 unter Schutz gestellt, welche einen abnehmbaren Deckel (36) umfasst, der die ringförmige Öffnung der ringförmigen Aufnahme (38) verschließt. Der Umstand aber, dass der Deckel der Kassette abnehmbar ist, verleiht der langgestreckten Verhülsung für sich genommen nicht den Charakter eines bloßen Austauschmittels. Denn hinsichtlich der Verhülsung ist weiterhin erforderlich, dass sie auf die Beschaffenheit der Kassette abgestimmt ist, um die beabsichtigten Wirkungen der Erfindung vollständig hervorzubringen.
-
III.
Auch die Beklagte zu 2) ist passivlegitimiert für die geltend gemachten Ansprüche. - Es kann sowohl dahingestellt bleiben, ob die Klägerin die Beklagte zu 2) wegen ihrer ursprünglichen Stellung als Geschäftsführerin mit der Klage in Anspruch genommen hat als auch der Zeitpunkt der Abberufung der Beklagten zu 2) aus der Geschäftsführung der Beklagten zu 1), weil die Beklagte zu 2) – und sogar unabhängig von ihrer aktuellen Position als Prokuristin – für die Verletzungshandlungen der Beklagten zu 1) als Beteiligte haftet.
- Patentverletzer ist jeder, der die patentierte Erfindung in eigener Person i.S.d. § 9 PatG unmittelbar benutzt oder als Teilnehmer i.S.d. § 830 Abs. 2 BGB eine fremde unmittelbare Benutzung i.S.d. § 9 PatG ermöglicht oder fördert. Patentverletzer ist ferner, wer sich an fremder Patentverletzung beteiligt, sei es als Gehilfe oder Anstifter. Anwendbar ist § 830 BGB, wobei es bedeutungslos ist, ob von einer Mittäterschaft oder einer Beihilfe auszugehen ist. Beide Teilnahmeformen werden nach § 830 Abs. 2 BGB deliktsrechtlich gleich behandelt. Regelmäßig genügt daher die Feststellung im Prozess, dass die einzelnen Beteiligten neben der Kenntnis der Tatumstände wenigstens in groben Zügen den jeweiligen Willen haben, die Tat gemeinschaftlich mit anderen auszuführen oder sie als fremde Tat zu fördern. Objektiv genügt eine Beteiligung an der Ausführung der Tat, die in irgendeiner Form deren Begehung fördern und für diese relevant ist (Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 139 Rn. 59 f. m.w.N.). Haftbar sind danach auch leitende Angestellte (wie Einkaufs- bzw. Verkaufsleiter), die den Erwerb bzw. Vertrieb patentverletzender Waren zu verantworten haben (vgl. LG Mannheim, InstGE 7, 14 – Halbleiterbaugruppe; Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 471). Sie haften auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadenersatz.
- Eine Verantwortlichkeit trifft nur denjenigen nicht, der als bloße Hilfsperson tätig wird und daher keine Herrschaft über die Rechtsverletzung hat. Entscheidend ist für die Einordnung als unselbständige Hilfsperson, dass dieser die verletzende Handlung in sozialtypischer Hinsicht nicht als eigene zugerechnet werden kann, weil sie aufgrund ihrer untergeordneten Stellung keine eigene Entscheidungsbefugnis hat (BGH, GRUR 2016, 493 – Al Di Meola).
- Unter diesen Voraussetzungen ist die Beklagte zu 2) nicht lediglich als unwissende Hilfsperson oder andere herkömmliche Beschäftigte eines Unternehmens anzusehen, sondern als für die Patentverletzung mitverantwortliche Person.
- Die Beklagten können sich vorliegend zur Distanzierung zu einer Patentverletzung der Beklagten zu 2) zunächst nicht formal darauf zurückziehen, dass die Beklagte zu 2) nicht mehr in die Geschäftsführung der Beklagten zu 1) eingebunden ist. Die Beklagte zu 2) kann in der hier zur Entscheidung stehenden Konstellation nicht von sich weisen, über die Geschäfte der Beklagten zu 1) informiert zu sein und organisatorisch in der Lage gewesen zu sein, in diese bei Bedarf einzugreifen und eine fortgesetzte Patentverletzung zu unterbinden. Denn allenfalls in Unternehmen, die eine ausgeprägte Struktur in Geschäftsführung und betrieblichem Unterbau aufweisen, sind auch funktionelle Arbeitsteilungen anzunehmen, die mit abgegrenzten Zuständigkeitsbereichen einhergehen und damit einzelne Mitarbeiter aus der Verantwortlichkeit für Unternehmensentscheidungen lösen können. Eine solche Unternehmensstruktur vermag die Kammer bei der Beklagten zu 1) indes nicht zu erkennen. Die Beklagten haben bereits nichts Weitergehendes zu komplexen Geschäftsführerstrukturen vorgetragen, nachdem die Klägerin behauptet hat, dass die Beklagte zu 1) im Wesentlichen aus der Beklagten zu 2) und ihrem Ehemann bestehe. Darüber hinaus ist es aber insbesondere die Beklagte zu 2), die gegenüber Dritten für die Beklagte zu 1) auftritt und für diese handelt. Jedenfalls ist sie dadurch an einer Patentverletzung der Beklagten zu 1) beteiligt, indem sie diese gefördert hat und für Dritte als Ansprechpartner zur Verfügung stand. Auf ihre formale organschaftliche Stellung kommt es dafür nicht an. Sie verfügt über umfangreiche Kenntnisse von den betrieblichen Handlungen der Beklagten zu 1), die ihre Haftung begründen.
- So ist schon ihre E-Mail-Adresse im Handelsregister im Rahmen der Firmenanschrift angegeben. Damit eröffnet die Beklagte zu 1) eine unmittelbare Kontaktmöglichkeit gerade über die Beklagte zu 2), und begründet somit eine unmittelbare Beziehung zwischen diesen beiden Personen. Insbesondere wird signalisiert, dass unter dieser E-Mail-Adresse Kontakt zu entscheidungsbefugten Personen bei der Beklagten zu 1) hergestellt werden kann.
- Ebenso verhält es sich mit der Angabe der Beklagten zu 2) bei R als Unternehmensvertreterin. Dies zeigt nämlich, dass die Beklagte zu 2) in die Geschäftsabläufe der Beklagten zu 1) unmittelbar involviert ist und zumindest Kenntnis von deren patentverletzenden Angeboten hatte. Sie ergibt sich aus diesem Impressum als Verantwortliche für das Angebot und ist daher passivlegitimiert. Sie vermittelt dem angesprochenen Verkehr auf diese Weise den Eindruck, für das Angebot verantwortlich zu sein (vgl. BGH, GRUR 2016, 493 – Al Di Meola). Dass das Impressum zwischenzeitlich, wie die Beklagten behaupten, abgeändert worden sein soll, vermag die Kammer mangels nachvollziehbarer Tatsachen nicht festzustellen. Im Übrigen würde eine Abänderung eine Haftung der Beklagten zu 2) für bereits begangene Benutzungshandlungen nicht ausräumen und ebenso wenig einen in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch ausschließen, da keine Unterlassungserklärung abgegeben worden ist.
- In diesem Zusammenhang können die Beklagten auch nicht mit dem Argument gehört werden, dass die hier streitgegenständlichen Angebote nicht bereits während der Tätigkeit der Beklagten zu 2) als Geschäftsführerin verfügbar gewesen seien. Die Klägerin hat substantiiert aufgezeigt, dass die Angebote seit Oktober 2017 online gewesen seien. Jedenfalls mit der Gründung der Beklagten zu 1) Mitte August 2018 ist eine Verfügbarkeit der Angebote anzunehmen. Die Beklagten haben es nicht plausibel vermocht, die Historie der Angebote aufzuzeigen, und insbesondere nicht erläutert, welche anderen, etwaig nicht auf sie zurückgehenden Produkte zuvor über dieses Angebot vertrieben worden seien, dabei verfügen die Beklagten unschwer über diese Informationen.
-
IV.
Es ergeben sich die nachfolgenden Rechtsfolgen: -
1.
Da die Beklagten das Klagepatent widerrechtlich benutzt haben, sind sie gemäß Art. 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet. - Dem Umfang nach besteht zwischen den Parteien Einigkeit, dass der Ausspruch zu begrenzen ist.
-
2.
Die Beklagten trifft auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Denn die Beklagte zu 1) als Fachunternehmen hätte bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Entsprechendes gilt für die Beklagte zu 2), welche in die Geschäftsabläufe der Beklagten zu 1) eingebunden ist. Für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents schulden die Beklagten daher Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, § 139 Abs. 2 PatG. -
3.
Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird. - Bei mittelbarer Patentverletzung (§ 10) muss das „Mittel“ durch den Dritten (Abnehmer) dazu bestimmt sein, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden und der Lieferant muss diese Bestimmung kennen; es kommt dann nicht mehr darauf an, ob das Mittel tatsächlich patentgemäß verwendet wird (BGH, GRUR 2001, 228 (231) – Luftheizgerät). Ein nach Abs. 2 zu ersetzender Schaden ist nur gegeben, soweit die mittelbare Patentverletzung auch zu einer Benutzung i.S.d. § 9 PatG führt (so die hM, Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 139 Rn. 40a).
- Oben wurde insoweit dargelegt, dass es zu unmittelbaren Patentverletzungen kommt. Für die Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach kommt es nicht darauf an, inwieweit die Beklagten über Kenntnisse des konkreten Einsatzes der angegriffenen Ausführungsform verfügen.
-
4.
Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz zu beziffern, sind die Beklagten verpflichtet, im zuerkannten Umfang über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, § 140b PatG i.V.m. § 242 BGB. Diese Verpflichtung trifft auch die Beklagte zu 2) (vgl. Kühnen, a.a.O., Kap. D Rn. 432), da sie für die Patentverletzung – wie ausgeführt – haftbar ist. -
5.
Die Klägerin kann von den Beklagten gesamtschuldnerisch die Erstattung von Abmahnkosten nur in der tenorierten Höhe verlangen. - Der Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten im Falle einer Patentverletzung nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 683 Satz 1, 677, 670 BGB setzt voraus, dass die Abmahnung dem Interesse und mutmaßlichen Willen des Abgemahnten entspricht. Hiervon ist auszugehen, wenn dem Abmahnenden gegen den Abgemahnten ein durchsetzbarer Anspruch auf Unterlassung zusteht, eine Abmahnung mithin berechtigt war. In einem solchen Fall liegt eine auf den Unterlassungsanspruch bezogene Abmahnung im Regelfall auch im Interesse des Abgemahnten, da sie ihm eine außergerichtliche und damit kostengünstige Streiterledigung ermöglicht (vgl. LG Düsseldorf Urt. v. 15.11.2007 – 4b O 42/07, BeckRS 2012, 6183).
- Die Abmahnung war berechtigt, da die geltend gemachten Ansprüche, wie dargelegt, bestanden.
-
Allerdings ist nur eine Gebühr von 1,8 erstattungsfähig.
Welche Gebühr der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit im Einzelfall verdient hat, ist gemäß § 14 RVG unter Berücksichtigung aller Umstände zu bestimmen. Einen Anhalt dafür, welche Rahmengebühr der Gesetzgeber für einen normal gelagerten Fall als angemessen erachtet hat, liefert der Zusatz zu Ziffer 2300 VV (Anlage 1 zum RVG), nach dem eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Aus dieser alternativen Formulierung folgt, dass eine Überschreitung der 1,3 Gebühr bereits dann gerechtfertigt ist, wenn eine der beiden Voraussetzungen gegeben ist. Für Fälle der vorliegenden Art, in denen es um die Verletzung von Patentrechten geht, ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese zunächst unabhängig von einer konkreten Betrachtungsweise bereits als schwierig zu gelten haben, da es sich bei dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nicht um einen solchen handelt, der üblicherweise in der Juristenausbildung behandelt wird. Hierzu bedarf es einer besonderen Spezialisierung, die von den Rechtsanwälten gefordert wird, wenn sie sich mit solchen Aufgaben befassen. Dass üblicherweise gleichzeitig auch ein Patentanwalt hiermit betraut ist, ändert an der Bewertung der Schwierigkeit der Angelegenheit für den verantwortlich tätigen Rechtsanwalt nichts. Gleiches hat für den Patentanwalt zu gelten, der in seiner Ausbildung nicht schwerpunktmäßig mit Fragen des Verletzungsprozesses und dessen Vermeidung befasst ist (LG Düsseldorf, Urteil vom 20. Oktober 2005 – 4b O 199/05, Rn. 24, juris). - Ausgehend von diesen Anforderungen hat die Klägerin keine konkreten Umstände aufgezeigt, die eine Gebühr von 2,0 rechtfertigten würden. Sie hat sich lediglich auf die außergewöhnliche Schwierigkeit des Falles zurückgezogen und die zu erarbeitenden Fragestellungen zur mittelbaren Patentverletzung. Präzisiert hat sie einen erheblich über normalen Patentstreitigkeiten liegenden Arbeitsaufwand allerdings nicht. Auch im Zeitpunkt der Beauftragung der Rechtsanwälte war ein solcher nicht zu erkennen. Von ähnlich gelagerten Verfahren leicht abweichende rechtliche Fragestellungen sind aber für sich genommen nicht geeignet, eine derart hohe Gebühr zu rechtfertigen. Vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass es in verschiedenen Sachverhaltskonstellationen unterschiedliche juristische Fragestellungen zu bearbeiten sind.
- Die Doppelbeauftragung von Rechts- und Patentanwalt ist nicht zu beanstanden. Die Klägerin durfte insbesondere die Beauftragung des Patentanwalts als notwendig erachten, weil sich der hiesige Sachverhalt technisch von den bisherigen insbesondere dadurch unterscheidet, dass nur die Nachfüllfolie angegriffen wird und sich daraus das Erfordernis, einer (erneuten) Bewertung des Klagepatents ergeben konnte (vgl. insoweit die Ausführungen im Rahmen der Erschöpfung).
- Zu erstatten sind danach Kosten in Höhe von 8.008,40 Euro (3.994,20 Euro Gebühren x 2 zuzüglich 20,00 Euro Auslagen).
- Der Zinsanspruch folgt ab dem 14. Dezember 2022 aus § 288 BGB. Die Beklagten befanden sich noch nicht ab dem 29. November 2022 in Verzug, da das an diesem Tag übermittelte Abmahnschreiben erst verzugsbegründend ist, indem den Beklagten Gelegenheit gegeben wurde, bis zum 13. Dezember 2022 eine Unterlassungserklärung abzugeben.
-
B.
Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 ZPO. - Streitwert: 250.000,- Euro