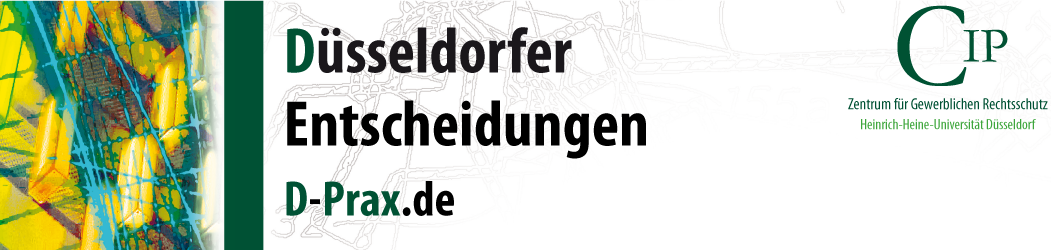Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3397
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 2. Juli 2024, Az. 4c O 19/23
- I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
- Vorrichtungen zum Ausführen eines Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freien Festkörpern,
- in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen, wenn die Vorrichtung umfasst
- einen Stromerzeuger
ein Behältnis, das mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden ist, der als Kathode agiert, wobei das Behältnis einen Satz von Teilchen enthält, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind in einer gasförmigen Umgebung, wobei die Teilchen eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen, die sie elektrisch leitfähig macht und ein Gas enthalten, das einen Platz einer interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen existiert, einnimmt, sodass Metallteile, die in das Behältnis eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen bedeckt bleiben;
einen beweglichen Arm, der ausgebildet ist, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen in dem Behältnis zu bewegen;
ein metallisches Befestigungselement, das mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden ist, wobei das metallische Befestigungselement Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile zu sichern und die Metallteile in das Behältnis einzubringen. - II. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
- 1. Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freier Festkörper auszuführen,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf
und
ohne im Falle des Lieferns auf der Verpackung der Vorrichtungen ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf; - 2. freie Festkörper, welche dazu geeignet sind, für ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels dieser freien Festkörper verwendet zu werden,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf
und
ohne im Falle des Lieferns auf der Verpackung der Vorrichtungen ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf. - III. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem 01. Dezember 2021 begangen hat, und zwar unter Angabe
- 1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; - wobei die Aufstellung – soweit vorhanden – in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, höchst hilfsweise Zollpapiere) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen. - IV. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem 01. Januar 2022 begangen hat, und zwar unter Angabe
- 1. der Herstellungsmengen und –zeiten
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer, wobei die entsprechenden Einkaufsbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen sind,
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, - wobei die Aufstellung – soweit vorhanden – in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist und
wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtiget und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist. - V. Die Beklagte wird verurteilt, in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindliche, unter Ziffer I. bezeichnete Erzeugnisse zu vernichten.
- VI. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 01. Dezember 2021 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse den gewerblichen Abnehmern gegenüber unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom ……………, Aktenzeichen ………………) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind.
- VII. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr und der A. durch die unter Ziffer I. und II. bezeichneten, seit dem 01. Januar 2022 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- VIII. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 10.657,00 zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 06. April 2023 zu zahlen.
- IX. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
- X. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte zu 90 %, im Übrigen trägt sie die Klägerin.
- XI. Das Urteil ist hinsichtlich der Ziffern I., II. V. und VI. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 450.000,00 EUR, hinsichtlich der Ziffern III., und IV. gegen Sicherheitsleistung von 50.000,00 EUR und hinsichtlich Ziffer VIII. für die Klägerin sowie der Kosten für beide Parteien jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vollstreckbar.
- XII. Der Geheimnisschutzantrag der Beklagten (Anträge zu Ziffer 5., 6., 7., und 8. gemäß Duplik vom 18. März 2024) wird zurückgewiesen.
- Tatbestand
- Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung aus behaupteter unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung sowie Zahlung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 372 XXX B1 (Anlage K3, im Folgenden: Klagepatent, deutschsprachige Übersetzung als Anlage K3_Ü). Unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 28. April 2016 (ES XXX) wurde das Klagepatent am 24. April 2017 angemeldet. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte unter dem 12. September 2018 und der Hinweis auf die Erteilung wurde am 01. Dezember 2021 bekannt gemacht. Das Klagepatent steht mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Es betrifft ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper. - Anspruch 1 des Klagepatents lautet in englischer Verfahrenssprache:
„Method for smoothing and polishing metals via ion transport by means of free solid bodies that, comprising the connection of the metal parts (1) to be treated to the positive pole, i.e. anode, of a current generator is characterized in that it comprises a step: - – of friction of the metal parts (1) with a set of particles (4) constituted by electrically conductive free solid bodies, which retain internally a liquid electrolyte to such an extent that there is no free liquid on the surface of the particles (4), charged with negative electric charge in a gaseous environment, wherein the particles (4) possess porosity and affinity to retain an amount of the liquid electrolyte, so that they have an electrical conductivity making them electrically conductive.“
- In deutscher Übersetzung lautet er:
„Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch lonentransport mittels freien Festkörpern, umfassend die Verbindung der zu behandelnden Metallteile (1) mit dem positiven Pol, d.h. Anode, eines Stromerzeugers, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Schritt umfasst: - – vom Reiben der Metallteile (1) mit einem Satz von Teilchen (4), der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen (4) ist, die mit einer negative elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen (4) eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht.“
- Der weiter geltend gemachte Anspruch 8 des Klagepatents lautet in englischer Verfahrenssprache:
„Device for carrying out the method for smoothing and polishing metals via ion transport by means of free solid bodies of any of claims 1 to 7, characterized in that it comprises: - – a current generator;
– a receptacle (3) connected to the negative pole of the current generator acting as cathode, the receptacle (3) containing a set of particles (4) constituted by electrically conductive free solid bodies, which retain internally a liquid electrolyte to such an extent that there is no free liquid on the surface of the particles (4), charged with negative electric charge in a gaseous environment, wherein the particles (4) possess porosity and affinity to retain an amount of the liquid electrolyte, so that they have an electrical conductivity making them electrically conductive and containing a gas occupying a space ( 5) of its interstitial environment existing between them, so that metal parts (1) introduced within the receptacle (3) remain fully covered by the set of particles (4);
– a moving arm adapted to move with relation to the set of particles (4) within the receptacle (3);
– a metal securing element (2) connected to the positive pole of the current generator, the metal securing element (2) comprising hooks or clips or jaws on the moving arm, being adapted to secure the metal parts (1) to be treated and to introduce the metal parts (1) within the receptacle (3).“
und in deutscher Übersetzung:
„Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch lonentransport mittels freien Festkörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sie umfasst: - – einen Stromerzeuger;
– ein Behältnis (3), das mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden ist, der als Kathode agiert, wobei das Behältnis (3) einen Satz von Teilchen (4) enthält, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen (4) ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen (4) eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht, und ein Gas enthalten, das einen Platz (5) einer interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen existiert, einnimmt, sodass Metallteile (1), die in das Behältnis (3) eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen (4) bedeckt bleiben;
– einen beweglichen Arm, der ausgebildet ist, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen (4) in dem Behältnis (3) zu bewegen;
– ein metallisches Befestigungselement (2), das mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden ist, wobei das metallische Befestigungselement (2) Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile (1) zu sichern und die Metallteile (1) in das Behältnis (3) einzubringen.“ - Folgende Figuren sind dem Klagepatent zur Erläuterung der klagepatentgemäßen Lehre entnommen:
- Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung der Hauptelemente, die bei der Anwendung des klagepatentgemäßen Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper verwendet werden. Dargestellt sind die zu behandelnden Metallteile (1), ein metallisches Befestigungselement (2), das mit dem positiven Pol eines Stromerzeugers verbunden ist, ein Behältnis (3), Teilchen (4) sowie den Raum der interstitiellen Umgebung (5), also den Raum zwischen den einzelnen Teilchen.
Fig. 4 und 5 zeigen schematisch Extremfälle, die bei der Anwendung des klagepatengemäßen Verfahrens auftreten können. Fig. 4 zeigt eine Konstellation, bei der eine Gruppe von Teilchen (4) eine elektrische Brücke zwischen dem positiven Pol eines Stromerzeugers, der Anode, über das metallische Befestigungselement, die Metallteile und der elektrisch leitfähigen Teilchen hin zum mit dem negativen Pol eines Stromversorgers, der Kathode, der mit dem Behältnis verbunden ist. Fig. 5 zeigt schematisch einen Fall, in welchem die Teilchen (4) ohne elektrische Verbindung zum Behältnis und deswegen in isolierter Weise die Oberfläche der Metallteile berühren. - Die Beklagte bietet auf ihrer Homepage (https://www.B.de/de/XXX/) Vorrichtungen der Serie „C“ (vormals bezeichnet als „D“) an. Hierzu zählt der C T im Dentalbereich und der C S im Bereich Schmuck.
Im Rahmen der „XXX“ (XXX) vom 14. März bis zum 18. März 2023 auf der XXX stellte die Beklagte zudem das Modell „E“ aus. - Die Klägerin hat vorprozessual die Ausführungsformen „C T“ und „E“ untersucht (im Folgenden gemeinsam mit dem Modell „C S“ bezeichnet als „angegriffene Ausführungsform“). Die Beklagte vertreibt zudem sog. F (F), welche zur Befüllung der angegriffenen Ausführungsform bestimmt sind (im Folgenden „angegriffene Ausführungsform F“).
Die angegriffene Ausführungsform dient zum Glätten und Polieren von metallischen Werkstücken mittels Elektropolitur. Hierzu verfügt sie über einen Behälter, sowie einen Aufsatz mit rotierenden metallischen Armen, an denen Werkstücke so angebracht werden können, dass sie durch eine in den Behälter eingefüllte Flüssigkeit oder Masse rotieren.
Nachfolgende Darstellung zeigt eine Variante der angegriffenen Ausführungsform, wobei der Aufsatz mit den rotierenden Armen in eine Stellung verbracht ist, wo der Behälter freiliegt. - (Klageschrift vom 29. März 2023, S. 34 = Bl. 35 d.A., Anmerkungen hinzugefügt durch die Klägerin)
- Für die Benutzung der angegriffenen Ausführungsform wird das Behältnis mit entsprechenden F, d.h. der angegriffenen Ausführungsform F gefüllt.
Die F werden sodann mit einer Elektrolytflüssigkeit gemäß einem definierten Mischverhältnis aufgegossen. Gemäß der Anleitung der Beklagten (etwa auf der Verpackung der F, siehe die Abb. in der Klageschrift vom 29. März 2023, S. 40 = Bl. 41 d.A.) an die Nutzer der angegriffenen Ausführungsform erfolgt dies mit der von der Beklagten vertriebenen Elektrolytflüssigkeit G. - Nachfolgende Abbildungen zeigen die von der Klägerin getestete angegriffene Ausführungsform nach dem Aufgießen zunächst vor und sodann nach dem Mischvorgang.
- (vor dem Mischvorgang, Klageschrift vom 29. März 2023, S. 40 = Bl. 41 d.A.)
- (nach dem Mischvorgang, Klageschrift vom 29. März 2023, S. 41 = Bl. 42 d.A.)
- Die zu bearbeitenden Werkstücke werden dann an den Armen befestigt und der Aufsatz mit den Armen in eine Stellung verbracht, in welcher die Werkstücke vollständig in die Füllung des Behältnisses eingetaucht sind. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der angegriffenen Ausführungsform wird bei der Bearbeitung eine Spannung derart angelegt, dass die beweglichen Arme und über diese das zu bearbeitende Werkstück mit dem positiven Pol eines Stromerzeugers und die in dem Behältnis befindliche Masse über das Behältnis mit einem negativen Pol eines Stromerzeugers verbunden sind.
Die Masse, so angerührt wie vorstehend beschrieben, hat die im Folgenden abgebildete Konsistenz. Das erste Bild zeigt die Masse in einer Nahaufnahme. Das zweite Bild zeigt eine mikroskopische Untersuchung der einzelnen Teilchen, wobei Lufträume zwischen den Teilchen, aber auch einzelne an der Oberfläche der Teilchen anhaftende Flüssigkeit zu erkennen sind. - (Nahaufnahme, Klageschrift vom 29. März 2023, S. 43 = Bl. 44 d.A.)
- (mikroskopische Aufnahme, anhaftende Flüssigkeit unten im Bild, Klageschrift vom 29. März 2023, S. 44 = Bl. 45 d.A.)
- Die von der Beklagten vertriebene angegriffene Ausführungsform F hat eine Porosität und Affinität dergestalt, dass sie Elektrolytflüssigkeit einspeichern und dadurch elektrisch leitfähig wird. Bei der Behandlung der Werkstücke mittels der angegriffenen Ausführungsform durch das Verfahren der Elektropolitur werden die F durch die Verbindung über das Behältnis zum negativen Pol eines Stromkreises negativ geladen. Es erfolgt im bestimmungsgemäßen Betrieb der angegriffenen Ausführungsform ein Ionentransport weg vom Werkstück hin zum negativen Pol der angegriffenen Ausführungsform als Stromerzeuger.
- Die Ausführungsform E unterscheidet sich von den Modellen C T und C S im Wesentlichen dadurch, dass sie eine Bearbeitung einer höheren Anzahl von Werkstücken gleichzeitig erlaubt.
- Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 15. März 2023 wegen Verletzung des Klagepatents ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf (Abmahnschreiben als Anlage K1). Gegenstand der Abmahnung und der Unterlassungserklärung waren die unmittelbare Verletzung von Anspruch 1 und Anspruch 8 sowie die mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents.
Die Beklagte wies mit Schreiben vom 16. März 2023 (Schreiben als Anlage K2) den Vorwurf der Patentverletzung zurück, gab gleichwohl „ohne jedwede Anerkennung“ einer Rechtspflicht eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hinsichtlich bestimmter Benutzungshandlungen ab. Hinsichtlich ihres Inhalts wird auf die zur Akte gereichte Erklärung, Bl. 33-34 d. Anlagenbandes Klägerin, verwiesen. - Die Klägerin hat mit der A,. (im Folgenden „A“) mit Sitz ebenso wie die Klägerin in XXX, XXX, am 10. Januar 2017 einen Lizenzvertrag geschlossen (Anlage K13). Beide Gesellschaften wurden hierbei durch Herrn XXX vertreten, der alleiniger Geschäftsführer beider Gesellschaften ist. Die Klägerin und die A haben am 29. März 2023 einen weiteren Vertrag über die Rückübertragung von Ansprüchen der A auf die Klägerin geschlossen (Anlage K14), wobei wiederum beide Parteien durch Herrn XXX vertreten wurden. Eine Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für Herrn XXX ist nicht erfolgt.
-
Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte mache unmittelbar und mittelbar von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform begehe die Beklagte eine unmittelbare und mittelbare Patentverletzung sowie hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform F eine mittelbare Patentverletzung. Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche zu.
Die Klägerin sei zunächst hinsichtlich aller geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Da das spanische Recht kein Verbot des Selbstkontrahierens kennt, sei es unschädlich, dass Herr XXX ohne eine entsprechende Befreiung gehandelt habe. Sowohl die Lizenzeinräumung als auch die Rückübertragung seien wirksam. Selbst wenn man im Übrigen eine Wirksamkeit der beiden Rechtsgeschäfte ablehne, so sei ja die Klägerin stets voll berechtigt am Klagepatent geblieben und deshalb auch in diesem Fall aktivlegitimiert.
Bei der Nutzung der angegriffenen Ausführungsform entsprechend den Instruktionen der Beklagten seien alle Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre verwirklicht.
Der Ionentransport müsse zwar gemäß der klagepatentgemäßen Lehre über freie Festkörper erfolgen, jedoch nicht ausschließlich über diese. Das Klagepatent behandele die Frage, wie möglichst schonend Erhebungen auf der Oberfläche der zu behandelnden Metallteile bearbeitet werden könnten. Der weitere Abtransport dieser Ionen sei von der klagepatentgemäßen Lehre nicht vorgegeben, vielmehr mache das Klagepatent, da es technisch-funktional auf den weiteren Abtransport nicht mehr ankomme, hier keine Vorgaben.
Die freien Festkörper müssten die ihnen von der klagepatentgemäßen Lehre zugeschriebenen Eigenschaften nur insoweit aufweisen, wie sie am anspruchsgemäßen Glätten und Polieren beteiligt seien. Dies sei beim Abtransport der Ionen nicht mehr der Fall. Deshalb müssten nur die am Glätten und Polieren beteiligten Teilchen frei von freier Flüssigkeit sein und nur diese Teilchen müssten sich in einer gasförmigen Umgebung befinden. Nur diese Teilchen wirken im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre am Verfahren mit. Keinesfalls sei hingegen von einer Mitwirkung aller in einem Behältnis befindlichen Teilchen auszugehen.
Die klagepatentgemäße Lehre wolle nicht jede Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen vermeiden, sondern nur freie Flüssigkeit. Flüssigkeit, die zwar nicht im Inneren, aber an der Oberfläche der Teilchen gebunden sei, sei keine freie Flüssigkeit in diesem Sinne. Dies ergebe sich eindeutig aus der technisch-funktionalen Überlegung, dass diese Flüssigkeit an der elektrochemischen Reaktion nicht in der unerwünschten Art und Weise mitwirke, die die klagepatentgemäße Lehre überwinden möchte. - Die Klägerin behauptet, die von ihnen mit der Klageschrift vom 29. März 2023 auf S. 44 (Abbildung oben wiedergegeben) eingereichten vergrößerten Aufnahmen stellten eine repräsentative Darstellung der mit der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Teilchen dar. Zudem habe die Klägerin einen neuen Test durchgeführt, auf dem ebenfalls erkennbar sei, dass zwischen den Teilchen Luft und keine Flüssigkeit, jedenfalls keine Flüssigkeit, die nicht an der Teilchenoberfläche anhafte und nicht frei beweglich sei, sei. Dies ergebe sich auch aus den neuen Testergebnissen.
- Soweit die Beklagte ihrerseits Tests vorgelegt habe, bei denen Flüssigkeit abtropfe, so könne hieraus kein Rückschluss auf eine Nichtverletzung gezogen werden, da die abtropfende Flüssigkeit nichtleitend sei. Zudem seien die Bedingungen im Abtropftest gänzlich andere als bei der Durchführung des Polierverfahrens. Flüssigkeit befinde sich jedenfalls allenfalls am Boden des Behältnisses und interagiere nicht mit den zu bearbeitenden Metallstücken.
- Die Klägerin hat mit der Replik vom 27. November 2023 zusätzlich eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform F geltend gemacht. Die Beklagte hat einer Klageänderung insoweit ausdrücklich widersprochen. Die Klägerin hat weiter in der mündlichen Verhandlung den unten wiedergegebenen Hilfsantrag zu II. 1. geltend gemacht. Die Beklagte hat mit nachgelassenem Schriftsatz vom 21. Mai 2024 zu diesem Hilfsantrag Stellung genommen.
- Die Klägerin beantragt zuletzt:
- I. Die Beklagte wird verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Ausführen eines Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freien Festkörpern,
in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen, wenn die Vorrichtung umfasst
einen Stromerzeuger
ein Behältnis, das mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden ist, der als Kathode agiert, wobei das Behältnis einen Satz von Teilchen enthält, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind in einer gasförmigen Umgebung, wobei die Teilchen eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen, die sie elektrisch leitfähig macht und ein Gas enthalten, das einen Platz einer interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen existiert, einnimmt, sodass Metallteile, die in das Behältnis eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen bedeckt bleiben;
einen beweglichen Arm, der ausgebildet ist, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen in dem Behältnis zu bewegen;
ein metallisches Befestigungselement, das mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden ist, wobei das metallische Befestigungselement Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile zu sichern und die Metallteile in das Behältnis einzubringen; - II. Die Beklagte wird verurteilt, bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Mitgliedern der Geschäftsführung der
Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen, - 1. Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freier Festkörper auszuführen,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht; - Hilfsweise zu 1.:
- Vorrichtungen, welche dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freier Festkörper auszuführen,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht,
ohne im Falle des Anbietens im Angebot ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf
und
ohne im Falle des Lieferns auf der Verpackung der Vorrichtungen ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen, dass das Glätten und Polieren von Metallteilen mittels Ionentransport über freie Teilchen, die durch in den Teilchen eingespeichertes Elektrolyt elektrisch leitfähig sind, ohne freie Flüssigkeit auf deren Oberfläche und mit einer negativen elektrischen Ladung in gasförmiger Umgebung geladen sind, in Deutschland für die Klägerin patentrechtlich geschützt ist und daher der separaten Zustimmung der Klägerin bedarf; - 2. freie Festkörper, welche dazu geeignet sind, für ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels dieser freien Festkörper verwendet zu werden,
Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern, wenn das Verfahren umfasst:
die Verbindung der zu behandelnden Metallteile mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
wobei es einen Schritt umfasst vom Reiben der Metallteile mit einem Satz von Teilchen, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist, die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen ist, die mit einer negativen elektrischen Ladung in einer gasförmigen Umgebung geladen sind, wobei die Teilchen eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht. - III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagten die unter Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem 01.12.2021 begangen haben, und zwar unter Angabe
- 1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen und/oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; - wobei im Hinblick auf Ziffer II. diejenigen Lieferungen und Abnehmer besonders kenntlich zu machen sind, die die Vorrichtungen auch entsprechend verwendet haben,
wobei die Aufstellung in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist,
wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine, höchst hilfsweise Zollpapiere) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen. - IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin in einem geordneten Verzeichnis darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten die zu Ziffer I. und II. bezeichneten Handlungen seit dem 01.01.2022 begangen haben, und zwar unter Angabe
- 1. der Herstellungsmengen und –zeiten
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie Namen und Anschriften der Abnehmer, wobei die entsprechenden Einkaufsbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) vorzulegen sind,
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, - wobei die Aufstellung in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln ist und
wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist. - V. Die Beklagte wird verurteilt, in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindliche, unter Ziffer I. bezeichnete Erzeugnisse zu vernichten.
- VI. Die Beklagte wird verurteilt, die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 01.12.2021 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse den gewerblichen Abnehmern gegenüber unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom ……………, Aktenzeichen ………………) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind.
- VII. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr und der A,. durch die unter Ziffer I. und II. bezeichneten, seit dem 01.01.2022 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- VIII. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 10.657,00 zzgl. Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
- Die Beklagte beantragt,
- die Klage abzuweisen;
- hilfsweise der Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.
- Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin sei bereits nicht aktivlegitimiert. Aufgrund des abgeschlossenen Exklusivvertrages aus dem Jahr 2017 sei – nach anwendbarem spanischem Patentrecht – allein die A zur Verwertung der klagepatentgemäßen Erfindung berechtigt. Eine Rückabtretung von Ansprüchen der A an die Klägerin sei bereits deshalb unwirksam, weil die Parteien im Rückabtretungsvertrag die Geltung deutschen Rechts vereinbart hätten. Dies erfasse den Vertrag insgesamt sowie die Vertretungsverhältnisse, wie sich aus der Rom I-VO ergebe. Deswegen greife als Bestimmung des deutschen Stellvertretungsrechts § 181 BGB, von dessen Beschränkungen der für beide Parteien handelnde Vertreter, Herr XXX, aber nicht befreit worden sei. Hieraus folge die Unwirksamkeit des Rückabtretungsvertrages.
Darüber hinaus verwirkliche die angegriffene Ausführungsform die klagepatentgemäße Lehre nicht. Der Klägerin stünden deshalb weder aus dem Klagepatent noch aus der abgegebenen Unterlassungserklärung die geltend gemachten Ansprüche zu.
Der Begriff des „Verfahrens“ umfasse den gesamten Vorgang des Politurverfahrens, insbesondere umfasse er sowohl das Reiben der Metallteile als auch den Abtransport der Ionen. Die freien Festkörper seien ständiger Bewegung ausgesetzt, so dass eine Differenzierung „während dem Reiben“ und „sonstige Zeitpunkte“ praktisch nicht möglich sei. Der relevante Bezugspunkt für die in der klagepatentgemäßen Lehre beschriebenen Eigenschaften der freien Festkörper sei der gesamte Satz der Teilchen und nicht etwa nur die (Sub-)Gruppe von Teilchen, die in einem bestimmten Augenblick das metallische Werkstück berührten und die Metallionen aufnähmen.
„Freie Festkörper“ im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre müssten zunächst „frei“ sein, sich in einer gasförmigen Umgebung befinden und sich somit jeweils frei und unabhängig voneinander bewegen können. Zwar sei es nicht ausgeschlossen, dass die freien Festkörper miteinander und mit Teilen der Maschine oder des Werkstückes in Kontakt stehen könnten. Ein solcher Kontakt entstehe jedoch während des Politurprozesses immer nur temporär und kurzzeitig.
Zudem müsse nach der klagepatentgemäßen Lehre auch der „Ionentransport über freien Festkörper“ erfolgen, was bedeute, dass der vollständige Transport der aus dem Metallwerkstück gelösten Ionen bis hin zur Kathode über, d.h. innerhalb der elektrisch leitfähigen Festkörper erfolgen müsse. Keinesfalls sei ausreichend, dass ein Teil des Transports, etwa über das letzte Stück der Transportstrecke zur Kathode, über eine Elektrolytflüssigkeit erfolge. Die Elektroytflüssigkeit könne beim Ionentransport zwar mitwirken, jedoch allenfalls dadurch, dass sie in den Teilchen eingespeichert werde und damit zu einer ausreichenden elektrischen Leihfähigkeit der Teilchen führe. Freie Festkörper lägen auch dann nicht vor, wenn die Festkörper aneinander und an der Maschine hafteten.
„Freie Flüssigkeit“ im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre sei jegliche nicht in den freien Festkörpern gebundene Flüssigkeit. Auch an die Oberfläche der Festkörper gebundene Flüssigkeit, die den Festkörpern anhafte, aber nicht in den Teilchen gebunden sei, sei solche freie Flüssigkeit. Die klagepatentgemäße Lehre setze die Abwesenheit solcher Flüssigkeit, also ein äußerlich trockenes Politurgemisch voraus. Das Erfordernis, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen sein dürfe, beziehe sich auf jedes einzelne Teilchen.
Nach der klagepatentgemäßen Lehre könne auch nicht nur Elektrolytflüssigkeit „freie Flüssigkeit“ sein. Vielmehr differenziere das Klagepatent zwischen der Aufnahme eines flüssigen Elektrolyts und dem Begriff der freien Flüssigkeit. Zudem stelle sich bei der Verdünnung einer Elektrolytflüssigkeit durch Wasser das Gesamtgemisch nunmehr seinerseits als (lediglich) verdünnte Elektrolytflüssigkeit dar. Im technischen Sinne sei eine solche eine Flüssigkeit die Ionen enthalte. Eine bestimmte Zusammensetzung sehe die klagepatentgemäße Lehre gerade nicht vor.
Eine gasförmige Umgebung im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre sei (nur) dann gegeben, wenn sich zwischen den Festkörpern keine Flüssigkeit befinde. Nicht maßgeblich sei hingegen, dass nur die interstitiellen Zwischenräume nicht mit Flüssigkeit gefüllt seien.
Die Beklagte meint zudem, aufgrund der von ihr abgegebenen Unterlassungsverpflichtungserklärung (Anlage K2) bestehe für den geltend gemachten prozessualen Unterlassungsanspruch kein Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin, soweit sich bereits aus der Verpflichtung ein Unterlassungsanspruch ergebe.
Die angegriffene Ausführungsform stelle überdies kein wesentliches Element der Erfindung dar. Auch ein Schlechthinverbot komme für die angegriffene Ausführungsform nicht in Betracht, da jedenfalls auch eine Verwendung ohne Nutzung der klagepatentgemäßen Lehre möglich sei.
Vermeintliche Ansprüche der Klägerin auf Vernichtung, Entfernung und Rückruf seien jedenfalls unverhältnismäßig, da sich die angebliche Erfindung in einer Politurmischung erschöpfe und die betroffenen Maschinen vielfältig verwendet werden könnten.
Die mit der Replik vom 27. November 2023 geltend gemachte mittelbare Patentverletzung durch Anbieten und/oder Liefern der angegriffenen Ausführungsform F stelle eine Klageerweiterung dar, die nicht sachdienlich sei. Jedenfalls dürften Gründe der Prozessökonomie nicht dazu herangezogen werden, einen auf Grund von fehlender Sorgfalt mit der Klage nicht vorgebrachten Antrag nachzuholen.
Überdies stünde der Beklagten aufgrund der bereits vorbenutzten Maschinen B 1, B 2 und B 3 sowie von vorbenutzten Ionenaustauscherharz-Teilchen ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG zu.
Hierzu behauptet die Beklagte, sie habe bereits im Jahr 2011 die Elektropoliermaschine B 1, im Jahr 2014 die Elektropoliermaschine B 2 und im Jahr 2015 die Elektropoliermaschine B 3 vertrieben. Für den von der Beklagten behaupteten näheren konstruktiven Aufbau der Maschinen wird auf ihre Schriftsätze vom 18. März 2024 und 06. Mai 2024 verwiesen.
Weiter habe sie auch schon vor dem 28. April 2016, dem Prioritätstag des Klagepatents, entsprechende Teilchen vertrieben. Schon in den Jahren 2014 und 2015 sei der Gedanke aufgekommen, statt den ursprünglich zur Elektropolitur verwendeten Plastikteilchen Ionenaustauscherharze, bezeichnet als „XXX“, zu verwenden. Diese sollten statt der Plastikteilchen in den Elektropoliermaschinen verwendet werden.
Insbesondere habe die Beklagte ein Produkt „H“ unter der Bezeichnung „I“ in ihr Produktportfolio aufgenommen. Der einzige faktische Unterschied zu den J bestehe darin, dass letztere in Lösung sauer reagieren. Die Produkte könnten sogar jeweils in das andere chemisch umgewandelt werden. Weiter habe die Beklagte ein Produkt „K“ unter der Bezeichnung „L“ ins Portfolie aufgenommen. Einziger Unterschied des L sei, dass diese kleinere Poren habe und deshalb weniger Flüssigkeit aufnehmen könne. Dies werde durch eine geringere Flüssigkeitszugabe kompensiert.
Hinsichtlich des Hilfsantrags der Klägerin zu II.1 ist die Beklagte der Ansicht, der von der Klägerin im Antrag formulierte Warnhinweis sei unzulässig, da er nicht klar und eindeutig formuliert sei. Vom Empfängerhorizont ihrer Abnehmer aus, die oftmals Kleinunternehmer seien, sei die bloße Wiedergabe der Merkmale des Patentanspruchs völlig unverständlich. Vielmehr sei bei einem solchen Hinweis zu besorgen, dass Abnehmer auch außerhalb des Schutzbereichs des Klagepatents schlicht auf die Verwendung der angegriffenen Ausführungsform F verzichteten. - Die Beklagte hat weiter mit Schriftsatz vom 18. März 2024 hilfsweise für den Fall ihrer Verurteilung Geheimnisschutz für bestimmte, von den Anträgen der Klägerin umfasste Informationen beantragt. Die Klägerin ist dem Antrag mit Schriftsatz vom 23. April 2024 entgegengetreten.
- Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2024 verwiesen.
- Entscheidungsgründe
- Die Klage ist zulässig und überwiegend begründet.
I.
Die Klage ist in zuletzt geltend gemachter Form zulässig.
Die zusätzliche Geltendmachung einer mittelbaren Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform F stellt eine nachträgliche objektive Klagehäufung dar. Diese ist zulässig, §§ 260, 263 Alt. 2 ZPO. Der Streitgegenstand eines Patentverletzungsprozesses ist, allgemeinen Grundsätzen folgend, durch Antrag und Lebenssachverhalt determiniert. Allein hieraus folgt, dass eine Klageerweiterung durch die Klägerin vorgenommen wurde.
Die Beklagte hat der Klageerweiterung vorliegend nicht zugestimmt, sondern vielmehr ausdrücklich widersprochen, § 263 Alt. 1 ZPO. Die Klageerweiterung stellt sich aber als sachdienlich dar, § 263 Alt. 2 ZPO. Entscheidend für die Frage der Sachdienlichkeit ist die Prozessökonomie. Der erweiterten Klage liegt dasselbe Schutzrecht zugrunde und die zur Beurteilung der Verletzungsfrage maßgeblichen Tatsachen sind weitgehend identisch. Auch droht im Falle fehlender Sachdienlichkeit ein weiterer Streit der Parteien über den in der Klageerweiterung geltend gemachten Prozessgegenstand. Die Voraussetzungen des § 260 ZPO liegen vor. - Die vorgerichtlich abgegebene Unterlassungserklärung nimmt der Klage weder im Ganzen noch teilweise das Rechtschutzbedürfnis. Zum einen umfasst die Unterlassungserklärung nicht die Konstellationen der mittelbaren Patentverletzung, welche die Klägerin vorliegend geltend macht. Zum anderen ist das Kriterium des Rechtsschutzinteresses vornehmlich an staatlichen Rechtspflegeinteressen auszurichten (vgl. MüKoZPO/Becker-Eberhard, 6. Aufl. 2020, ZPO vor § 253 Rn. 11). Vorliegend ist bei einem Vorgehen der Klägerin aus der Unterlassungserklärung mit gleichgelagerten Streitigkeiten über die Auslegung der Erklärung zu rechnen, weshalb allein aus diesem Grunde das Rechtsschutzinteresse nicht abzusprechen ist.
II.
Die Klägerin ist hinsichtlich aller geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. - 1.
Sie ist zur Geltendmachung des der A entstandenen Schadens berechtigt, da diese eine ausschließliche Lizenz erworben und der Klägerin ihre entsprechende Forderung durch Abtretung wirksam übertragen hat. - a.
Die A hat wirksam eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent erworben.
Anwendbar auf die Wirkungen der ausschließlichen Lizenz im Verhältnis der Klägerin, A und Dritten, deren Verletzung des lizensierten Patents im Raum steht, ist deutsches Recht.
Auf die Frage, welchem rechtlichen Komplex ein jeweiliger Vorgang zugeschlagen wird und welche Kollisionsnorm einschlägig ist, richtet sich nach der lex fori, also vorliegend deutschem Recht. Vorliegend sind die Parteien übereinstimmend im Ergebnis der Auffassung, dass mit Vertrag vom 10. Januar 2017 eine Exklusivberechtigung nach spanischem Recht an dem Klagepatent eingeräumt worden ist, die vergleichbar einer deutschen ausschließlichen Lizenz ist. Die ausschließliche Lizenz ist nach deutschem Rechtsverständnis als absolut wirkendes Recht, vergleichbar dem Schutzrecht selbst, anzusehen, welches gegenüber jedermann Ausschlussrechte begründet (Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl. 2022, § 15 Rn. 33). Damit unterliegen die Wirkungen, aber auch die Begründung, einer ausschließlichen Lizenz gegenüber unbeteiligten Dritten dem Schutzlandprinzip (lex loci prBtionis, BGH GRUR 2022, 1209 Rz. 42 ff. – Bakterienkultivierung). Die Bestimmung Nr. 5 des Lizenzvertrags (Anlage K13), welche die Vereinbarung „der Rechtsprechung der Gerichte der Stadt Barcelona“ unterwirft, geht insoweit mangels Rechtswahlmöglichkeit der Parteien ins Leere. Sie mag anders anzuknüpfende Fragestellungen erfassen und deswegen rechtlich durchaus Wirkungen zeigen (vgl. BGH, a.a.O. Rz. 43 – Bakterienkultivierung), allerdings nicht für die im hiesigen Rechtsstreit gegenständlichen Streitfragen. Nach dem Schutzlandprinzip ist vorliegend für das Klagepatent als deutscher Teil eines EP deutsches Recht, konkret das materielle deutsche Patentrecht, zur Anwendung berufen.
Die Frage, ob die Parteien bei Abschluss eines Vertrags, hier konkret des Lizenzvertrags vom 10. Januar 2017, wirksam vertreten waren, ist hingegen gesondert anzuknüpfen.
Bei der kollisionsrechtlichen Vertretungsbefugnis ist dahingehend zu differenzieren, ob die handelnden Personen im Rahmen einer organschaftlichen Vertretung oder aufgrund gewillkürter Bevollmächtigung tätig geworden sind. Im ersteren Fall ist eine gesellschaftsrechtliche Qualifikation, im letzteren Fall eine Qualifikation nach den Regeln für die gewillkürte Vertretungsmacht vorzunehmen.
Die Abgrenzung dieser Qualifikationsnormen ist wiederum eine Frage des deutschen Internationalen Privatrechts (BeckOGK/Huber, 1.11.2021, BGB § 164 Rn. 107). Nach diesem ist eine organschaftliche Stellvertretung und damit eine Qualifikation nach dem Gesellschaftsstatut vorzunehmen, wenn sich die Vertretungsbefugnis unmittelbar aus der Stellung des Vertreters als Gesellschaftsorgan ergibt (BeckOGK/Huber, 1.11.2021, BGB § 164 Rn. 112). Eine gewillkürte Stellvertretung (mit entsprechender kollisionsrechtlicher Anknüpfung) ist hingegen gegeben, wenn die Vertretungsbefugnis auf einen rechtsgeschäftlichen Erteilungsakt zurückgeführt wird (vgl. BeckOGK/Huber, 1.11.2021, BGB § 164 Rn. 108 f.). Maßgeblich für die Subsumption der konkreten Bevollmächtigung einer handelnden Person ist der ausländische Sachverhalt. Gegebenenfalls muss der Inhalt des ausländischen Rechts ermittelt werden, um zu prüfen, ob dieser nach deutschem Verständnis einer organschaftlichen Bestellung oder einem rechtsgeschäftlichen Erteilungsakt gleicht.
Vorliegend ist auf beiden Seiten Herr XXX tätig geworden. Dieser war im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags alleiniger Geschäftsführer der Klägerin und als solcher vertretungsbefugt. Eine ebensolche Vertretungsbefugnis ergibt sich auch für die A. Dieses Auftreten als Geschäftsführer nach spanischem Recht ist vorliegend nach deutschem Kollisionsrecht als organschaftliche Stellvertretung anzusehen. Damit ist für beide Parteien ihr jeweiliges Gesellschaftsstatut heranzuziehen.
Nach deutschem Internationalem Privatrecht ist als Gesellschaftsstatut das Recht des Staates heranzuziehen, an dem der effektive Verwaltungssitz der Gesellschaft liegt (sog. Sitztheorie, MüKo-BGB/Kindler, Bd. 13, Internationales WirtschaftR Teil 10. Internationales Handels- und GesellschaftR Rn. 423). Dieser ungeschriebene deutsche Rechtsgrundsatz bleibt indes insoweit unangewendet, wie Art. 49, 54 AEUV aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts ein Abstellen auf das Recht des Gründungsstaates gebieten. Vorliegend liegt sowohl der effektive Verwaltungssitz beider Parteien in Spanien als ist auch für beide Parteien das spanische Recht ihr Gründungsrecht. Damit kommt für beide Parteien spanisches Recht für die Frage der Vertretungsbefugnis zur Anwendung. Gemäß Art. 4 Abs. 1 S. 1 EGBGB handelt es sich um eine Gesamtverweisung (MüKo-BGB/Kindler, 8. Aufl. 2021, Bd. 13, Internationales WirtschaftR Teil 10. Internationales Handels- und GesellschaftR Rn. 509), so dass auch das spanische Internationale Privatrecht zu Anwendung zu bringen (und damit die Annahme der Verweisung durch die spanische Gesamtrechtsordnung zu prüfen) ist.
Das spanische Recht nimmt die Verweisung an, da es sich bei den Parteien um spanische Gesellschaften handelt. Art. 9 des spanischen Gesetzes über Kapitalgesellschaften (Ley de sociedades de capital) in Verbindung mit Art. 8 ff. des spanischen Zivilgesetzbuches (Código Civil) sehen vor, dass bei spanische Gesellschaften, konkret Gesellschaften mit satzungsmäßigem Verwaltungssitz in Spanien unabhängig von ihrem Gründungsort, spanisches Recht für Fragen der Stellvertretung Anwendung findet (Fischer/Grupp/Baumeister in: Wegen/Spahlinger/Barth GesR Ausland, 7. EL Oktober 2023, Spanien Rn. 199 f.).
Es kommt damit vorliegend spanisches Vertretungsrecht zur Anwendung. Beide Parteien haben übereinstimmend vorgetragen, dass im spanischen Recht ein Fall des Vertretungsverbotes nicht gegeben und der Lizenzvertrag nach spanischem Recht wirksam abgeschlossen ist.
Die A hat damit durch den Vertrag vom 10. Januar 2017 eine ausschließliche Lizenz am Klagepatent, deren Wirkungen gegenüber Dritten sich nach deutschem Recht richtet, erworben. - b.
Die Klägerin hat der A zustehende Schadensersatzforderungen auch wirksam durch Abtretung erworben, § 398 BGB. Die Vertretung der beiden Gesellschaften beim Abschluss des Abtretungsvertrags richtet sich entsprechend dem vorstehend Geschilderten nach spanischem Recht und ist wirksam erfolgt.
Die Beklagte ist der Ansicht, die Klägerin und die A hätten im Abtretungsvertrag die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart, weshalb nach Art. 3 Rom-I-VO der Vertrag insgesamt einschließlich der Stellvertretung der Parteien dem deutschen Recht unterliege. Dem kann nicht beigetreten werden.
Nach Art. 1 Abs. 2 lit. g Rom-I-VO sind Fragen sowohl der organschaftlichen als auch der gewillkürten Stellvertretung vom Anwendungsbereich der Rom-I-VO ausgenommen (Grüneberg/Thorn, BGB, 82. Aufl. 2023, Rom I Art. 1 Rn. 13). Die Frage der organschaftlichen Stellvertretung richtet sich allein nach deutschem Internationalem Gesellschaftsrecht, nicht nach der Rom-I-VO. Als Gesellschaftsstatut für die Vertretungsverhältnisse sowohl der Klägerin als auch der A ist spanisches Recht berufen. Eine Rechtswahl ist in den allgemeinen Vorschriften des deutschen Internationalen Privatrechts, Art. 3 bis 6 EGBGB, nicht vorgesehen. Eine entsprechende Regelung im (ungeschriebenen) deutschen Internationen Gesellschaftsrecht ist nicht ersichtlich. Ob die von der Klägerin in Bezug genommene Klausel Nr. 7 im Abtretungsvertrag (Anlage K14) damit, so wie es die Beklagte vorträgt, auch hinsichtlich der Stellvertretungsregelungen deutsches Recht zu Anwendung bringen wollte – was zweifelhaft ist, indes im Wege der Auslegung zu ermitteln wäre – ist ohne Belang, da eine solche Rechtswahl im einschlägigen Kollisionsrecht nicht vorgesehen ist. Damit bleibt es bei der Anwendung spanischen Gesellschaftsrechts für die organschaftliche Vertretung der Klägerin und der A auch für den Vertrag vom 29. März 2023. - c.
Im Übrigen bestimmt sich auch der Inhalt der von der Klägerin erworbenen Schadensersatzforderungen nach deutschem Recht, Art. 8 Abs. 1 Rom-II-VO, da das Klagepatent Schutz für Deutschland beansprucht. Gleiches gilt für die Übertragbarkeit sowie der Rechtswirkungen zwischen der Klägerin als Zessionarin und einem potentiellen Schuldner, Art. 14 Abs. 2 Rom-I-VO. - 2.
Die Klägerin ist hinsichtlich der geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Feststellung des ihr selbst entstandenen Schadens aktivlegitimiert.
Hinsichtlich der in die Zukunft gerichteten Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf folgt dies bereits aus ihrer Stellung als eingetragene Inhaberin des Klagepatents. Dies gilt jedenfalls dann, wenn dem Inhaber aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen (Schulte/Voß, PatG, 11. Aufl. 2022, § 139 Rn. 14, § 140a Rn. 6; Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 140a Rn. 3, 13), was vorliegend der Fall ist, da der Klägerin alljährlich Lizenzgebühren zufließen, vgl. Bestimmung Nr. 2 des Lizenzvertrags vom 10. Januar 2017 (Anlage K13). Auch insoweit ist deutsches Recht anwendbar, was aus dem Schutzlandprinzip folgt.
Auch die Aktivlegitimation der Klägerin hinsichtlich Ersatz des ihr entstandenen Schadens folgt ohne weiteres aus der Inhaberschaft am Klagepatent. Hieran ändert eine ausschließliche Lizenz jedenfalls dem Grunde nach nichts (vgl. Schulte/Voß, PatG, 11. Aufl., § 139 Rn. 14). Die durch die ausschließliche Lizenz geschmälerte Berechtigung der Klägerin unterliegt schließlich auch deutschem Recht. Auf die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz hinsichtlich der Verletzung durch Dritte findet nach deutschem Kollisionsrecht das Recht desjenigen Staates Anwendung, für welchen das entsprechende Patent Schutz beansprucht (vgl. BGH GRUR 2022, 1209, 1211 Rz. 45 ff. – Bakterienkultivierung).
III.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper.
Als Beispiel für zu bearbeitende Metallteile nennt das Klagepatent beispielsweise Zahnprothesen. Das Verfahren basiere auf dem Ionentransport mit Hilfe von kleinen freien Festkörpern, d.h. Teilchen. Diese Festkörper zeichneten sich im Wesentlichen dadurch aus, dass die Festkörper elektrisch leitfähig seien und zusammen in einer gasförmigen Umgebung angeordnet würden, wobei die zu glättenden und zu polierenden Metallteile so angeordnet seien, dass sie mit dem positiven Pol einer Stromversorgung verbunden seien und sich vorzugsweise bewegten. Die Gesamtheit der Festkörper sei so angeordnet, dass sie einen negativen Pol einer Stromversorgung elektrisch kontaktiere. Die Gesamtheit der Festkörper bestehe aus Teilchen, die in der Lage seien, im Inneren eine Menge an Elektrolytflüssigkeit zu speichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit aufwiesen, die sie elektrisch leitfähig mache (Abs. [0002]).
Das Anwendungsgebiet der klagepatentgemäßen Lehre liege im Bereich der Industrie, welcher sich mit dem Polieren, insbesondere dem Elektropolieren mittels Teilchen, von Metallteilen, z.B. Zahnprothesen aus rostfreiem Stahl, beschäftige (Abs. [0003]).
Im Stand der Technik seien verschiedene Systeme zum Glätten und Polieren von Metallen mittels freier Festkörper bekannt (Abs. [0004]). Bereits seit langem werde eine Vielzahl von Geräten verwendet, bei denen der mechanische Abrieb durch die Verwendung von Teilchen erfolge, die nicht auf einem Träger befestigt seien, unterschiedliche Geometrien und Größen aufwiesen und härter seien als das zu behandelnde Material (Abs. [0005]). Solche Vorrichtungen erzeugten die Reibung der Teilchen auf den zu behandelnden Teilen dank der Relativbewegung, die sie zwischen beiden erzeugen (Abs. [0006]). Sie bestünden beispielsweise aus rotierenden oder vibrierenden Behältern oder Teilchenstrahlern (Abs. [0007]).
Allerdings hätten alle Systeme, die auf direktem mechanischem Abrieb beruhen, wie etwa die vorgenannten, den erheblichen Nachteil, dass sie die Teile ungleichmäßig bearbeiten. Zudem sei der Abtrag an einigen Stellen exzessiv und führe zu einer Änderung der Kontur (Abs. [0008]). Zusätzlich sei die allgemeine mechanische Energie, die in besagten Systemen eingesetzt werde, in vielen Fällen der Grund für Schäden an den Teilen durch Stöße und Deformationen aufgrund übermäßiger Beanspruchung (Abs. [0009]). Weiter erzeugten die auf mechanischem Abrieb basierenden Systeme auf Metallteilen Oberflächen mit plastischer Verformung und schlössen dabei unvermeidlich nicht zu vernachlässigende Mengen an Fremdstoffen ein, was in vielen Fällen zur Untauglichkeit solcher Verfahren zum Glätten und Polieren aufgrund von Verunreinigungen der Oberflächenschichten des Materials führe (Abs. [0010]).
Ebenso seien Systeme zum Polieren durch galvanische Behandlung bekannt, bei denen die zu behandelnden Metallteile eine Elektrolytflüssigkeit getaucht würden, sog. Elektropolitur (Abs. [0011]). Diese Verfahren hätten den Vorteil, dass die erzeugten Oberflächen frei von der Kontamination seien, welche die vorstehend erörterten rein mechanischen Abriebmethoden erzeugten (Abs. [0012]). Allerdings sei der Glättungseffekt in vielen Fällen unzureichend, weswegen die besagte Behandlung meist als Finish nach einem vorhergehenden mechanischen Abriebverfahren eingesetzt würde (Abs. [0013]).
Weiterhin existierten galvanische Verfahren, bei denen die zu behandelnden Metallteile in eine Elektrolytflüssigkeit getaucht würden, die Festkörper (Teilchen) enthalte, welche sich frei darin bewegten (Abs. [0014]). Die für dieses Verfahren entwickelten Elektrolyte erzeugten eine dickere Anodenschicht als die galvanischen Verfahren ohne Teilchen, so dass, wenn die darin enthaltenen Teilchen mechanisch interagierten, ein effizientes Glätten von Rauheiten von bis zu einem Millimeter bewirkt werde (Abs. [0015]).
In beiden vorgenannten Fällen verursachten die bislang verwendeten galvanischen Verfahren in vielen Fällen Defekte in Form von kleinen Löchern oder abgestuften Oberflächen betreffend die Struktur und die kristalline Zusammensetzung des zu behandelnden Metalls, weshalb ihre Verwendung in vielen Fällen auf Teile beschränkt sei, bei denen aufgrund ihrer Eigenschaften empirisch gesichert sei, dass sie behandelt werden könnten ohne die genannten Defekte in unakzeptabler Weise zu zeigen (Abs. [0016]). - Das Klagepatent stellt sich vor diesem Hintergrund die Aufgabe, ein verbessertes System für Metallteile zu entwickeln, welches effektiv ist und die vorstehend erörterten Nachteile vermeidet (Abs. [0017]).
- Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:
-
1. Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper,
1.1 umfassend die Verbindung der zu behandelnden Metallteile (1) mit dem positiven Pol, d.h. der Anode, eines Stromerzeugers
dadurch gekennzeichnet, dass
2. es einen Schritt umfasst:
2.1 vom Reiben der Metallteile (1)
2.2 mit einem Satz von Teilchen (4), der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist,
2.2.1 die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß aufnehmen, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen (4) ist,
2.2.2 die mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind
2.2.3 in einer gasförmigen Umgebung,
2.2.4 wobei die Teilchen (4) eine Porosität und eine Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern,
2.2.5 so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben, die sie elektrisch leitfähig macht. - Weiter sieht das Klagepatent zur Lösung dieser Aufgabe in Anspruch 8 eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
-
1. Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens zum Glätten und Polieren von Metallen durch Ionentransport mittels freien Festkörpern,
dadurch gekennzeichnet, dass
2. sie umfasst:
2.1 einen Stromerzeuger;
2.2 ein Behältnis (3), das mit einem negativen Pol des Stromerzeugers verbunden ist, der als Kathode agiert,
2.2.1 wobei das Behältnis (3) einen Satz von Teilchen (4) enthält, der durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet ist,
2.2.2 die innerlich ein flüssiges Elektrolyt in solch einem Ausmaß einspeichern, dass keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen (4) ist,
2.2.3 die mit einer negativen elektrischen Ladung geladen sind
2.2.4 in einer gasförmigen Umgebung,
2.2.5 wobei die Teilchen (4) eine Porosität und Affinität aufweisen, eine Menge des flüssigen Elektrolyts einzuspeichern,
2.2.6 sodass sie eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen, die sie elektrisch leitfähig macht
2.2.7 und ein Gas enthalten, das einen Platz (5) einer interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen existiert, einnimmt, sodass Metallteile (1), die in das Behältnis (3) eingebracht werden, vollständig durch den Satz von Teilchen (4) bedeckt bleiben;
2.3 einen beweglichen Arm, der ausgebildet ist, sich in Bezug auf den Satz von Teilchen (4) in dem Behältnis (3) zu bewegen;
2.4 ein metallisches Befestigungselement (2), das mit dem positiven Pol des Stromerzeugers verbunden ist, wobei das metallische Befestigungselement (2) Haken oder Klemmen oder Einspannbacken an dem beweglichen Arm umfasst, die ausgebildet sind, die zu behandelnden Metallteile (1) zu sichern und die Metallteile (1) in das Behältnis einzubringen. - IV.
Die Parteien streiten vorliegend hinsichtlich Anspruch 1 der klagepatentgemäßen Lehre – zurecht – ausschließlich über das Verständnis des Merkmals 1 sowie der Merkmalsgruppe 2.2. Seitens der Kammer bedarf es deshalb nur insoweit an Ausführungen. Die Auslegung des Anspruchs 8 der klagepatentgemäßen Lehre ist zwischen den Parteien über die zu Anspruch 1 diskutierten Fragen hinaus nicht streitig, so dass insoweit auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen werden kann. - 1.
Gemäß Merkmal 1 beansprucht die klagepatentgemäße Lehre ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallen mittels Ionentransport über freie Festkörper.
Dabei muss der Ionentransport im Bereich, in welchem die freien Festkörper mit dem Werkstück in Kontakt treten, über die freien Festkörper erfolgen, im Übrigen aber nicht ausschließlich über diese (hierzu a.). Das Verfahren umfasst den ganzen Vorgang entsprechend der klagepatentgemäßen Lehre einschließlich des Abtransports der Ionen (dazu b.). Freie Festkörper sind dabei solche Festkörper, die sich in Beziehung zueinander und zu den zu bearbeitenden Metallteilen frei bewegen können. (hierzu c.) - a.
Der Ionentransport muss in dem Bereich, in welchem die freien Festkörper mit dem Werkstück in Kontakt treten, über die freien Festkörper erfolgen, aber nicht ausschließlich über diese.
Der Merkmalswortlaut legt nicht fest, ob ein Transport ausschließlich oder jedenfalls auch über freie Festkörper erfolgen muss. Sprachlich lässt sich beides unter den Anspruchswortlaut fassen.
Eine nähere Bestimmung des Inhalts der Lehre des Klagepatents ist über die technisch-funktionale Bedeutung möglich, die die klagepatentgemäße Lehre dem Ionentransport beimisst.
Der Abtransport der Ionen vom Werkstück ausschließlich über freie Festkörper ist eine wesentliche Abgrenzung der klagepatentgemäßen Lehre zum vorherigen Stand der Technik. So schildert die Beschreibung des Klagepatents, dass Verfahren vorbekannt sind, bei denen das zu behandelnde Werkstück in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht wird, wobei in dieser Festkörper enthalten sein können, aber nicht müssen.
So heißt es in der Beschreibung: - „[0011] Likewise, polishing systems by means of galvanic treatments are known, in which the metal parts to be treated are immersed in an electrolyte liquid and without solid particles as anodes, known as electropolishing. […]
- [0013] Now then, the levelling effect on the roughness of the order of more than a few microns that is achieved is, in many cases, insufficient and therefore the said treatments are mostly used as finish of prior mechanical abrasion methods.
- [0014] In addition, there exists galvanic methods in which the metal parts to be treated are immerged in an electrolyte liquid containing solid bodies ( particles) that freely move within it.
- [0015] The electrolytes developed for the said methods produce anodic layers thicker than in the case of the galvanic methods without particles, so that when the particles contained mechanically interactwith the anodic layer, a up to one-millimetre effective smoothing occurs on the roughness.
- [0016] However, as well in one case as in the other, the galvanic methods used up to now produce, in many cases, defects in the shape of pinholes or of stepped surfaces related to the structure and crystalline composition of the metal to be treated, their use remaining, in many cases, restrained to parts that, because of their composition (alloy) and moulding treatment and forming, empirically proved that they can be treated without showing the said defects in an unacceptable way.“
- Übersetzt:
- „[0011] Ebenso sind Poliersysteme durch galvanische Behandlung bekannt, bei denen die zu behandelnden Metallteile eine Elektrolytflüssigkeit und ohne Festkörper als Anoden getaucht werden, bekannt als Elektropolitur. […]
- [0013] Allerdings ist der Glättungseffekt bei Rauheiten von wenigen Mikrometern in vielen Fällen unzureichend und daher wird die besagte Behandlung meist als Finish eines vorhergehenden mechanischen Glättungsverfahrens eingesetzt.
- [0014] Außerdem existieren galvanische Verfahren, bei denen die zu behandelnden Metallteile in eine Elektrolytflüssigkeit getaucht werden, die Festkörper (Teilchen) enthält, welche sich frei darin bewegen.
- [0015] Die für dieses Verfahren entwickelten Elektrolyte erzeugen eine dickere Anodenschicht als die galvanischen Verfahren ohne Teilchen, so dass, wenn die darin enthaltenen Teilchen mechanisch interagieren, ein effizientes Glätten von Rauheiten von bis zu einem Millimeter bewirkt wird.
- [0016] In beiden Fällen gleichermaßen erzeugen die bisher angewendeten galvanischen Verfahren in vielen Fällen Defekte in Form von kleinen Löchern oder eingestuften Oberflächen betreffend die Struktur und die kristalline Zusammensetzung des zu behandelnden Metalls, weshalb ihre Verwendung in vielen Fällen auf Teile beschränkt ist, bei denen empirisch gesichert ist, dass sie durch ihre Zusammensetzung (Legierung) und Form- und Formgebungsbehandlung behandelt werden können, ohne die benannten Defekte in inakzeptabler Weise zu zeigen.“
- Das Klagepatent beschreibt also Verfahren, bei denen das Werkstück in eine Elektrolytflüssigkeit mit oder ohne Festkörper eingetaucht wird. Diese weisen den Nachteil auf, dass sie zu Defekten am Werkstück führen, die nur in bestimmten Fällen überhaupt akzeptabel sind und in anderen Fällen die Verwendung entsprechender galvanischer Methoden zum Glätten und Polieren ausschließen. Gerade die Überwindung dieser Nachteile galvanischer Bearbeitungsmethoden ist Aufgabe der klagepatentgemäßen Lehre (vgl. Abs. [0017]).
- Diesen im Stand der Technik vorbekannten Bearbeitungsmethoden stellt das Klagepatent eine Bearbeitungsmethode gegenüber, bei der das Werkstück gerade nicht in eine Elektrolytflüssigkeit eingetaucht ist, sondern mit Festkörpern gerieben wird.
So heißt es in im Klagepatent: - „[0021] Concretely, what the invention proposes, as it was stated above, is, on the one hand, the method for smoothing and polishing metal parts, for example metal parts for dental prostheses, but without this means a limitation, based on the ion transport that, in an innovating way, is carried out with free solid bodies (particles) that are electrically conductive in a gaseous environment and, on the other hand, the said solid bodies, consisting of particles having varied shapes with porosity and affinity to retain an amount of electrolyte liquid so that they have electrical conductivity.
- [0022] More specifically, the method of the invention provides the following steps:
– The metal parts to be treated are connected to the positive pole (anode) of a current generator.
– After they are secured, the metal parts to be treated are submitted to friction with a set of particles constituted by electrically conductive free solid bodies charged with negative electrical charge in a gaseous environment, for example air. - [0023] The friction of the metal parts with the particles can be carried out for example by means of a stream of particles impelled by gas or expelled from a centrifugal mechanism or by means of a system with brushes, winders or any other suitable impelling element capable to move and press the particles on the surface of the part.“
- Übersetzt:
- „[0021] Konkret schlägt die Erfindung, wie bereits erwähnt, einerseits ein Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallteilen, z.B. von Metallteilen für Zahnersatz, vor, ohne dass dies eine Beschränkung bedeutet, basierend auf dem Ionentransfer, der in neuartiger Weise mittels freier Festkörper (Teilchen) durchgeführt wird, die elektrisch leitfähig sind, in einer gasförmigen Umgebung, und andererseits die besagten Festkörper, bestehend aus Teilchen von verschiedener Form mit einer Porosität und Affinität, eine Menge an flüssigem Elektrolyt zu speichern, so dass sie eine elektrische Leitfähigkeit haben.
- [0022] Im Detail weist das erfindungsgemäße Verfahren zwei Schritte auf: die zu behandelnden Metallteile sind mit dem positiven Pol (Anode) eines Stromerzeugers verbunden. Nachdem sie befestigt sind, werden die zu behandelnden Metallteile Reibung mit einem Satz von Teilchen ausgesetzt, die durch elektrisch leitfähige freie Festkörper gebildet sind, die mit negativer elektrischer Energie geladen sind und sich in gasförmiger Umgebung, beispielsweise Luft, befinden.
- [0023] Die Reibung der Metallteile mit den Teilchen kann beispielsweise durch einen Teilchenstrom erfolgen, der durch Gas angetrieben oder von einem Zentrifugalmechanismus ausgestoßen wird, oder durch ein System mit Bürsten, Wicklern oder einem anderen geeigneten Antriebselement, das in der Lage ist, die Teilchen zu bewegen und auf die Oberfläche des Teils zu drücken.“
- Das Klagepatent beschreibt damit die Bearbeitung des Werkstücks gerade dadurch, dass dieses einer Reibung mit freien Festkörpern ausgesetzt wird, die sich in einer gasförmigen Umgebung befinden, also gerade nicht, wie im Stand der Technik vorbekannt, in einer Elektrolytflüssigkeit schwimmen. Als entscheidend stellt das Klagepatent hier auf die Reibung der Teilchen, also der Festkörper, mit dem metallischen Werkstück ab. Wesentlich ist, dass die Teilchen bewegt und auf die Oberfläche des Werkstücks gepresst werden (Abs. [0023]: „The friction of the metal parts with the particles can be carried out for example by […] or any other suitable impelling element capable to move and press the particles on the surface of the part.“). Dadurch wird in technisch-funktionaler Hinsicht offenkundig, dass es dem Klagepatent auf den Abtrag am Werkstück gerade durch die freien Festkörper ankommt.
In diesen technischen Zusammenhang fügt sich auch Abs. [0027] des Klagepatents ein, wo es heißt: - „It shall be pointed out that the amount of electrolyte liquid retained by the particles is always below the saturation level so that it is expressly avoided to leave free liquid on the surface of the particles.“
- Übersetzt:
- „Es soll betont werden, dass die Menge an flüssigem Elektrolyt, das durch die Teilchen aufgenommen wird, stets unterhalb der Sättigungsgrenze liegt, so dass ausdrücklich vermieden wird, dass freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen verbleibt.“
- Das Klagepatent verlangt also hinsichtlich der Elektrolytflüssigkeit, welche die elektrische Leitfähigkeit der freien Festkörper herstellt, dass ihre Menge stets unterhalb des Sättigungslevels verbleibt, so dass es nicht zu freier Flüssigkeit auf den Teilchen kommt.
Hierbei erkennt der Fachmann den technischen Zusammenhang zwischen dieser Anforderung der klagepatentgemäßen Lehre mit ihrem Ziel, eine Reibung des Werkstücks ausschließlich mit Festkörpern und in Abgrenzung zum vorbekannten Stand der Technik gerade nicht mit einer Flüssigkeit, in welcher Teilchen schwimmen und sich das Werkstück bewegt, zu erreichen. Bestätigt wird dieses Verständnis durch den folgenden Abs. [0029], wo es heißt: - „This way, the particles, when they rub the metal parts to be polished, very accurately determine the embossed areas where the removal of metal occurs in an ionic form.“
- Übersetzt:
- „So bestimmen die Partikel beim Reiben der Teile während des Polierens sehr genau die hervorgehobenen Bereiche, in denen ionisch die Metallentfernung erzeugt wird.“
- Dass die Sättigungsgrenze der Festkörper nicht überschritten wird, dient nach der klagepatentgemäßen Lehre dazu, sicherzustellen, dass diese und nur diese am Werkstück gerieben werden. Ein Ionentransport am Werkstück soll nur punktuell durch die Festkörper und nicht ganzflächig durch eine Flüssigkeit erfolgen.
Der klagepatentgemäßen Lehre kommt es in technisch funktionaler Hinsicht darauf an, dass der Ionenabtransport am Werkstück mittels freier Festkörper erfolgt. Für einen restlichen Transport der Ionen hin zum negativen Pol eines Stromerzeugers ist es für die Lehre des Klagepatents hingegen nicht entscheidend, wie dieser Transport erfolgt. Die klagepatentgemäße Lehre trifft insoweit keine Vorgabe, sondern überlässt die Ausgestaltung insoweit dem Fachmann.
Es handelt sich hierbei auch nicht, anders als die Beklagte meint, um die künstliche Aufspaltung eines einheitlichen Vorgangs. Vielmehr stellt die klagepatentgemäße Lehre in Merkmalsgruppe 2 auf den unmittelbaren Kontakt der Festkörper mit den zu bearbeitenden Metallstücken ab („Reiben der Metallteile (1) mit einem Satz von Teilchen (4)“). - b.
Das Verfahren gemäß Merkmal 1 umfasst sämtliche zur Erreichung des Verfahrenszwecks, also des Glättens und Polierens des Werkstückes, notwendigen Verfahrensschritte, also auch den Ionenabtransport vom Werkstück bis zum negativen Pol des Stromerzeugers. Der Begriff des Verfahrens ist insoweit als umfassende Beschreibung aller Schritte hin zum Politurerfolg zu verstehen. Dies ergibt sich auch bereits aus der sprachlichen Struktur des Anspruchs 1, der ein „Verfahren“ beansprucht, das einen näher in Merkmalsgruppe 2 beschriebenen Schritt „umfasst“. Dieses Auslegungsergebnis ist auch zuletzt zwischen den Parteien nicht mehr streitig.
Von der Frage des Umfangs des Verfahrens zu trennen ist aber die Frage, ob der ganze Ionentransport über freie Festkörper erfolgen muss. Dies ist, wie vorstehend geschildert, nicht der Fall. - c.
Freie Festkörper („free solid bodies“) im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre sind solche, die hinsichtlich ihrer Position zueinander und zum Werkstück beweglich sind.
Dies folgt zum einen aus dem vorbekannten Stand der Technik. So wird in Abs. [0014] davon gesprochen, dass bei vorbekannten galvanischen Polierverfahren, bei denen sich Partikel in einer Flüssigkeit bewegen, eine freie Bewegung dieser Partikel möglich ist („an electrolyte liquid containing solid bodies (particles) that freely move within it“). Durch die Interaktion der Teilchen mit dem Werkstück wird, Abs. [0015], ein technischer Effekt, nämlich ein größerer Glättungseffekt, erzielt. Die klagepatentgemäße Lehre zielt darauf ab, einen Abtrag lediglich durch den punktuellen Kontakt mit den Teilchen (und eben nicht durch permanenten Kontakt mit Elektrolytflüssigkeit) zu erzielen, eine anderes Verständnis von einer freien Bewegung der Partikel ist aber nicht ersichtlich.
Ein ebensolches Verständnis folgt aus den Figuren 1, 4 und 5 der klagepatentgemäßen Lehre. Diese zeigen jeweils ein zu bearbeitendes Metallteil (1), welches sich in einem Behältnis (3) befindet. Ebenso in dem Behältnis befinden sich die freien Festkörper (4), welche, wie die Gegenüberstellung der verschiedenen Figuren zeigt, jeweils ihre Position zueinander und zum Metallteil ändern. Bei der Darstellung handelt es sich ersichtlich um eine schematische. Die folgt zum einen bereits aus der Beschreibung der Figuren, vgl. Abs. [0053]. Zudem wäre andernfalls nicht erklärlich, warum die Teilchen in dem Behältnis schweben sollen. Auch die Größe der Teilchen in Relation zu den Metallteilen spricht für dieses Verständnis. Die Bezeichnung des freien Mediums zwischen den Teilchen als Raum der interstitiellen Umgebung (5) deutet einerseits darauf hin, dass die Teilchen sich nach der klagepatentgemäßen Lehre berühren und berühren dürfen und bestätigt zum anderen wiederum das Verständnis der Darstellung als lediglich schematische.
Dass sich die Teilchen gegenseitig berühren können und dies einer Zuschreibung als „frei“ im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre nicht entgegensteht, ist deshalb zurecht zwischen den Parteien zuletzt nicht mehr streitig.
Dieses Verständnis wird durch mehrere Beschreibungsstellen bestätigt, welche sich mit Positionswechseln der Teilchen insbesondere in Bezug auf die zu bearbeitenden Metallteile beschäftigen.
So führt Abs. [0043] aus: - „[0043] Thus, forexample, forspherical particles having diameters ranging from 0.3 to 0.8 mm and average tangential speed of the set of particles with respect to the metal parts to be polished of the order of 1 to 3 m/sec, it is obtained at mm² scale, that means, on each square millimetre of the exposed surface of the metal parts to be treated, a specular finish with little roughness of a few nanometres. The said spherical particles are preferably of a sulfonated styrene-divinyl benzene copolymer and with a microporous structure.“
- Übersetzt:
- „[0043] Somit wird z. B. für sphärische Partikel, deren Durchmesser zwischen 0,3 und 0,8 mm beträgt, und wobei die durchschnittliche Tangentialgeschwindigkeit des Satzes von Partikeln bezüglich der zu polierenden Teile zwischen 1 und 3 m/s beträgt, bei einer Skala von mm2, d. h. für jeden Quadratmillimeter der ausgesetzten Oberfläche der zu behandelnden Teile, ein beeindruckendes Finish mit einer Rauheit von wenigen Nanometern erhalten. Die sphärischen Partikel sind vorzugsweise ein sulfoniertes Styrol-Divinylbenzol Copolymer und haben eine makroporöse [so die Übersetzung K3_Ü, zutreffend wohl „mikroporöse“] Struktur.“
- Das Klagepatent lehrt also für eine bestimmte Teilchenbeschaffenheit und eine durchschnittliche Geschwindigkeit relativ in bestimmter Art und Weise zu den Metallteilen, dass eine bestimmte, vorteilhafte Oberflächenbeschaffenheit erreicht wird. Das Klagepatent nimmt hier die Bewegung der Teilchen relativ zu den Metallteilen in den Blick. Gleiches gilt für Abs. [0046] („average of tangential speed“) und Abs. [0048] („the local average tangential speed of the particles“). In Abs. [0045] und Abs. [0049] ff. erörtert das Klagepatent, dass die Dauer des jeweiligen Kontakts des Teilchens mit den Metallteilen sowie die Häufigkeit des Kontaktes bezogen auf Zeit und Fläche Auswirkungen auf den Materialabtrag an den zu bearbeitenden Metallteilen hat. Das Klagepatent lehrt den Fachmann also an zahlreichen Stellen, dass die Bewegung der Teilchen sowie das Zusammentreffen der Teilchen wesentlich für den Erfolg der klagepatentgemäßen Lehre sind. In diesem technisch-funktionalen Zusammenhang deutet der Fachmann die Beschreibung der Teilchen als „frei“.
Adhäsive Klebekräfte stehen hingegen der Eigenschaft als freie Festkörper nicht entgegen, solange die Teilchen die oben geschilderten Anforderungen noch erfüllen können. Dies gilt auch für die von der Beklagten geschilderte „Sandklebrigkeit“. Dass nur ein leichtes, wechselseitiges Lösen der Teilchen konstitutiv die Eigenschaft von Teilchen als frei begründet, lässt sich der Lehre des Klagepatents nicht entnehmen. Vielmehr spricht die Abgrenzung zum beschriebenen Stand der Technik, wo sich Partikel in einer Flüssigkeit bewegen und als frei beweglich beschrieben werden, dafür, dass keine vollständig äußerlich trockenen Teilchen erforderlich sind. - 2.
Die Merkmalsgruppe 2.2 gestaltet die freien Festkörper und den Vorgang des Reibens dieser mit den Metallteilen näher aus. Nach Merkmal 2.2.3 müssen die Teilchen in einer gasförmigen Umgebung mit den Metallteilen gerieben werden, wobei eine gasförmige Umgebung den Raum zwischen den jeweiligen Teilchen meint (hierzu a.). Weiter darf sich gemäß Merkmal 2.2.1 keine freie Flüssigkeit auf der Oberfläche der Teilchen befinden. Freie Flüssigkeit in diesem Sinne ist zum einen nur Flüssigkeit, die sich in dem Bereich befindet, in welchem Teilchen mit den Metallteilen gerieben werden. Zum anderen ist freie Flüssigkeit nur eine Flüssigkeit, die unabhängig von einer Berührung der Teilchen mit den Metallteilen in Kontakt kommt, was bei einer Flüssigkeit, die auf der Oberfläche der Teilchen anhaftet, nicht der Fall ist (hierzu b.). - a.
Die Teilchen müssen in einer gasförmigen Umgebung mit den Metallteilen gerieben werden.
Bereits sprachlich folgt aus dem Wortlaut des Merkmals 2.2.3, dass es auf eine Reibung der Metallteile mit den Teilchen in einer gasförmigen Umgebung ankommt, keinesfalls trifft der Begriff der Gasförmigkeit aber eine Aussage über die Umgebung aller möglichen am Verfahren beteiligten Teilchen. Sprachlich bezieht sich das Merkmal 2.2.3 auf die Merkmale 2.1 und 2.2, also um ein „Reiben der Metallteile (1) mit einem Satz von Teilchen (4) […] in einer gasförmigen Umgebung“.
Eine gasförmige Umgebung im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre liegt dabei dann vor, wenn die Zwischenräume zwischen den Teilchen mit einem Gas und nicht etwa mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, so dass eine elektrochemische Reaktion nur bei Berührung mit den jeweiligen Teilchen, nicht aber bei Berührung mit demjenigen Stoff, der die Zwischenräume zwischen den Teilchen ausfüllt, erfolgt. Die klagepatentgemäße Lehre grenzt sich hierbei von vorbekannten Verfahren der galvanischen Behandlung ab, bei denen sich Teilchen frei in einer Elektrolytflüssigkeit bewegen und es auch bei der Berührung der Flüssigkeit mit den Metallteilen zu einer entsprechenden Reaktion (mit den im Stand der Technik gegebenen Nachteilen, siehe Abs. [0016]) kommt.
Dieses Verständnis findet der Fachmann durch die Figuren 1, 4 und 5 bestätigt. Diese stellen schematische Darstellungen bestimmter Anordnungen bei der Durchführung eines klagepatentgemäßen Verfahrens dar. Der freie Raum um die Teilchen (4) ist dabei mit dem Bezugszeichen (5) versehen. - Dabei beschreibt das Klagepatent diesen Raum wie folgt:
- „[0055] The metal parts 1 thus secured and with the mentioned orbital and of alternative linear displacement motion disabled, are introduced, by the top, in a receptacle 3 of the device that contains a set of electrically conductive particles 4 and the air or any other gas occupying the space 5 of its interstitial environment existing between them, so that the metal parts 1 remain fully covered by the said set of particles 4.“
- Übersetzt:
- „[0055] Die derart befestigten Metallteile 1, bei denen die erwähnten kreisförmigen und alternativ linearen Bewegungen nicht möglich sind, werden von oben in ein Behältnis 3 der Vorrichtung eingeführt, das einen Satz elektrisch leitfähiger Teilchen 4 und Luft oder irgendein anderes Gas enthält, welches den Raum 5 der interstitiellen Umgebung, die zwischen ihnen herrscht, einnimmt, sodass die Metallteile 1 durch den besagten Satz an Teilchen 4 vollständig bedeckt bleibt.“
- Das Klagepatent trifft also hinsichtlich der Figuren 1, 4 und 5 die ausdrückliche Definition des Raumes um die Teilchen als interstitielle Zwischenräume. Diese müssen derart mit Gas gefüllt sein, dass die Nachteile des im Stand der Technik bekannten Verfahrens, in welchem die Teilchen in Elektrolytflüssigkeit schwimmen, nicht eintreten.
Weiter bestätigt wird dieses Verständnis durch den Unteranspruch 7, welcher auszugsweise lautet: „dadurch gekennzeichnet, dass die gashaltige Umgebung, die einen interstitiellen Platz (5) einnimmt, der zwischen den Teilchen (4) in dem Behältnis (3) existiert, Luft ist“ / „characterized in that the gaseous environment occupying an interstitial space (5) existing between the particles (4) within the receptable (3) is air“.
Die dortige Formulierung konkretisiert die gasförmige Umgebung und gibt insoweit einen weiteren Anhaltspunkt für das sprachliche Verständnis der klagepatentgemäßen Lehre von der gashaltigen Umgebung als interstitiellen Raum.
Dem steht Abs. [0046] des Klagepatents nicht entgegen, wo es heißt: - „[0046] It is also very important to bear in mind that the method of the invention allows to adjust the parameters of all the elements that intervene, that means, voltage, average of tangential speed, content of electrolyte liquid, conductivity and chemical composition of the said electrolyte liquid, percentage ratio between particles and surrounding gas.“
- Übersetzt:
- „[0046] Es ist außerdem sehr wichtig zu berücksichtigen, dass das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt, die Parameter aller mitwirkender Elemente anzupassen, d. h. Spannung, durchschnittliche Tangentialgeschwindigkeit, Inhalt von Elektrolytflüssigkeit, Leitfähigkeit und chemische Zusammensetzung besagter Elektrolytflüssigkeit, prozentuales Verhältnis zwischen Teilchen und umgebendem Gas.“
- Zwar wird, wie die Klägerin zutreffend hervorhebt, geschildert, dass das Verhältnis zwischen Teilchen und Gas variabel sein kann. Ebenso kann der Inhalt der Elektrolytflüssigkeit variabel sein. Dies bedeutet nicht, dass ein Teil der interstitiellen Zwischenräume mit Flüssigkeit gefüllt sein darf. Vielmehr gibt das Klagepatent dem Fachmann in Abs. [0027] die Anweisung, dass die Menge an Elektrolytflüssigkeit stets unterhalb des Sättigungslevels der Teilchen liegen muss. Vor diesen Hintergrund ist aus Abs. [0046] allenfalls zu folgern, dass, etwa durch die Wahl unterschiedlicher Teilchengrößen, das Verhältnis zwischen Teilchen und Gas variabel ist, aber keinesfalls Flüssigkeit die interstitiellen Zwischenräume ausfüllen soll. Dies wird, wie die Beklagte zu recht anführt, dadurch bestätigt, dass der vorstehende Abs. [0046] kein prozentuales Verhältnis für Flüssigkeit nennt.
Dem Argument der Klägerin, das bereits das Anlegen von Spannung an einen Satz von Teilchen Gas freisetze und zu einer gasförmigen Umgebung führe, ist nicht beizutreten. Hiergegen spricht bereits die Abgrenzung der klagepatentgemäßen Lehre vom vorbekannten Stand der Technik. In Elektrolytflüssigkeit schwimmende Teilchen waren vorbekannt, wobei eine Spannung angelegt wurde. Die klagepatentgemäße Lehre grenzt sich hiervon gerade auch durch das Erfordernis einer gasförmigen Umgebung ab. Zudem ist nicht ersichtlich, dass freigesetztes Gas zu einer (vollständig) gasförmigen Umgebung und nicht lediglich zu einem Gemisch aus Gas und Flüssigkeit im Übrigen führen würde.
Abschließend ist allerdings der Zusammenhang mit Merkmal 2.2.1 zu beachten. Eine gasförmige Umgebung liegt auch noch dann vor, wenn an den Teilchen Flüssigkeit anhaftet, die aufgrund adhäsiver Wirkungen indes am Teilchen verbleibt und sich nicht frei bewegt (hierzu unten unter b.). Denn in technisch-funktionaler Hinsicht soll die gasförmige Umgebung nach der Lehre des Klagepatents gerade in Abgrenzung zum vorbekannten Stand der Technik ausschließen, dass ein Ionenabtrag auch dann erfolgt, wenn kein Teilchen die Metallstücke berührt.
Keine Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre liegt hingegen dann vor, wenn das Werkstück in flüssiger Umgebung bearbeitet wird, d.h. Kontakt des Werkstückes mit unabhängig von den Teilchen beweglicher und nicht ausschließlich an diesen anhaftender oder in die Teilchen aufgenommener Flüssigkeit besteht. - b.
An der Oberfläche der Teilchen darf keine freie Flüssigkeit vorhanden sein.
Die sprachliche Bezugnahme „die“ am Beginn des Merkmals 2.2.1 stellt klar, dass Bezugspunkt die jeweiligen Teilchen sind, die in ihrer Gesamtheit einen Satz bilden. Bezugspunkt für den Satz von Teilchen ist wiederum die Menge der Teilchen, die gemäß Merkmal 2.1 mit den Metallteilen gerieben werden.
Unter Flüssigkeit ist dabei jede Elektrolytflüssigkeit zu verstehen. Dies ergibt sich einerseits aus dem Wortlaut des Merkmal 2.2.1. Die Ausführungen zur Flüssigkeit („liquid“) sind auf den vorstehenden Satzteil bezogen, wo die Aufnahme von Elektrolytflüssigkeit („liquid electrolyte“) in die Festkörper thematisiert wird. Bestätigt wird dieses Verständnis in technisch-funktionaler Hinsicht dadurch, dass nur eine leitfähige Flüssigkeit die elektrochemischen Reaktionen am Werkstück hervorruft, die die klagepatentgemäße Lehre gerade vermeiden will. Dabei ist der Begriff der Elektrolytflüssigkeit im Klagepatent allerdings nicht näher definiert. Abzustellen ist deswegen auf die technisch-funktional maßgebliche Leitfähigkeit. Sofern sich also etwa nicht leitfähige Flüssigkeit mit vorhandener Elektrolytflüssigkeit mischt, so dass ein insgesamt leitfähiges Gemisch vorliegt, handelt es sich insoweit insgesamt um Elektrolytflüssigkeit.
Das Klagepatent definiert den Begriff der freien Flüssigkeit nicht näher.
Zwar sind vom Klagepatent identisch verwendete Begrifflichkeiten auch grundsätzlich gleich auszulegen. Das Klagepatent spricht an anderer Stelle von freien Festkörpern. Aufgrund der unterschiedlichen Bezugselemente und ihrer jeweiligen physikalischen Verschiedenheit, einmal Festkörper, einmal eine Flüssigkeit, kommt ein identisches Verständnis nicht in Betracht. Die gleiche Wortwahl leitet allerdings in die Richtung, dass der Begriff der freien Flüssigkeit auch auf die Beweglichkeit der Flüssigkeit abzielt.
Bestätigt wird dieses Ergebnis durch technisch-funktionale Erwägungen. Der im Stand der Technik vorhandene Nachteil der Verwendung von Elektrolytflüssigkeit, nämlich der dauerhafte und unkontrollierte Kontakt mit dem Werkstück, soll von der klagepatentgemäßen Lehre überwunden werden. In technisch funktionaler Hinsicht ist deshalb maßgeblich, dass keine Flüssigkeit unabhängig von den Teilchen in Kontakt mit dem Werkstück kommt.
Bestätigt wird dieses Verständnis durch die Beschreibung des Klagepatents. Abs. [0033] führt aus: - „[0033] In this case, the particle that contacts the part expels a given amount of electrolyte liquid making wet the area of the surface of the part and exercising an electro-erosion effect.“
- Übersetzt:
- „[0033] In diesem Fall stößt das Teilchen, das das Teil berührt, eine gewisse Menge an Elektrolytflüssigkeit aus und befeuchtet so die Fläche des Teils und bewirkt so eine Elektroerosion.“
- In bestimmten Fällen stößt das Teilchen, welches in Kontakt mit dem Werkstück tritt, eine bestimmte Menge von Elektrolytflüssigkeit aus, die zu einem (erwünschten) elektro-korrosiven Effekt führt. Der klagepatentgemäßen Lehre kommt es demnach darauf an, einen unerwünschten Kontakt der Elektrolytflüssigkeit zu vermeiden, dort aber, wo konkret eine Berührung eines Teilchens stattfindet, ist ein punktueller Kontakt mit Elektrolytflüssigkeit erwünscht. Hieraus ist zu folgern, dass an der Oberfläche eines Teilchens befindliche Elektrolyt-Flüssigkeit, die sich nicht von diesem löst, nicht frei im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre ist.
Dieses Verständnis wird dadurch bestätigt, dass das Klagepatent in Merkmal 2.1 vom Reiben spricht. Beim Reiben tritt aber, wie in vorstehender Beschreibungsstelle des Klagepatents geschildert, punktuell Flüssigkeit aus den Teilchen aus und führt zu einem erwünschten Effekt. Diese ausgestoßene Flüssigkeit versteht das Klagepatent demnach nicht als freie Flüssigkeit.
V.
Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht in Kombination mit den von der Beklagten vertriebenen F, d.h. der angegriffenen Ausführungsform F, und entsprechender Elektrolytflüssigkeit bei Benutzung durch die Abnehmer der Beklagten alle Merkmale des Anspruchs 1 der klagepatentgemäßen Lehre. Ebenfalls verwirklicht die durch die Beklagte vertriebene angegriffene Ausführungsform bei bestimmungsgemäßer Befüllung durch Fs alle Merkmale des Anspruchs 8 der klagepatentgemäßen Lehre. - 1.
Die Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform ist zwischen den Parteien im Wesentlichen unstreitig. Lediglich über das Vorhandensein von Flüssigkeit in den interstitiellen Zwischenräumen der Teilchen, wenn diese gemäß den Vorgaben der Beklagten mit Elektrolytflüssigkeit gemischt werden, besteht zwischen den Parteien Uneinigkeit. Der Vortrag der Klägerin wird dabei durch die von ihr durchgeführten Untersuchungen gestützt. - Die Klägerin trägt vor, nachdem sie mit der Replik erneut Abbildungen von ihr angestellten Untersuchungen vorgelegt hat, dass nach Vermischen der angegriffenen Ausführungsform F mit der Elektrolytflüssigkeit G nach den Vorgaben der Beklagten in dem Gemisch keine Flüssigkeit vorhanden sei, die nicht an die Oberfläche der beteiligten Teilchen gebunden wäre. Die Zwischenräume zwischen den Teilchen seien mit Luft gefüllt. Sie verweist hierzu unter anderem auf die bereits im Tatbestand wiedergegebene, teilweise stark vergrößerte Aufnahme der Teilchen.
- 2.
Die solcherart beschaffene angegriffene Ausführungsform verwirklicht, wenn der Abnehmer der Beklagten diese mit den ebenfalls vertriebenen F und entsprechendem Elektrolyt in Kontakt bringt, alle Merkmale des Anspruchs 1, wenn ein entsprechendes Verfahren durchgeführt wird. - Die angegriffene Ausführungsform führt ein Verfahren gemäß Anspruch 1 aus. Insbesondere kommt es hierfür nicht darauf an, dass auch der Abtransport der Ionen ausschließlich über freie Festkörper erfolgt, soweit nicht der Bereich der Festkörper betroffen ist, in welchem das Reiben der Metallteile erfolgt.
- Der Ionentransport erfolgt auch über freie Festkörper. Die einzelnen Partikel können sich zueinander und in Relation zu den zu bearbeitenden Metallteilen frei bewegen. Eine gewisse „Klebrigkeit“, die möglicherweise aufgrund von Flüssigkeit, die nicht frei im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre ist, sondern auf der Oberfläche der Festkörper haftet, steht einer Positionsveränderung der Teilchen nicht entgegen. Damit steht die von der Beklagten vorgetragene „schlammartige“ Konsistenz einer Verletzung nicht entgegen. Durch das Reiben nach Merkmal 2.1 wirkt eine Kraft auf die Teilchen. Dass unter Einfluss dieser Kraft ein Positionswechsel möglich ist, ist ausreichend.
- Die an der Oberfläche der Teilchen gebundene Flüssigkeit ist keine freie Flüssigkeit im Sinne der klagepatentgemäßen Lehre. Hiermit im Zusammenhang steht, dass die Räume zwischen den Festkörpern in dem Bereich, in welchem das Reiben der Festkörper mit den Metallteilen erfolgt, in einer gasförmigen Umgebung erfolgt. Die interstitiellen Zwischenräume sind mit Luft gefüllt, wie aus nachfolgender, bereits im Tatbestand wiedergegebener, Abbildung ersichtlich ist.
- Damit sind die Merkmale 2.2.1 und 2.2.3 verwirklicht.
- Die Beklagte hat demgegenüber einen „Abtropftest“ durchgeführt, bei dem sie ein Gemisch aus der angegriffenen Ausführungsform F und der Elektrolytflüssigkeit G hergestellt und dieses in einer verschlossenen Plastiktüte mit der Öffnung nach unten über einem Behältnis aufgehängt hat. Über einen gewissen Zeitverlauf tropfte sodann eine gewisse Menge Flüssigkeit ab (vgl. Klageerwiderung vom 04. September 2023, S. 21 ff. = Bl. 117 ff. d.A.). Dies zeige, nach Ansicht der Beklagten, dass freie Flüssigkeit vorhanden und die Lehre des Klagepatents nicht verwirklicht sei.
- Dieser Test ist, selbst wenn man ein entsprechendes Abtropfen als zutreffend unterstellt, nicht geeignet, die Aussagekraft der von der Klägerin vorgelegten Bilder und Mikroskopaufnahmen zu entkräften. Die von der Beklagten vorgelegten Bilder und Videoaufnahmen zeigen, dass lediglich eine sehr geringe Menge im Verhältnis zu den verwendeten Fs und der ursprünglich eingefüllten Menge an Elektrolytflüssigkeit abtropft. Die abtropfende Flüssigkeit würde sich aufgrund der Schwerkraft allenfalls am Boden des Behältnisses befinden, nicht aber in dem Bereich, in welchem das Reiben erfolgt. Zudem sind die Teilchen bei der Ausführung des Verfahrens in ständiger Bewegung. Auch insoweit besteht ein erheblicher Unterschied zu dem von der Beklagten vorgenommenen Aufbau zur Demonstration des Abtropfens, bei dem die Masse über längere Zeit still ruht. Der Abtropftest allein ist deshalb nicht ausreichend, den Vortrag der Klägerin erheblich zu bestreiten und eine Patentverletzung zu widerlegen.
- Die Beklagte hat auch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, insbesondere auf die erneuten Untersuchungen der Klägerin in der Replik, keinerlei eigene Aufnahmen oder Testergebnisse zum Flüssigkeitsstand in der Masse der Festkörper vorgelegt. Sie hat sich vielmehr auf den von ihr durchgeführten – aus den oben dargestellten Gründen nicht ausreichenden – Abtropftest zurückgezogen.
- Hieran kann auch der Vortrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung, dass sich das Werkstück in der unteren Hälfte des Behältnisses befinde, wo sich Flüssigkeit ansammele, sowie dass die Verhältnisse im Behältnis dem Zustand des Becherglases im Bild aus der Replik S. 31 (oben schon wiedergegeben) entsprechen, nichts ändern. Aus vorstehend genanntem Bild ist allenfalls ersichtlich, dass keine Flüssigkeit zwischen den Teilchen vorhanden ist, wie auch in der Darstellung der drei vergrößerten Kreise im unteren Teil des Bildes ersichtlich wird. In der oberen Darstellung des Becherglases ist keine stehende Flüssigkeit, sondern allenfalls eine sandartige Masse aus Teilchen, erkennbar.
- Die Beklagte hat in ihrem Schriftsatz vom 21. Mai 2024, der auch nachgelassenen Vortrag zum von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag zu II.1 enthält und allein insoweit nachgelassen war, vertiefend zur Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform und zu eigenen Untersuchungen vorgetragen. Der entsprechende Vortrag war indes nicht nachgelassen, da er sich auf die zwischen den Parteien bereits umfassend erörterte Patentverletzung dem Grunde nach bezieht, nicht aber auf die Frage eines Schlechthinverbots der angegriffenen Ausführungsform, welches alleinige Abweichung des Hilfsantrags zu II.1. zum ursprünglich zur Entscheidung gestellten Hauptantrag zu II.1. ist. Vom Schriftsatzrecht nach § 283 ZPO umfasst ist nur Vorbringen, welches sich als Erwiderung auf den nicht rechtzeitig vor dem Termin mitgeteilten Vortrag darstellt (BGH NJW 2018, 1686, 1687 Rn. 22 ff.; BeckOK ZPO/Bacher, 52. Ed. 1.3.2024, ZPO § 283 Rn. 19). Die Kammer sieht sich deshalb daran gehindert, den entsprechenden Sachvortrag zu berücksichtigen, § 296a S. 1 ZPO. Auf Fragen des Verspätungsrechts kommt es insoweit nicht an. Eine Wiedereröffnung der Verhandlung war nicht geboten, § 156 ZPO. Es ist nicht ersichtlich, dass der entsprechende Vortrag durch den neu gestellten Hilfsantrag veranlasst wurde.
- Die Verwirklichung der übrigen Merkmale 1.1, 2, 2.1, 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.5 ist unstreitig.
- 3.
Damit ist eine unmittelbare Verletzung des Anspruchs 8 gegeben. Die Parteien streiten lediglich über die oben zu Anspruch 1 diskutierten Merkmale. Das Vorliegen sämtlicher konstruktiver Merkmale der angegriffenen Ausführungsform und die Verwirklichung des Anspruchs 8 der klagepatentgemäßen Lehre insoweit ist unstreitig. - Zwar muss das Behältnis gemäß Merkmal 2.2.1 des Anspruchs 8 Teilchen enthalten, die erst vom Abnehmer der Beklagten vor Inbetriebnahme der Vorrichtung eingefüllt werden. Der Beklagten ist, da sie auch die Teilchen vertreibt und ihre Kunden entsprechend anleitet, das Handeln ihrer Abnehmer insoweit zuzurechnen.
VI.
Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein privates Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG berufen. - 1.
Nach § 12 Abs. 1 PatG tritt die Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.
Das Vorbenutzungsrecht setzt voraus, dass der Vorbenutzungsberechtigte einerseits im Prioritätszeitpunkt bereits selbstständigen Erfindungsbesitz hatte, andererseits, dass er diesen im Inland betätigt hat oder zumindest Veranstaltungen zu einer alsbaldigen Aufnahme der Benutzung des Erfindungsgegenstandes getroffen hat. Nicht erforderlich ist dagegen, dass es zu einer öffentlichen Vorbenutzung gekommen ist.
Die Beweislast für die Entstehungstatsachen und den Umfang des Vorbenutzungsrechts hat derjenige, der sich darauf beruft (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 90 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen), hier also die Beklagte. An den Nachweis eines Vorbenutzungsrechts sind strenge Anforderungen zu stellen, da erfahrungsgemäß nach Offenlegung brauchbarer Erfindungen häufig andere Personen behaupten, Entsprechendes schon vorher gemacht zu haben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 11. Januar 2007 – Az. I-2 U 65/05 –, Rn. 85 – Juris).
Der Erfindungsbesitz erfordert, dass die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH GRUR 2012, 895, 896 – Desmopressin). - 2.
Gemessen an diesem Maßstab hat die Beklagte keinen Erfindungsbesitz dargelegt. Es fehlt bereits an einer Darlegung der Merkmale 2.2.1 und 2.2.3 des Anspruchs 1 bzw. der Merkmale 2.2.2 und 2.2.4 des Anspruchs 8. - a.
Die Beklagte hat in verschiedenen Schriftsätzen zur Verwendung von Ionenaustauschharzen vorgetragen.
Zur Kombination mit einem Elektrolyt führt die Beklagte aus, die Mischung aus Fs und Flüssigkeit sei „weitgehend“ beibehalten worden (Duplik vom 18. März 2024, S: 41 = Bl. 236 d.A.), das Mischverhältnis sei stets derart beibehalten worden, dass die Mischung „die oben […] beschriebene, schlammartige Konsistenz hat, bei welcher Flüssigkeit, wie gezeigt […] abtropft“ (Duplik vom 18. März 2024, S: 41 f. = Bl. 236 f. d.A.). Als maßgeblicher Anstoßpunkt für den Wechsel hin zu diesen Harzen wird die Möglichkeit der Rückgewinnung von Edelmetallen genannt (Quadruplik vom 06. Mai 2024, S. 30 = Bl. 326 d.A.). Der Zusammenhang zur klagepatentgemäßen Lehre, die durch ein Reiben in gasförmiger Umgebung bestimmte Defekte am Werkstück vermeiden will, ist nicht ersichtlich. Zwar wird das Ionenaustauschharz als saugstark bezeichnet (Quadruplik vom 06. Mai 2024, S. 34 = Bl. 330 d.A.). Dass aber gerade ein Betrieb mit Elektrolytflüssigkeit unterhalb der Sättigungsgrenze vorgenommen oder auch nur beabsichtigt war, ist nicht dargetan. Die Beklagte hat keinerlei Mischverhältnis oder Feuchtigkeitskonsistenz der Teilchen dargelegt. - b.
Vorstehender Sachverhalt verwirklicht nicht alle Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre. Es fehlt jedenfalls an der Verwirklichung der Merkmale 2.2.1 und 2.2.3 des Anspruchs 1 bzw. der Merkmale 2.2.2 und 2.2.4 des Anspruchs 8.
Für das Vorliegen von Erfindungsbesitz muss es insoweit zu einer Erkenntnis gekommen sein, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre planmäßig und wiederholbar auszuführen.
Der Zusammenhang zur klagepatentgemäßen Lehre, die durch ein Reiben in gasförmiger Umgebung bestimmte Defekte am Werkstück vermeiden will, ist nicht ersichtlich. Zwar wird das Ionenaustauschharz als saugstark bezeichnet. Dass aber gerade ein Betrieb mit Elektrolytflüssigkeit unterhalb der Sättigungsgrenze vorgenommen oder auch nur beabsichtigt war, ist nicht dargetan. Hieran ändert nicht, dass die Beklagte pauschal vorträgt, die schlammartige Konsistenz sei stets ähnlich gewesen. Vielmehr müsste die Beklagte Erfindungsbesitz hinsichtlich eines Betriebs konkret unterhalb der Sättigungsgrenze, also ohne freie Elektrolyt-Flüssigkeit, vorgetragen haben. Eine „schlammartige“ Konsistenz als solche trifft keinerlei Aussage darüber, ob nach den Kriterien der klagepatentgemäßen Lehre freie Flüssigkeit in dem Bereich der Teilchen, in welchem eine Bearbeitung des Werkstücks erfolgt, vorhanden ist. Über das Vorhandensein von freier Flüssigkeit bei der von ihr ausgeführten oder vertriebenen Elektropolitur ist nichts bekannt.
Anhand des Beklagtenvortrags kann damit bereits nicht unter alle Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre subsumiert werden. Auf den näheren konstruktiven Aufbau der Maschinen kommt es damit vorliegend nicht mehr an.
VII.
Aus der mit Datum vom 16. März 2023 abgegebenen und von der Klägerin angenommenen Unterlassungsverpflichtungserklärung folgen keine weiteren Rechte der Klägerin. In ihren Rechtsfolgen geht sie nicht über die Bedeutung des Klagepatents hinaus. Ob die Erklärung die Geltendmachung eines Vorbenutzungsrechts durch die Beklagte ausschließt, bedarf nach dem vorstehend Ausgeführten keiner Entscheidung.
Der Bedeutungsgehalt der Vertragsklausel ist im Wege der Auslegung zu bestimmen, §§ 133, 157 BGB. Gegenstand der Auslegung stellen dabei die korrespondierenden und jeweils empfangsbedürftigen Willenserklärungen der Klägerin sowie der Beklagten, welche auf den Abschluss der Verpflichtungserklärung gerichtet sind, dar. Auszugehen hat die Auslegung vom Wortlaut der Erklärung, wobei allerdings der tatsächliche Sinn der Erklärung zu erforschen ist, ohne am Buchstaben zu haften (statt aller BeckOK BGB/Wendtland, 68. Ed. 1.11.2023, BGB § 133 Rn. 23). Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind dabei so auszulegen, wie der Empfänger sie nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung von Wortlaut, Begleitumständen und der Verkehrssitte verstehen musste (Wendtland, aaO, Rn. 27).
Die Willenserklärung der Beklagten ist, für die Klägerin auch ohne weiteres ersichtlich, im Zusammenhang mit dem Schreiben vom 16. März 2023 abgegeben worden, in welchem die Beklagte eine Patentverletzung von sich weist und für sich in Anspruch nimmt, mit ihren Produkten im freien Stand der Technik zu agieren. Damit sollte die abgegebene Erklärung jedenfalls die konkret angegebenen Produkte nicht umfassen, keinesfalls aber über die Ausschließlichkeitswirkungen des Klagepatents hinausgehen. Ob die Erklärung vor dem von der Beklagten geäußerten Begriffsverständnis abweichend und enger auszulegen ist, als die Lehre des Klagepatents, bedarf vorliegend keiner Entscheidung.
Ebenfalls wollte sich die Beklagte nicht eventueller Rechte zur Benutzung der angegriffenen Produkte begeben, da sie diese als nicht patentverletzend und dem entsprechend auch explizit nicht von ihrer Unterlassungserklärung umfasst erachtet.
VIII.
Die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung liegen hinsichtlich Anspruch 1 für die angegriffene Ausführungsform und die angegriffene Ausführungsform F vor, § 10 PatG.
Da die Beklagte ihre Produkte im Inland an inländische Abnehmer anbietet, ist der für § 10 PatG erforderliche doppelte Inlandsbezug gegeben. Die von der Beklagten vertriebenen Produkte stellen auch Mittel im Sinne des § 10 PatG dar.
Die angegriffenen Ausführungsform sowie die angegriffene Ausführungsform F beziehen sich zudem auf ein wesentliches Element der Erfindung. Eine solche Wesentlichkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn das Mittel als solches im Patentanspruch genannt ist (Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl., § 10 Rn. 16). Bei einem Verfahrenspatent bezieht sich eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung (hierzu und zum Folgenden BGH GRUR 2015, 467, 470 Rz. 58 – Audiosignalcodierung). Leistet ein Mittel einen Beitrag zur Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre, so kommt es grundsätzlich nicht darauf an, mit welchem Merkmal es zusammenwirkt, weshalb es unerheblich ist, ob das Merkmal, mit dem das Mittel zusammenwirkt, durch den Stand der Technik vorweggenommen ist.
Gemessen an diesem Maßstab stellen sowohl die angegriffene Ausführungsform als auch die angegriffene Ausführungsform F Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Beide kommen ausdrücklich in den Merkmalen des Verfahrensanspruchs 1, dessen Verletzung mittelbar geltend gemacht wird, vor. Sowohl die Vorrichtung, welche die Stromquelle bereitstellt, insbesondere aber auch das Reiben des Werkstücks mit Teilchen in gasförmiger Umgebung bewirkt, leisten einen Beitrag zur klagepatentgemäßen Lehre. Es kann vor diesem Hintergrund nicht die Rede davon sein, dass diese Mittel, wie die Beklagte vorträgt, nur als Mittel von untergeordneter Bedeutung einzuordnen seien.
Damit sind sowohl die angegriffene Ausführungsform als auch die angegriffene Ausführungsform F auf ein wesentliches Element der Erfindung bezogen als auch geeignet zur Benutzung der Erfindung.
Dies weiß die Beklagte auch. Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass die Beklagten die Ausgestaltung ihrer Produkte kennt und ihre Abnehmer zur Benutzung wie oben dargestellt anleitet. Damit wissen die Beklagten, dass die angegriffenen Ausführungsformen dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung – die Ausführung des beanspruchten Verfahrens – verwendet zu werden.
IX.
Aufgrund der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre durch die angegriffenen Ausführungsform und die angegriffene Ausführungsform F bestehen die folgenden Rechtsfolgen, Art. 64 EPÜ, §§ 139 ff. PatG. - 1.
Da die Beklagte das Klagepatent widerrechtlich benutzt hat, ist sie gemäß § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung der Benutzungshandlungen verpflichtet. - 2.
Die Beklagte trifft auch ein zumindest fahrlässiges Verschulden. Denn die Beklagte als Fachunternehmen bzw. ihr Geschäftsführer hätten bei Anwendung der von ihr im Geschäftsverkehr zu fordernden Sorgfalt die Benutzung des Klagepatents erkennen und vermeiden können, § 276 BGB. Für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents schuldet die Beklagte daher Ersatz des Schadens, welcher der Klägerin entstanden ist und noch entstehen wird, § 139 Abs. 2 PatG. Gleiches gilt hinsichtlich der ausschließlichen Lizenznehmerin A. Denn eine ausschließliche Lizenz wirkt absolut, d.h. auch im Verhältnis zwischen dem Lizenznehmer und Dritten (Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl., § 15 Rn. 33, 37).
Da die genaue Schadensersatzhöhe derzeit noch nicht feststeht, die Klägerin nämlich keine Kenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen durch die Beklagten hat, hat sie ein rechtliches Interesse gemäß § 256 ZPO daran, dass die Schadensersatzpflicht der Beklagten ihr und der A gegenüber dem Grunde nach festgestellt wird. - 3.
Um die Klägerin in die Lage zu versetzen, den ihr zustehenden Schadensersatz zu beziffern, sind die Beklagten verpflichtet, im zuerkannten Umfang über ihre Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und Auskunft zu erteilen, §§ 140b PatG, 259, 242 BGB.
Nicht hingegen verlangt werden kann im Rahmen der Anträge zu III. eine Kenntlichmachung derjenigen Lieferungen und Abnehmer, die die angegriffene Ausführungsform auch entsprechend verwendet haben. Die mittelbare Patentverletzung ist eine selbstständige Benutzungsart, die von der Verwendung durch die Abnehmer zu differenzieren ist. § 140b PatG sieht eine entsprechende Auskunftspflicht des mittelbaren Patentverletzers auch nicht vor. - 4.
Die Beklagte ist nach Art. 64 EPÜ, § 140a Abs. 1 und 3 PatG auch zur Vernichtung und zum Rückruf der das Klagepatent verletzenden Gegenstände verpflichtet.
Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung sind dabei nicht wegen Unverhältnismäßigkeit ausgeschlossen, § 140a Abs. 4 PatG.
Der Unverhältnismäßigkeitseinwand nach § 140a Abs. 4 PatG ist auf enge Ausnahmen beschränkt (BeckOK PatR/Fricke, 31. Ed. 15.1.2024, PatG § 140a Rn. 28, 46). Eine Unverhältnismäßigkeit hinsichtlich der Vernichtung kommt zunächst dann in Betracht, wenn die drohende Gefahr ebenso effektiv auch auf andere Weise als durch die vollständige Vernichtung des Erzeugnisses beseitigt werden kann (BeckOK PatR/Fricke, aaO, Rn. 29). Ist das nicht der Fall, kann der Vernichtungsanspruch gleichwohl im Sinne eines Übermaßverbotes ausgeschlossen sein, wenn die Vernichtung unverhältnismäßig im engeren Sinne ist (BeckOK PatR/Fricke, aaO, Rn. 30). Für den Rückrufanspruch gilt entsprechendes (BeckOK PatR/Fricke, aaO, Rn. 46).
Gemessen an diesem Maßstab stellt sich weder Vernichtung noch Rückruf als unverhältnismäßig dar. Der Ausspruch zur Vernichtung und zum Rückruf bezieht sich insbesondere nur auf vollständig verletzende Vorrichtungen nach Ziffer I. des Tenors. Diese sind zur Durchführung von klagepatentgemäßen Elektropoliturverfahren verwendbar. Eine gleich effektive Beseitigung der Gefahr ist nicht ersichtlich und von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden. Auch eine Unverhältnismäßigkeit im engeren Sinne ist nicht dargetan. Dass die – vollständig den Merkmalen des Anspruchs 8 entsprechenden – Vorrichtungen auch für Politurverfahren eingesetzt werden können, die unter Umständen nicht klagepatentgemäß sind, reicht für einen Anspruchsausschluss allein nicht aus. - 5.
Der Klägerin steht auch eine Forderung in Höhe der geltend gemachten vorgerichtlichen Abmahnkosten zu, §§ 683, 677, 670 BGB. Die Beklagte hat den Anfall der entsprechenden Kosten, nachdem die Klägerin auf den Vorwurf mangelnder Substantiierung durch die Beklagte vertiefend vorgetragen hat, nicht mehr bestritten. Die Zinsforderung folgt aus § 291 BGB. - 6.
Hinsichtlich der geltend gemachten mittelbaren Patentverletzung durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform sowie der angegriffenen Ausführungsform F ist allerdings kein Schlechthinverbot gerechtfertigt.
Ein Schlechthinverbot kommt im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn keine technisch und wirtschaftlich sinnvolle Verwendungsmöglichkeit außerhalb der klagepatentgemäßen Lehre besteht (Schulte/Voß, PatG, 11. Aufl., § 10 Rn. 38, 40). Kommt hingegen eine solche Verwendung in Betracht, so sind grundsätzlich nur eingeschränkte Verbote gerechtfertigt. Ausnahmsweise ist auch in diesen Fällen ein Schlechthinverbot möglich. Dies ist etwa der Fall, wenn weder ein Warnhinweis noch eine Vertragsstrafenvereinbarung ausreicht, um eine Patentverletzung durch die Abnehmer mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, eine etwaige Patentverletzung durch den Abnehmer für den Schutzrechtsinhaber praktisch nicht feststellbar wäre und dem mittelbaren Patentverletzer ohne Weiteres zugemutet werden kann, die Mittel so umzugestalten, dass sie nicht mehr patentgemäß verwendet werden können (OLG Düsseldorf, GUR-RR 2004, 345, 349 – Rohrschweißverfahren). Weiter kann dies der Fall sein, wenn die patentfreie Benutzung auf eine dem Klagepatent entsprechende Ausgestaltung nicht angewiesen ist, weil das Mittel ohne weiteres so verändert werden kann, dass es, obwohl es den Vorgaben des Patents nicht mehr entspricht, seine Eignung zur patentfreien Verwendung nicht einbüßt (LG Düsseldorf, Urteil vom 23. Juni 2005 – 4 O 297/97 –, Rn. 78, juris; OLG Düsseldorf Urt. v. 29.3.2012 – I-2 U 137/10, BeckRS 2012, 8566, sub. II.4.a.). Die von der Klägerin in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Beschl. v. 24.1.2022 – 15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513) thematisiert insoweit keine Neuerung. - Diese Voraussetzungen für ein Schlechthinverbot sind vorliegend nicht gegeben. Die angegriffene Ausführungsform kann nach dem Parteivortrag auf vielfältige Weise zur Elektropolitur eingesetzt werden. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, dass sie auf eine bestimmte Art von Festkörpern festgelegt ist. Insbesondere sind die im Klagepatent erörterten und vorbekannten Verfahren zum Glätten und Polieren von Metallteilen unter Verwendung von Elektrolytflüssigkeit und ohne Reibungsvorgang in gasförmiger Umgebung mit den genannten Geräten durchführbar. Dies gilt sowohl hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform als Vorrichtung als auch hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform F. Auch letztere kann mit mehr Flüssigkeit vermischt und somit für die Durchführung von „nassen“ Verfahren zur Elektropolitur verwendet werden. Eines ausdrücklichen Hilfsantrags auch hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform F bedurfte es insoweit nicht, da ein entsprechendes eingeschränktes Verbot als Minus im Antrag enthalten ist.
- 7.
Zur Umsetzung des vorstehend erörterten eingeschränkten Verbots der angegriffenen Ausführungsform ist ein Warnhinweis wie tenoriert geboten.
Ein entsprechender Warnhinweis an den Abnehmer stellt ein grundsätzlich geeignetes Mittel dar, um einen unmittelbar patentverletzenden Gebrauchs des entsprechenden Mittels mit hinreichender Sicherheit auszuschließen (Schulte/Rinken, PatG, 11. Aufl. 2022, § 10 Rn. 40). Ein ausreichender Warnhinweis setzt inhaltlich voraus, dass der Adressat mit einer ihm verständlichen Formulierung darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine bestimmte Verwendung des beworbenen und gelieferten Gegenstandes Schutzrechte Dritter, hier konkret das Klagepatent als Schutzrecht der Klägerin, verletzt und er daher insoweit auf die Zustimmung der Klägerin angewiesen ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. Mai 2023 – I-15 U 57/22 –, Rn. 117, juris). Dabei ist hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung zu fordern, dass der Warnhinweis den Empfängerhorizont seines Adressatenkreises berücksichtigt, um seiner Funktion gerecht zu werden (OLG Düsseldorf, aaO, Rn. 118).
Dabei ist geboten, konkrete Vorkehrungen, die der jeweilige mittelbare Verletzer einhalten muss, um zukünftig eine mittelbare Verletzung auszuschließen (also die Erforderlichkeit eines Warnhinweises an sich), in den Entscheidungstenor aufzunehmen (vgl. Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 139 Rn. 103; Zigann in: Haedicke/Timmann PatR-HdB, § 15. Die Patentstreitsache Rn. 140; Kühnen, Handbuch d. Patentverletzung, 16. Aufl., Kap D. Rn. 1121; aA Nieder, Die Patentverletzung, 2004, Rn. 94). Nicht im Tenor vorgegeben werden muss jedoch etwa der konkrete Wortlaut eines Warnhinweises. Die konkrete sprachliche Ausformulierung des Warnhinweises muss der Beklagten im Rahmen der Ausübung ihres Geschäftsbetriebes überlassen bleiben (vgl. insoweit Nieder, Die Patentverletzung, 2004, Rn. 94). Sie trägt dabei freilich das Risiko, dass eine von ihr gewählte Ausgestaltung sich in einem potentiellen Vollstreckungsverfahren als den Vorgaben des Tenors nicht genügend erweist.
X.
Die Anträge zu Ziffer 5 der Beklagten mit Schriftsatz vom 18. März 2024 gerichtet auf die Einstufung der im vorstehenden Schriftsatz, konkret auf Bl. 197-199 d.A., genannten Informationen als geheimhaltungsbedürftig nebst der auf den Erlass flankierender Anordnungen gerichteten Anträge gemäß den Ziffern 6, 7 und 8 sind bereits unzulässig, § 145a PatG i.V.m. §§ 16 ff. Abs. 1 GeschGehG.
Schon nach dem Vortrag der Beklagten handelt es sich bei den Informationen, deren Einstufung als geheimhaltungsbedürftig sie begehrt, nicht um streitgegenständliche Informationen im Sinne des § 145a PatG. Als solche gelten gemäß Satz 2 der Norm sämtliche von Kläger und Beklagtem in das Verfahren eingeführten Informationen. Als Verfahren in diesem Sinne ist hierbei das konkret anhängige Gerichtsverfahren zu verstehen (vgl. auch Benkard PatG/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 145a Rn. 5; ebenso im Übrigen auch das LG Mannheim, Beschluss vom 13.10.2021, Az. 2 O 73/20 ZV II – Geheimnisschutzanordnung, Rz. 51 f., zitiert nach juris). Der verfahrensrechtliche Geheimnisschutz ist damit streng auf das konkrete anhängige Verfahren bezogen und Regelungen für bislang nicht anhängige Folgeverfahren nicht zugänglich (so zutreffend auch das LG Mannheim, aaO, Rz. 52).
Die Beklagte begehrt vorliegend die von ihr beantragten Anordnungen für Informationen bei denen bereits unklar ist, ob diese jemals in ein Verfahren eingeführt werden sollen. Soweit die Beklagte einen Geheimnisschutz in einem potentiellen Zwangsvollstreckungsverfahren begehrt, kommt ein solcher bereits deswegen nicht in Betracht, weil ein solches Verfahren nicht anhängig ist. Eine Einführung der Informationen, für welche die beantragten Anordnungen begehrt werden, in das hiesige Erkenntnisverfahren, ist von der Beklagten offenkundig nicht beabsichtigt.
Die Ausführungen der Beklagten, es handele sich um streitgegenständliche Informationen, da die Beklagte zu ihrer Herausgabe im Rahmen der Auskunft- und Rechnungslegung verpflichtet sei, können nicht überzeugen. Dem Wortlaut der Gesetzesbegründung, auf den die Beklagte abstellt, lässt sich allenfalls entnehmen, dass potentiell schutzfähige Informationen von beiden Parteien in das Verfahren eingeführt sein können und insbesondere der Begriff der streitgegenständlichen Informationen jedenfalls im Anwendungsbereich des § 145a PatG nicht mit dem zivilprozessualen Begriff des Streitgegenstands gleichzusetzen ist. Demgegenüber spricht auch die von der Beklagten zitierte Passage der Begründung von dem konkreten Verfahren, in welche die Information eingeführt werden.
Die Kammer verkennt nicht, dass die Beklagte sich gegebenenfalls von der Rechtsprechung der Kammer (LG Düsseldorf, Beschluss vom 26. September 2022, Az. 4c O 59/20 ZV I) sowie des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2023, 873 – Geheimnisschutz II; GRUR 2020, 734 – Cholesterinsenker), nach welcher entsprechende Einschränkungen – sofern man solche annehmen will – der Auskunfts- und Rechnungslegungsverpflichtung materiell-rechtlicher Natur sind und deshalb im Erkenntnisverfahren geltend gemacht werden müssen, aus prozessualer Vorsicht veranlasst sah, einen entsprechenden Geheimnisschutzantrag zu stellen. Indes ist der verfahrensrechtliche Geheimnisschutz nach § 145a PatG für die Geltendmachung solcher potentieller materiell-rechtlicher Einschränkungen prinzipiell nicht geeignet.
XI.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO, diejenige über die Kosten aus § 92 ZPO. Dem Antrag der Beklagten nach § 712 ZPO war mangels Vortrag und Glaubhaftmachung zu den Voraussetzungen einer Abwendungsbefugnis nicht zu entsprechen. Hinsichtlich der Kosten war eine Quotelung vorzunehmen, da die Klägerin hinsichtlich ihrer Anträge zu II. und zu III. nur zum Teil obsiegt. - Der Streitwert wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt, § 51 Abs. 1 GKG.
- Der Schriftsatz der Beklagten vom 21. Mai 2024 bietet, soweit er nicht nachgelassene Ausführungen enthielt, keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung.