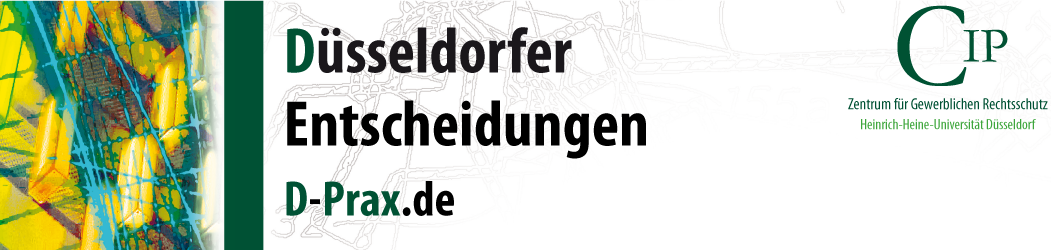Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3395
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 15. Oktober 2024, Az. 4b O 94/23
- I. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
II.Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags. - Tatbestand
- Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 2 830 XXX B1 (nachfolgend: Klagepatent, Anlage rop 1) geltend gemacht. Nach Erlass eines Teil-Anerkenntnisurteils streiten die Parteien nur noch über die Kosten des Rechtsstreits.
- Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 27. März 2012 am 20. März 2013 angemeldet. Die Anmeldung des Klagepatents wurde am 4. Februar 2015, der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 30. Dezember 2015 veröffentlicht. Das Klagepatent betrifft ein Wärmetherapiegerät. Der Klagepatentanspruch 1 lautet wie folgt:
- „Wärmetherapiegerät, insbesondere Inkubator, zur Behandlung von Neugeborenen mit einer von oben frei zugänglichen umrandeten Liegefläche (4) zur Aufnahme eines Neugeborenen, einer Haube (18), die zwischen einer die umrandete Liegefläche (4) abdeckenden geschlossenen Stellung und einer die umrandete Liegefläche (4) freigebenden offenen Stellung beweglich ist, und einer an einer Tragstruktur (8) aufgehängten, auf die umrandete Liegefläche (4) gerichteten Strahlungsheizung (16), wobei die Haube (18) an der Tragstruktur (8) so aufgehängt ist, dass sie nach der Bewegung aus der geschlossenen in die geöffnete Stellung mit ihrem der Tragstruktur zugewandten Ende vertikal wenigstens auf Höhe der Strahlungsheizung (16) und horizontal weiter von der Tragstruktur entfernt als diese liegt, so dass die Haube (18) eine Position außerhalb des Strahlungskegels von der Strahlungsheizung auf die Liegefläche einnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass das der Tragstruktur zugewandte Ende (18b) der Haube (18) durch einen Kopplungsmechanismus auf einer Kreisbahn um einen Drehpunkt an der Tragstruktur geführt wird.“
- Wegen der Unteransprüche wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.
- Nachfolgend wird die Figur 1 des Klagepatents eingeblendet, die eine schematische Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Wärmetherapiegeräts zeigt:
- Die Beklagte, die verschiedene medizinische Produkte herstellt und international tätig ist, war in der Zeit vom 13. bis 16. November 2023 mit einem eigenen Stand auf der Messe „A“ in XXX vertreten, wo sie einen Hybrid-Inkubator unter der Bezeichnung „B“ beziehungsweise „C“ (angegriffene Ausführungsform) ausstellte, wie aus der nachfolgenden Fotografie ersichtlich:
- Am 8. November 2023 wurde die Klägerin erstmals darauf aufmerksam, dass die Beklagte beabsichtigte, die angegriffene Ausführungsform auf der Messe „A“ auszustellen. Über den X-Account (vormals: Twitter-Account) der Beklagten war am 10. November 2023 ein Hinweis auf die Ausstellung der angegriffenen Ausführungsform auf der Messe „A“ abrufbar. Eine entsprechende Ankündigung fand sich am 10. November 2023 auch auf dem Facebook-Profil der Beklagten. Die Beklagte bewirbt die angegriffene Ausführungsform zudem auf ihrem YouTube-Kanal (vgl. Screenshots der entsprechenden Videos vom 10. November 2023, überreicht als Anlagen rop 13 und rop 14).
- Die Klägerin hat am 13. November 2023 eine einstweilige Verfügung zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs (Sequestration) ohne vorherige Abmahnung beantragt, welche von der Kammer am 14. November 2023 erlassen worden ist (Aktenzeichen 4b O 95/23). Gleichzeitig hat sie einen Arrestantrag zur Sicherung der Verfahrenskosten im hiesigen Verfahren gestellt, woraufhin die Kammer mit Beschluss vom 14. November 2023 antragsgemäß den dinglichen Arrest in das inländische bewegliche Vermögen der Beklagten angeordnet hat (Aktenzeichen 4b O 96/23). Die Klägerin hat die einstweilige Verfügung und den Arrestbeschluss der Beklagten am 15. November 2023 auf der Messe „A“ und den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 30. November 2023 zugestellt.
- Die Klägerin hat mit Klageschrift vom 13. November, bei Gericht am selben Tage eingegangen, ohne die Beklagte zuvor abzumahnen, Ansprüche auf Unterlassung (Antrag zu Ziffer I. 1.), Auskunft (Antrag zu Ziffer I. 2.), Rechnungslegung (Antrag zu Ziffer I. 3.), Rückruf (Antrag zu Ziffer I. 4.), Vernichtung (Antrag zu Ziffer I. 5.) und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung (Antrag zu Ziffer II.) geltend gemacht. Am 14. November 2023 ist die Klage der Beklagten auf der Messe „A“ zugestellt worden. Die Beklagte hat unter dem 27. November 2023 lediglich ihre Verteidigung gegen die Klage angezeigt und mit Klageerwiderung vom 13. Mai 2024 sodann hinsichtlich der Anträge zu Ziffer I. 1. (Unterlassung), Ziffer I. 3. (Rechnungslegung) und Ziffer II. (Feststellung der Schadensersatzpflicht) ihr Anerkenntnis unter Verwahrung gegen die Kostenlast erklärt. Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 28. Mai 2024 den Klageantrag zu Ziffer I. 4. (Rückruf) zurückgenommen. Zudem hat sie die Klageanträge zu I. 2. (Auskunft) und I. 5. (Vernichtung) modifiziert. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 26. Juli 2024 den so modifizierten Vernichtungsantrag (Ziffer I. 5.) und mit Schriftsatz vom 5. August 2024 den modifizierten Auskunftsantrag (Ziffer I. 2.) unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt.
- Die Kammer hat die Beklagte mit Teil-Anerkenntnisurteil vom 6. August 2024 ihrem Anerkenntnis gemäß verurteilt.
- Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte habe die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da sie Anlass zur Klage gegeben habe. Eine Kostentragung der Klägerin nach § 93 ZPO sei nicht gegeben. In Bezug auf die Anträge auf Auskunftserteilung und Vernichtung sei das Anerkenntnis der Beklagten bereits nicht „sofort“ erfolgt. Im Übrigen sei eine vorherige Abmahnung der Beklagten nicht in Betracht gekommen. Vor dem 13. November 2023 habe das Bestehen der Ansprüche noch nicht festgestanden. Davon, dass die Beklagte die angegriffene Ausführungsform in Deutschland in Besitz oder Eigentum habe, was Voraussetzung für den Vernichtungsanspruch sei, habe sie, die Klägerin, erstmals am ersten Messetag am 13. November 2023 Kenntnis erlangt. Ebenso habe sie sich erstmals am 13. November 2023 in einem Gespräch mit der Mitarbeiterin der Beklagten auf dem Messestand davon überzeugen können, dass die angegriffene Ausführungsform grundsätzlich und in der Zukunft auch für die Lieferung nach Deutschland vorgesehen sei, derzeit jedoch noch keine CE-Kennzeichnung habe. Die Zeit zwischen dem 8. November 2023 bis zum Beginn der Messe habe sie genutzt, um unter hohem Zeitdruck vorsorglich die Klageschrift, den Arrest und den Verfügungsantrag vorzubereiten. Auch zu einem späteren Zeitpunkt sei eine Abmahnung nicht in Betracht gekommen, weil das Risiko der Vereitelung des Vernichtungsanspruchs und der Klagezustellung bestanden habe. Insoweit habe das Risiko des Verbringens der angegriffenen Ausführungsform ins Ausland bestanden, um diese dem Zugriff der Vollstreckungsorgane zu entziehen, worauf auch das Verhalten der Beklagten im hiesigen Verfahren hindeute.
- Die Klägerin beantragt,
- der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
- Die Beklagte beantragt,
- die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen.
- Die Beklagte ist der Auffassung, die Klägerin habe die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da ihr Anerkenntnis „sofort“ im Sinne des § 93 ZPO erklärt worden sei und sie keine Veranlassung zur Klage gegeben habe. Denn der Klägerin sei es möglich und zumutbar gewesen, sie, die Beklagte, vor Einreichung der Klage in Bezug auf die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche in Kenntnis zu setzen beziehungsweise abzumahnen.
- Entscheidungsgründe
-
I.
Nach dem Teil-Anerkenntnisurteil der Kammer vom 6. August 2024 ist nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 269 Abs. 3 Satz 2, 92 Abs. 2 Nr. 1, 93 ZPO. - Soweit die Klägerin die Klage im Hinblick auf den Rückrufanspruch zurückgenommen hat, hat sie nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO die Kosten zu tragen. Soweit die Beklagte den überwiegenden Teil der verbleibenden Ansprüche sofortig anerkannt hat, folgt die Kostentragung der Klägerin aus § 93 ZPO. Soweit dies im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch nicht der Fall gewesen ist, folgt die Kostentragung der Klägerin aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, da die Zuvielforderung der Beklagten verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat. Insoweit findet der § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zugunsten des Beklagten entsprechende Anwendung (dazu RGZ 142, 83; LAG Berlin Urteil vom 4. Mai 2001 – 6 Sa 479/01, BeckRS 2001, 30895294).
- Gemäß § 93 ZPO, der eine Ausnahme vom Unterliegensprinzip des § 91 ZPO darstellt, fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt und nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat.
-
1.
Das Anerkenntnis der Beklagten erfolgte nur teilweise „sofort“ im Sinne des § 93 ZPO. Denn im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch kann ein sofortiges Anerkenntnis nicht festgestellt werden. -
a.
Die Beklagte hat mit der – innerhalb der verlängerten Frist zur Klageerwiderung eingegangenen – Klageerwiderung vom 13. Mai 2024 unter Verwahrung gegen die Kostenlast die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht „sofort“ anerkannt. - Zwar erfolgt ein Anerkenntnis grundsätzlich nur dann „sofort“ im Sinne des § 93 ZPO, wenn es bei der ersten prozessual dafür in Betracht kommenden Gelegenheit geschieht (Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 15. August 1990 – 2 W 41/90, zitiert nach juris), im hiesigen schriftlichen Vorverfahren damit grundsätzlich mit der Anzeige der Verteidigungsbereitschaft. Dass die Beklagte erst innerhalb der (verlängerten) Frist zur Klageerwiderung ihr Anerkenntnis erklärt hat, nachdem sie bereits ihre Verteidigungsbereitschaft gegen die Klage angezeigt hatte, ist jedoch noch unschädlich, solange mit der Anzeige – wie hier – noch kein uneingeschränkter Klageabweisungsantrag angekündigt oder dem Anspruch in sonstiger Weise entgegengetreten wird (BGH, Beschluss vom 16. Januar 2020 – V ZB 93/18, NJW 2020, 1442 Rn. 11, m.w.N.; Herget in: Zöller, Zivilprozessordnung, 35. Auflage 2024, § 93 Rn. 4).
-
b.
Auch den Auskunftsanspruch hat die Beklagte unter Verwahrung gegen die Kostenlast „sofort“ im vorgenannten Sinne anerkannt. Dass das Anerkenntnis erst nach der Klageerwiderung mit Schriftsatz vom 5. August 2024 erklärt worden ist, steht einem „sofortigen“ Anerkenntnis im hiesigen Einzelfall nicht entgegen. - Zwar verliert der Beklagte mit Einreichung der Klageerwiderungsschrift im schriftlichen Vorverfahren, mit der ein Antrag auf Klageabweisung angekündigt wird, grundsätzlich das Kostenprivileg des § 93 ZPO (BGH, NJW-RR 2007, 397, m.w.N.). Der Beklagte kann aber ausnahmsweise auch dann noch „sofort“ anerkennen, wenn die Klage zunächst nicht schlüssig begründet war und nachdem dieser Mangel behoben wird (BGH, Beschluss vom 16. Januar 2020 – V ZB 93/18 NJW 2020, 1442 Rn. 18; NJW-RR 2004, 999, m.w.N.) oder nachdem der Kläger seinen Klageantrag den materiell-rechtlichen Vorgaben entsprechend angepasst hat (BGH, NJW-RR 2005, 1005 (1006); Oberlandesgericht Düsseldorf, BeckRS 2010, 12101; Beck’scher Online-Kommentar Zivilprozessordnung/Jaspersen, 53. Edition 1.7.2024, ZPO, § 93 Rn. 94). Unabhängig von der Verfahrenswahl müssen zunächst alle Gründe entfallen sein, die es dem Beklagten vorprozessual erlaubten, die Erfüllung zu verweigern. Solange sie fortbestehen, bleibt ein sofortiges Anerkenntnis, wenn diese Gründe dann entfallen, immer noch möglich (Herget in: Zöller, a.a.O., § 93 ZPO, Rn. 4).
- So lag der Fall hier. Die Beklagte durfte die Erfüllung des von der Klägerin mit der Klage geltend gemachten Auskunftsanspruchs zunächst verweigern, da dieser – wenn auch nur geringfügig – zu weitgehend formuliert beziehungsweise unschlüssig war. Die Kammer hatte insoweit in ihrer Einleitungsverfügung bereits darauf hingewiesen, dass die Belegvorlage nicht schlüssig vorgetragen sei und es keinen Anspruch auf Vorlage von Auftragsbelegen, Auftragsbestätigungen sowie Liefer- und Zollpapieren gebe, sondern die Belegvorlage üblicherweise auf Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine beschränkt sei. Die Beklagte hatte bereits mit der Klageerwiderung vom 13. Mai 2024 den Auskunftsanspruch in der von der Kammer angeregten und in der von der Klägerin später mit Schriftsatz vom 28. Mai 2024 angekündigten, eingeschränkten Fassung unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt. Das Anerkenntnis ist, da es zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Gänze dem Klageantrag entsprochen hat, zunächst nicht wirksam geworden und musste schließlich nochmals – wie geschehen – zu späterem Zeitpunkt erklärt werden. Dass die Beklagte den geänderten Auskunftsanspruch schließlich erst mit Schriftsatz vom 5. August 2024 anerkannt hat, nachdem die Kammer die Beklagte auf den Umstand, dass das Anerkenntnis nach Änderung des Auskunftsantrags erneut zu erklären sein wird, bereits mit Schreiben vom 14. Mai 2024 und nochmals mit Schreiben vom 29. Juli 2024 hingewiesen hat, steht einem „sofortigen“ Anerkenntnis im Streitfall nicht entgegen. Insoweit muss das Anerkenntnis nach Ausräumung des anfänglichen Schlüssigkeitsdefizits innerhalb eines Zeitraums erklärt werden, in dem unter Beachtung der Prozessförderungspflicht des Beklagten mit einer Reaktion auf die veränderte Sachlage zu rechnen ist, wobei es vom Einzelfall abhängt, wie lange diese Zeitspanne zu bemessen ist (Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Auflage 2024, Kap. C Rn. 184; Oberlandesgericht Saarbrücken, GRUR-RR 2018, 171 – verzögertes Anerkenntnis). Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte bereits mit der Klageerwiderung ihren Anerkenntniswillen hinsichtlich des schließlich auch anerkannten Auskunftsanspruchs zum Ausdruck gebracht hat und keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass sie zwischenzeitlich von diesem abgerückt wäre, erachtet die Kammer die verzögerte „Bestätigung“ ihres bereits zuvor geäußerten Anerkenntniswillens als unschädlich.
-
c.
Der Vernichtungsanspruch ist von der Beklagten hingegen nicht „sofort“ im Sinne des § 93 ZPO anerkannt worden. - Zwar hatte die Beklagte schon mit Klageerwiderung vom 13. Mai 2024 ein Anerkenntnis des Vernichtungsanspruchs erklärt, allerdings nur in einer stark eingeschränkten Form, die nicht dem Antrag der Klägerin entsprochen hat. Insoweit sollte die angegriffene Ausführungsform nach einer Entfernung und Vernichtung beziehungsweise Unbrauchbarmachung des Arms der Tragstruktur wieder an die Beklagte herausgegeben werden. Die Beklagte hat gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass sie den Vernichtungsanspruch in der geltend gemachten Form für unverhältnismäßig und damit für unbegründet hält. Damit hat sie ihren Verteidigungswillen deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Beklagte kann aber nicht mehr sofort anerkennen, wenn er bereits zuvor deutlich gemacht hat, er werde sich gegen die Klage verteidigen, was sich nicht nur aus einem Klageabweisungsantrag oder seiner Ankündigung ergeben kann (BGH, NJW-RR 2007, 397), sondern auch aus prozessualen oder – wie hier – materiell-rechtlichen Einwänden gegen die Klage (Oberlandesgericht Hamburg, FamRZ 1994, 1483; Oberlandesgericht Köln, MDR 2006, 226; Beck’scher Online-Kommentar Zivilprozessordnung/Jaspersen, 53. Edition 1.7.2024, Zivilprozessordnung, § 93 Rn. 100). Dass die Beklagte erst nach weiteren außergerichtlichen Gesprächen mit der Klägerin mit Schriftsatz vom 26. Juli 2024 den von der Klägerin unter dem 28. Mai 2024 modifizierten Vernichtungsanspruch, gerichtet auf weiterhin unbedingte und vollständige Vernichtung, unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt hat, stellt daher kein „sofortiges“ Anerkenntnis mehr dar.
-
2.
Die Beklagte hat, soweit diese die Klageansprüche „sofort“ anerkannt hat, auch keine Veranlassung zur Erhebung der Klage gegeben. -
a.
Eine Veranlassung zur Erhebung einer Klage gibt man durch ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Prozesses rechtfertigt. Daraus folgt, dass es für die Frage, ob der Beklagte Anlass zur Klage gegeben hat, auf sein Verhalten vor dem Prozess ankommt (BGH, NJW-RR 2005, 1005, m.w.N.). Dementsprechend kann ein Klageanlass allein durch ein prozessuales Gebaren des jeweiligen Beklagten nicht „nachwachsen“; ihm kann lediglich indizielle Bedeutung zukommen, um Zweifelsfragen bezüglich einer vorprozessual angelegten Klageveranlassung zu klären (Oberlandesgericht Düsseldorf, NJW-RR 2020, 252 Rn. 9, m.w.N.). Die Schutzrechtsverletzung als solche, auch wenn sie aus der Sicht des Klägers vorsätzlich begangen erscheint, reicht für eine Klageveranlassung nicht aus. Der Verletzte wird deshalb den Verletzer in aller Regel vor der Einleitung gerichtlicher Schritte abmahnen müssen, wenn er für den Fall des sofortigen Anerkenntnisses der Kostenfolge des § 93 ZPO entgehen will (Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 3. November 2005 – 2 W 18/05, BeckRS 2008, 2947 Randnummer 3; Cepl/Voß/Rüting, 3. Aufl. 2022, ZPO § 93 Rn. 18). -
b.
Eine Abmahnung vor Klageerhebung ist nicht erfolgt. Eine solche war im Streitfall auch nicht ausnahmsweise entbehrlich. -
aa.
Ob eine Abmahnung im Einzelfall ausnahmsweise entbehrlich ist, beurteilt sich nicht nach der Prognose, inwieweit sie tatsächlich erfolgversprechend sein kann, sondern entscheidend ist vielmehr, ob aus der Sicht der klagenden Partei in dem Zeitpunkt, in dem sie entscheiden muss, ob sie im betreffenden Einzelfall eine Abmahnung ausspricht oder nicht, eine Verwarnung des Verletzers bei Anlegung eines objektiven Maßstabes für ihn unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit liegt nur vor, wenn entweder die mit einer vorherigen Abmahnung notwendig verbundene Verzögerung unter Berücksichtigung der gerade im konkreten Fall gegebenen außergewöhnlichen Eilbedürftigkeit schlechthin nicht mehr hinnehmbar ist, etwa um besonderen Schaden vom Verletzten abzuwenden oder wenn sich der klagenden Partei bei objektiver Sicht der Eindruck geradezu aufdrängen musste, der Verletzer wolle die grundsätzliche Abmahnpflicht dazu ausnutzen, die Verletzungshandlungen noch mindestens eine Zeit lang ungestört fortsetzen zu können und sich gegebenenfalls nach damit erzieltem wirtschaftlichen Erfolg unter Übernahme vergleichsweise niedriger Abmahnkosten zu unterwerfen (Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss vom 3. November 2005 – 2 W 18/05, BeckRS 2008, 2947 Rn. 3; Beschluss vom 7. August 2002 – 2 W 10/02 – Turbolader II, InstGE 2, 237, 238; Kammer, Schlussurteil vom 18. Dezember 2009 – 4b O 213/09 – Blutgefäßschließer III). - Wird eine Verwahrung zur Sicherung des Anspruchs auf Vernichtung rechtsverletzender Ware begründet geltend gemacht, so ist eine Abmahnung vor Geltendmachung des Anspruchs auch dann unzumutbar, wenn sie die Durchsetzung der berechtigten Ansprüche des Klägers vereiteln würde oder dies aus Sicht des Anspruchstellers zumindest ernsthaft zu befürchten steht. Von einem derartigen Sachverhalt wird ausgegangen, wenn die in Verwahrung zu nehmende Sache aufgrund ihrer Mobilität ohne weiteres beiseitegeschafft und dadurch dem Zugriff des Gläubigers entzogen werden kann (Oberlandesgericht Düsseldorf, WRP 1997, 471, 472 – Ohrstecker; Landgericht Düsseldorf, InstGE 12, 234 – Fieberthermometer; Kühnen, a.a.O., Kap. C Rn. 196, m.w.N.). Wird mit dem Sequestrationsanspruch zugleich ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht, so entfällt die Notwendigkeit einer Abmahnung nicht nur teilweise, sondern insgesamt (Oberlandesgericht Düsseldorf, NJWE WettbR 1998, 234).
-
bb.
Nach diesen Maßstäben ist eine Unzumutbarkeit einer Abmahnung der Beklagten im Vorfeld der Einleitung des hiesigen Rechtsstreits für die Klägerin nicht ersichtlich. - Im Streitfall war keine besondere Eilbedürftigkeit der Klageerhebung gegeben, bei deren Vorliegen der für eine Abmahnung einschließlich der dem Abgemahnten zuzubilligenden angemessenen Rückäußerungsfrist benötigte Zeitaufwand per se nicht zur Verfügung gestanden hätte. Das klägerische Vorbringen lässt nicht erkennen, dass es der Klägerin nicht zumindest möglich gewesen wäre, die Beklagte per E-Mail oder vor Ort auf dem Messestand bereits am 13. November 2023 unter Setzung einer kurzen Frist abzumahnen. Die Klägerin hat selbst vorgebracht, dass sie zwischen dem 8. November 2023 und dem Messebeginn am 13. November 2023 bereits die Klage und die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und auf Arrestanordnung vorbereitet hatte. Lediglich im Hinblick auf den Vernichtungsanspruch verschaffte sich die Klägerin durch einen Besuch des Messestandes der Beklagten am 13. November 2023 nach ihrer Behauptung die Gewissheit darüber, dass die Beklagte patentverletzende Gegenstände im Inland im Besitz hat. Aber auch dann hätte noch die Möglichkeit bestanden, die Beklagte vor Ort mit kurzer Fristsetzung abzumahnen. Gegen eine besondere Eilbedürftigkeit der klageweisen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ohne vorherige Abmahnung spricht zudem, dass auch die Klägerin nicht die Notwendigkeit gesehen zu haben scheint, der Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlungen möglichst noch vor Schluss der Messe untersagen zu lassen. Insoweit hat sie die Unterlassung nur mittels Klage und nicht mittels der parallel beantragten einstweiligen Verfügung geltend gemacht. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass der Klägerin schwerwiegende Schäden gedroht hätten oder dass die Beklagte auf das grundsätzliche Bestehen der Abmahnpflicht gebaut hätte, um die Verletzungen zunächst noch fortsetzen zu können und sich dann nach der Erzielung hoher wirtschaftlicher Vorteile gegen vergleichsweise geringfügige Abmahnkosten zu unterwerfen.
- Soweit die Klägerin argumentiert, ihr sei eine Abmahnung der Beklagten vor Stellen des Sequestrationsantrages zur Sicherung des Vernichtungsanspruchs nicht zumutbar gewesen, rechtfertigt dies gerade nicht, von einer Abmahnung auch vor Erhebung der Hauptsacheklage abzusehen. Dies gilt selbst dann, wenn für den parallel zur Klageeinreichung im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemachten Sequestrationsanspruch nach den vorgenannten Maßstäben eine vorherige Abmahnung tatsächlich unzumutbar gewesen sein sollte, was hier nicht abschließend entschieden zu werden braucht. Denn die Befürchtung der Klägerin, dass die Beklagte die angegriffene Ausführungsform kurzfristig außer Landes schaffen könnte, war mit Zustellung der einstweiligen Verfügung am 15. November 2023 gebannt, so dass jedenfalls dann eine Abmahnung hätte erfolgen können.
- Eine Veranlassung für die Klägerin, die Hauptsacheklage zeitgleich mit dem Eilantrag bei Gericht einzureichen, bestand nicht (vgl. insoweit auch Kühnen, a.a.O., Kap. C Rn. 207; zur gleichzeitigen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs: Oberlandesgericht Karlsruhe, WRP 1996, 922 – CD-Rom „Exotic 5“). Vielmehr hätte nach Erlass der Beschlussverfügung in Form eines sogenannten Abschlussschreibens der Beklagten die Möglichkeit eingeräumt werden können, die einstweilige Sequestrationsverfügung als endgültige Regelung anzuerkennen. Der Klägerin war es insoweit zuzumuten, mit der klageweisen Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs noch zu warten, wenn sie die Kostenfolge des § 93 ZPO vermeiden wollte. Auch hinsichtlich der übrigen Ansprüche ist kein schützenswertes Interesse der Klägerin ersichtlich, die Klage gleichzeitig mit dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung und mit dem Arrestantrag einzureichen. Ein solches folgt insbesondere nicht daraus, dass bei einer vorherigen Abmahnung keine Zustellung der Klage auf der Messe mehr möglich gewesen wäre und eine Zustellung am Sitz der Beklagten in XXX erschwert ist. Zum einen ist bereits nicht ersichtlich, dass eine Zustellung noch auf der Messe auch bei einer vorherigen Abmahnung ausgeschlossen gewesen wäre. Die Einreichung der Klage erfolgte am 13. November 2023, die Zustellung derselben auf der Messe an die Beklagte bereits am 14. November 2023. Selbst nach Zustellung der Sequestrationsverfügung am 15. November 2023 hätte daher noch die Möglichkeit bestanden, nach einer Abmahnung mit kurzer Stellungnahmefrist eine Zustellung der Klage auf der Messe zu erwirken. Zudem bestanden im Streitfall keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte bei einer vorherigen Abmahnung gar nicht erst auf der Messe erschienen wäre oder ihren Messestand vorzeitig abgebaut und die Messe verlassen hätte. Aber auch wenn eine Zustellung auf der Messe nicht mehr möglich gewesen wäre, ist eine Unzumutbarkeit einer vorherigen Abmahnung vor Klageerhebung nicht gegeben. Der Umstand allein, dass die Beklagte auf der Messe im Inland vertreten und daher eine kurzfristige Zustellung an diese vor Ort möglich gewesen ist, mag für die Klägerin vorteilhaft sein, kann eine vorherige Abmahnung aber nicht entbehrlich machen, wenn sie die Kostenfolge des § 93 ZPO vermeiden möchte. Insgesamt bleibt es der Klägerin damit unbenommen, ihre Ansprüche ohne vorherige Abmahnung gleichzeitig mit der im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemachten Sequestration geltend zu machen, allerdings mit dem Risiko, die Kosten des Rechtsstreits gemäß der gesetzlichen Regelung des § 93 ZPO tragen zu müssen, falls und soweit die Beklagte die Ansprüche im Rechtsstreit sofort anerkennt. Ein Anlass, von dieser Risikoverteilung zugunsten der Klägerin abzuweichen, besteht nicht.
-
II.
Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. - Streitwert: 500.000,00 Euro