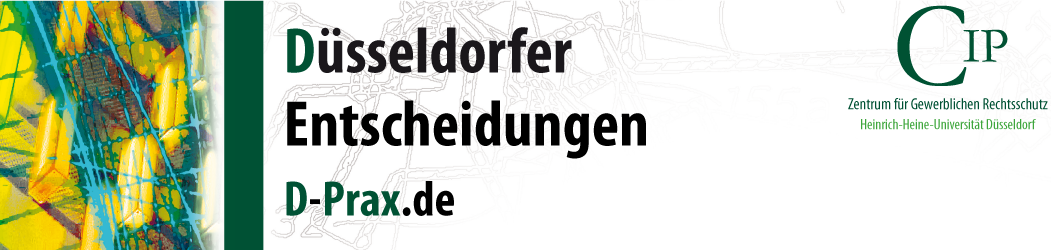Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3394
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 30. Oktober 2024, Az. 4b O 61/23
- Die Klage wird abgewiesen.
- Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
- Tatbestand
- Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Patents DE 10 2007 024 XXX B3 (Anlage rop 1; im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.
- Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents, das am 24. Mai 2007 angemeldet wurde. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 2. Januar 2009 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft. Die Beklagte hat beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage in Bezug auf das Klagepatent erhoben, über die bislang noch nicht entschieden ist.
- Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels.
- Die Klägerin stützt ihre Klage zum einen auf Anspruch 1 des Klagepatents, der jedoch nur beschränkt geltend gemacht wird. Der Anspruch lautet wie folgt (von der Klägerin zusätzlich aufgenommene Merkmale sind unterstrichen):
- Verfahren zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels (S) relativ zu einer zugehörigen Aufnahme (A), wobei das Befestigungsmittel (S) entlang seiner Längsachse (Z) über einen Weg (L) in die Aufnahme (A) eingebracht oder aus dieser herausgelöst wird, wobei die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels (S) relativ zur Aufnahme (A) erfolgt unter Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten ΔL/Δt oder ΔL/Δφ, wobei Δt eine zu erfassende Zeiteinheit und/oder Δφ eine zu erfassende Drehwinkeleinheit des um seine Längsachse (Z) gedrehten Befestigungsmittels (S) darstellt, während derer das Befestigungsmittel (S) eine zu erfassende Wegstrecke ΔL relativ zur Aufnahme (A) zurückgelegt, wobei die Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ eine Überwachung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ umfasst, und wobei unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ erkannt wird, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist.
- Wegen der weiteren, in Form von insbesondere-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche wird auf die Klageschrift beziehungsweise die geänderten Anträge in der Replik verwiesen.
- Darüber hinaus stützt die Klägerin ihre Klage auf Anspruch 8 des Klagepatents, der ebenfalls nur beschränkt geltend gemacht wird. Der Anspruch lautet wie folgt (von der Klägerin zusätzlich aufgenommene Merkmale sind unterstrichen):
-
Vorrichtung zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels (S) relativ zu einer zugehörigen Aufnahme (A), insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorigen Ansprüche, aufweisend
a) Antriebsmittel zum Fügen oder Lösen des Befestigungsmittels (S) in seiner Längsrichtung (Z) entlang eines Weges (L) in die Aufnahme (A) oder aus dieser heraus,
b) eine Steuereinheit zur Steuerung der Antriebsmittel,
c) Sensormittel zur Erfassung einer vom Befestigungsmittel (S) relativ zur Aufnahme (A) zurückgelegten Wegstrecke ∆L,
d) Sensormittel zur Erfassung der Zeit ∆t, während derer das Befestigungsmittel (S) die Wegstrecke ∆L zurücklegt und/oder Sensormittel zur Erfassung des Drehwinkels ∆φ, um welche sich das Befestigungsmittel (S) während der zurücklegten Wegstrecke ∆L um seine Längsachse (Z) dreht,
e) wobei die Steuereinheit zur Bildung und Überwachung des Differenzenquotienten ΔL/Δt oder ΔL/Δφ ausgebildet ist und dazu ausgebildet ist, unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ zu erkennen, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist. - Zur Veranschaulichung der erfindungsgemäßen Lehre wird nachfolgend die Figur 1 der Patentbeschreibung wiedergegeben, die in schematischer Darstellung den Verlauf von typischen Größen eines Verschraubungsverfahrens über die Zeit zeigt:
- Die Beklagte ist eine Wettbewerberin der Klägerin auf dem Gebiet der Schraubautomaten, die beispielsweise bei der industriellen Serienfertigung von Erzeugnissen, insbesondere in der Automobilfertigung, zum Einsatz kommen. Solche Schraubautomaten ermöglichen es, zwei oder mehrere Teile durch Schrauben automatisiert miteinander zu verbinden (fügen) oder eine solche Verbindung zu lösen. Die Beklagte übernahm den Geschäftsbereich Fügetechnik im Jahr 2018 von der A GmbH.
- Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen Herstellung und Vertrieb des Systems „B“ in Deutschland, bei dem es sich um ein System für das Fließlochschrauben handelt, bestehend aus einem Fügewerkzeug, einer Anlagensteuerung und einer Zuführeinheit (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Auf der Anlagensteuerung der angegriffenen Ausführungsform läuft die mit „C“ bezeichnete Software. Die Beklagte bewirbt die angegriffene Ausführungsform in deutscher Sprache auf ihrer Internetseite https://www.D.com/deXXX.
- Beim Fließlochschrauben werden mehrere, übereinander gestapelte Elemente – also gestapelte Werkstücke – mittels eines Befestigungsmittels mit Gewinde verbunden. Anders als bei einem herkömmlichen Verfahren verfügen die Werkstücke nicht über ein Innengewinde, sondern dieses wird mit dem Einbringen der Schraube erst geschaffen, wie aus der nachfolgenden Abbildung der Beklagten ersichtlich ist:
- Das fließlochformende Element wird zunächst auf dem obersten Werkstück positioniert und dann auf eine hohe Drehzahl beschleunigt. Die so erzeugte Bewegung der Spitze des fließlochformenden Elements erwärmt das Material des Werkstücks, wodurch das Bilden eines Durchzugs eingeleitet wird, wozu das fließlochformende Element mit hoher Drehzahl und Kraft durch die zu verbindenden Werkstücke gedrückt wird. Dann werden Drehzahl und Kraft reduziert, da die Gewindeformzone des fließlochformenden Elements zur Ausbildung eines Gewindes in der sich bildenden Aufnahme führt. Zum Schluss wird das fließlochformende Element über seine Gewindezone mit noch einmal reduzierter Drehzahl eingeschraubt und dann festgezogen. Auf diese Weise kann ein Stapel von zwei oder mehr Elementen verbunden werden, auch wenn er nur von einer Seite aus zugänglich ist.
- Die Klägerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Ausführungsform Anspruch 1 des Klagepatents mittelbar und den Anspruch 8 unmittelbar verletze.
- Sie meint, dass der im Klagepatent genannte Begriff der Aufnahme das Werkstück bezeichne, relativ zu welchem das Befestigungsmittel gefügt werden solle. Im Gegensatz dazu werde für das mit einem Innengewinde versehene Loch der Begriff der Ausnehmung verwendet. Daneben bezeichne der Differenzenquotient ΔL/Δt die Wegstrecke ΔL, die pro Zeitintervall Δt zurückgelegt werde, gebe also an, um welchen Wert sich die insgesamt zurückgelegte Wegstrecke in einem bestimmten Zeitintervall verändert habe. Dies gehe über eine bloße Längenmessung hinaus.
-
Sie meint, dass die angegriffene Ausführungsform die erfindungsgemäße Lehre verwirkliche. Denn das mit dieser durchgeführte Fügeverfahren umfasse nicht nur das Einbringen des Befestigungsmittels in eine anspruchsgemäße Aufnahme, also in ein Werkstück, sondern die Software C werte zudem einen Gradienten der Positionsdifferenz aus und nutze diesen, um ein Aufsetzen der Schraube auf dem Materialstapel zu detektieren, womit die zurückgelegte Wegstrecke in einem bestimmten Zeitintervall gemessen werde. Im Einzelnen sei die angegriffene Ausführungsform in der Lage, über einen Sensor die Position des Befestigungsmittels relativ zur Aufnahme zu erfassen, wobei die so gemessene Entfernung der Schraube zur Aufnahme als „Positionsdifferenz“ bezeichnet werde. Dies geschehe wiederholt innerhalb bestimmter Zeitintervalle, wobei die angegriffene Ausführungsform ein festes Zeitintervall nutze. Dadurch werde ein Gradient der Positionsdifferenz ermittelt, der von der Software mit „D“ abgekürzt werde. Ein Ausschlag des Werts D markiere eine Geschwindigkeitsänderung des Befestigungsmittels, weil sich die pro Zeiteinheit zurückgelegte Wegstrecke verändere. Durch die Auswertung dieses Differenzenquotienten erkenne die angegriffene Ausführungsform Veränderungen, insbesondere Abweichungen von der durchschnittlichen Geschwindigkeit des Befestigungsmittels im Verlauf des Fügeprozesses und reagiere entsprechend darauf.
Sofern die Beklagte diese Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform in Abrede stelle, sei ihr Vortrag unbeachtlich. Denn diese Funktionsweise ergebe sich aus den Schulungsunterlagen der A GmbH, die die Beklagte unverändert benutze und aus der Anzeige im Rahmen der „Hilfe“-Funktion. - Die Klägerin meint zudem, dass das Klagepatent rechtsbeständig sei.
- Die Klägerin beantragt,
- I. die Beklagte zu verurteilen,
- 1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,
- a) Vorrichtungen, welche geeignet sind zur Durchführung eines Verfahrens zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels relativ zu einer zugehörigen Aufnahme, wobei das Befestigungsmittel entlang seiner Längsachse über einen Weg in die Aufnahme eingebracht oder aus dieser herausgelöst wird, wobei die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels relativ zur Aufnahme erfolgt unter Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten ΔL/Δt oder ΔL/Δφ, wobei Δt eine zu erfassende Zeiteinheit und/oder Δφ eine zu erfassende Drehwinkeleinheit des um seine Längsachse gedrehten Befestigungsmittels darstellt, während derer das Befestigungsmittel eine zu erfassende Wegstrecke ΔL relativ zur Aufnahme zurücklegt, wobei die Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ eine Überwachung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ umfasst, und wobei unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ erkannt wird, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist,
- – DE 10 2007 024 XXX B3, Anspruch 1, eingeschränkte Fassung –
- Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern,
- b) Vorrichtungen zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels relativ zu einer zugehörigen Aufnahme, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorigen Ansprüche, aufweisend
-
a) Antriebsmittel zum Fügen oder Lösen des Befestigungsmittels in seiner Längsrichtung entlang eines Weges in die Aufnahme oder aus dieser heraus,
b) eine Steuereinheit zur Steuerung der Antriebsmittel,
c) Sensormittel zur Erfassung einer vom Befestigungsmittel relativ zur Aufnahme zurückgelegten Wegstrecke ΔL,
d) Sensormittel zur Erfassung der Zeit Δt, während derer das Befestigungsmittel die Wegstrecke ΔL zurücklegt und/oder Sensormittel zur Erfassung des Drehwinkels Δφ, um welche sich das Befestigungsmittel während der zurückgelegten Wegstrecke ΔL um seine Längsachse dreht,
e) wobei die Steuereinheit zur Bildung und Überwachung des Differenzenquotienten ΔL/Δt oder ΔL/Δφ ausgebildet ist und dazu ausgebildet ist, unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ zu erkennen, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist, - – DE 10 2007 024 XXX B3, Anspruch 8, eingeschränkte Fassung –
- in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
- 2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 02.01.2009 begangen hat, und zwar unter Angabe
- a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
- b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
- c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- wobei die Beklagte zum Nachweis der Angaben Rechnungen und für den Fall, dass keine Rechnungen vorhanden sind, hilfsweise Lieferscheine vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Daten außerhalb der Rechnungslegung geschwärzt werden dürfen;
- 3. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses in elektronischer Form vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 02.02.2009 begangen hat, und zwar unter Angabe
- a) der Herstellungsmengen und -zeiten für Handlungen nach Ziffer I. 1. b),
- b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,
- c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
- d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- e) der einzelnen Umsätze, die mit Zusatzleistungen (Schulungen, Wartungsverträge) in Bezug auf und mit Ersatzteilen für die unter Ziffer I.1. bezeichneten Gegenstände erzielt wurden,
- f) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;
- 4. die vorstehend unter Ziffer I. 1. b) bezeichneten, seit 02.01.2009 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse
- a) aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 10 2007 024 XXX B3 erkannt hat, aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und ihnen für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe verbindlich zugesagt wird, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – Kopien sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind, und
- b) aus den Vertriebswegen endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung dieser Erzeugnisse beim jeweiligen Besitzer auf Kosten der Beklagten veranlasst;
- 5. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten befindlichen, unter Ziffer I. 1. b) bezeichneten Erzeugnisse auf ihre – der Beklagten – Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
- II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 02.02.2009 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- Die Beklagte beantragt,
- die Klage abzuweisen;
- hilfsweise, das Verfahren bis zum Abschluss des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen;
- äußerst hilfsweise, der Beklagten nachzulassen, die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden;
- Die Beklagte trägt vor, dass die Klägerin ihren Verletzungsvorwurf auf Unterlagen der A GmbH zu dem System „C“ stütze, das sich von dem angegriffenen System „B“ der Beklagten unterscheide. Unabhängig davon ergebe sich aus diesen Unterlagen jedoch kein Verletzungstatbestand.
- Zunächst beschäftige sich die erfindungsgemäße Lehre mit dem Einbringen eines Befestigungsmittels in ein Werkstück und komme damit nicht zum Tragen, sofern es um die bloße Positionierung des Befestigungsmittels relativ zur Oberfläche gehe. Die Beklagte meint ferner, dass die erfindungsgemäße Lehre mit der Aufnahme nicht das Werkstück an sich meine, sondern etwas, was das Befestigungsmittel aufnehmen könne. Gemeint sei damit nicht zwingend ein Loch, sondern auch der Rand eines Lochs, der die Kopfauflage eines Schraubenkopfes verursache. Jedenfalls falle aber nicht die gesamte Oberfläche eines Werkstücks darunter. Die Beklagte meint zudem, dass die in der erfindungsgemäßen Lehre genannten Differenzenquotienten ∆L/∆t mehr als nur eine Längenmessung innerhalb eines vorbestimmten Zeitraums ermöglichen müssten. Denn aus dieser Information allein ergebe sich lediglich die mittlere Geschwindigkeit innerhalb dieses vorbestimmten Zeitraums, nicht aber Geschwindigkeitsveränderungen innerhalb dieses Zeitraums.
- Die angegriffene Ausführungsform sei nicht geeignet, das erfindungsgemäße Verfahren zu verwirklichen. Zunächst fehle es an einer Aufnahme, denn diese werde bei dem mittels des angegriffenen Systems verwirklichten Fließlochschrauben erst noch geschaffen. Bei der angegriffenen Ausführungsform werde zudem nur eine Weginformation verwendet, wobei der Weg gemessen werde, nachdem ein Maschinentakt beendet sei. Dabei habe das fließlochformende Element eine bekannte Position zur Werkoberfläche, was dazu führe, dass auch der Weg bekannt sei, den das fließlochformende Element optimal zurücklegen müsse, um zur Oberfläche des Werkstücks positioniert zu werden. Es werde also lediglich eine Wegauswertung vorgenommen.
-
Zur Positionierung des fließlochformenden Elements auf der Werkstückoberfläche werde in Form von vor dem Fließlochformen festzulegenden Programmparametern festgelegt, welchen maximalen Weg das fließlochformende Element in der vorgegebenen Zeit zurückgelegt haben dürfe. Dazu werde ausgewertet, ob die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke größer als eine vorgegebene Minimalstrecke und kleiner als eine vorgegebene Maximalstrecke sei. Dazu werde auf die Kenntnis der Position des Niederhalter-Schlittens (NH) und die Position des Haupthub-Schlittens (HH) abgestellt, woraus sich eine Wegstrecke ergebe, die mit den Programmparametern „Maximalüberstand“ und „Minimalüberstand“ verglichen werde.
Die Wegstrecke werde innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls ermittelt. Dies habe nichts mit der Ermittlung von ∆t im Sinne der Ermittlung einer Differenz aus zwei Zeitpunkten zu tun. - Abgesehen davon werde der Gradient der Positionsdifferenz, auf den die Klägerin abstelle, entgegen der Darstellung in den Schulungsunterlagen nicht als Steuerungsparameter eingesetzt. Zwar sei dies ursprünglich angedacht gewesen, aber aufgrund technischer Probleme nicht umgesetzt worden. Deshalb sei eine rein wegbasierte Steuerung gewählt und umgesetzt worden. Insofern werde der Gradient der Positionsdifferenz nicht nur bei der Positionierung der Schraube nicht genutzt, sondern auch nicht danach, wenn das Befestigungsmittel in den folgenden Schritten die Werkstücke durchdringe.
- Entscheidungsgründe
-
A
Die zulässige Klage ist unbegründet. -
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB.
I.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens, Absatz [0001] des Klagepatents (alle folgenden, nicht näher bezeichneten Absätze sind solche des Klagepatents). - Das Klagepatent beschreibt Fügeverfahren, insbesondere Schraubverfahren, als aus der Praxis hinlänglich bekannt. Bei den üblicherweise automatisierten Schraubvorgängen werde eine Schraube in eine dafür vorgesehene Ausnehmung einer Aufnahme eingeschraubt, was typischerweise mit einer entsprechenden Werkzeugvorrichtung geschehe, Absatz [0002]. Für derartige Vorrichtungen oder Verfahren sei bekannt, über Weg- bzw. Tiefensignale die Einschraubtiefe der Schraube zu erfassen und zu überwachen, damit sichergestellt werde, dass die Schraube nur bis zu einer bestimmten Einschraubtiefe mit einer vorgegebenen Drehzahl oder einem vorgegebenen Drehmoment eingeschraubt werde. Bekannt sei weiterhin die Erfassung des Drehmoments über geeignete Drehmomentsensoren oder den Motorstrom, wodurch das Anzugsmoment einer Schraube abgeleitet oder ermittelt beziehungsweise beschränkt werden könne. Auch die Erfassung des Drehwinkels beim Einschrauben einer Schraube an sich sei bekannt, Absatz [0003].
- Von besonderer Bedeutung bei derartigen Einschraubverfahren sei die Kopfauflage, worunter die Berührung eines Schraubenkopfes mit der die Schraube aufnehmenden Aufnahme zu verstehen sei. Erreiche der Schraubenkopf bei einem Schraubvorgang diese Auflageposition, so lasse sich die Schraube nur noch geringfügig weiter einschrauben, und das Drehmoment steige schnell an. Es sei daher erforderlich, die Einschraubtiefe der Schraube zu erfassen, um die Position des Schraubenkopfes relativ zur Aufnahme erfassen bzw. vorhersagen zu können. So könne beispielsweise eine Schraube mit einer erhöhten Drehzahl bis kurz vor die Kopfauflage eingeschraubt werden, um anschließend mit verminderter Drehzahl festgezogen zu werden. Die Drehzahlumschaltung diene in diesem Zusammenhang der Prozessoptimierung. Sie erfolge aus Zeitgründen zum spätest möglichen Zeitpunkt vor einem Anstieg des Drehmoments. Dabei müsse sichergestellt werden, dass die Drehzahlumschaltung noch so rechtzeitig erfolge, dass nicht mit zu hoher Drehzahl über den Zeitpunkt der Kopfauflage hinaus verschraubt und möglicherweise ein unzulässig hohes Drehmoment aufgebracht werde. Aus diesem Grunde sei es erforderlich, die genaue Lage des Schraubenkopfes relativ zur Aufnahme zu kennen bzw. zu ermitteln, Absatz [0004].
- Fertigungs- und applikationsbedingte Bauteiltoleranzen wirkten sich dabei nachteilig auf die exakten Lagebestimmungen des Schraubenkopfes – und somit auf den Fügeprozess – aus. Um alle Bauteiltoleranzen ausreichend berücksichtigen zu können, sei es in der Praxis daher bisher nötig gewesen, die Drehzahlumschaltung deutlich vor Erreichen der Kopfauflage vorzunehmen, obwohl dies eigentlich nur für die Bauteile mit den größten Fehlertoleranzen erforderlich wäre. Da die Drehzahlumschaltung daher meist früher als tatsächlich erforderlich erfolge, werde unnötig lange mit verringerter Drehzahl weiter verschraubt. Dadurch erhöhe sich nachteiliger Weise die Zykluszeit. Denkbar sei sogar, dass die Bauteiltoleranzen so groß seien, dass der komplette Schraubvorgang mit verminderter Drehzahl durchgeführt werden müsse, Absatz [0005].
- Als alternatives Mittel zur Detektion der Kopfauflage werde in der Praxis eine Drehmomentüberwachung vorgenommen. Bei ansteigendem Drehmoment werde dabei davon ausgegangen, dass die Schraube die Kopfauflage erreicht habe, wobei die Schraube bereits anziehe. Bei Verwendung des Momentes als Kriterium für die Drehzahlumschaltung müsse diese jedoch in einer nicht realisierbar kurzen Zeit geschehen, um bei der Verschraubung nicht über das Zielmoment hinaus zu verschrauben. Darüber hinaus erzeugten Schrauben in nicht vorgeschnittenen Gewinden (selbstformende oder selbstfurchende Schrauben) ein unregelmäßiges und mitunter hohes Drehmoment bereits vor Erreichen der Kopfauflage, so dass dieses Kriterium zur Drehzahlumschaltung nicht sinnvoll heranzuziehen sei, [0006].
- Vor diesem Hintergrund stelle sich die Aufgabe (das technische Problem), ein Verfahren zur besseren Ermittlung der Kopfauflage einer Schraube anzubieten, welches die vorgenannten Nachteile überwinde. Aufgabe sei daneben die Bereitstellung einer Vorrichtung, mit der das Fügeverfahren unter optimierter Detektion der Kopfauflage durchführbar sei, Absatz [0007].
- Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent mit dem von der Klägerin in eingeschränkter Fassung geltend gemachten Anspruch 1 ein Verfahren mit den folgenden Merkmalen vor:
- 1. Verfahren zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels (S) relativ zu einer zugehörigen Aufnahme (A),
- 1.1 wobei das Befestigungsmittel (S) entlang seiner Längsachse (Z) über einen Weg (L) in die Aufnahme (A) eingebracht oder aus dieser herausgelöst wird,
- 1.2 wobei die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels (S) relativ zur Aufnahme (A) unter Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten erfolgt,
- 1.2.1a ΔL/Δt, wobei Δt eine zu erfassende Zeiteinheit darstellt, während derer das Befestigungsmittel (S) eine zu erfassende Wegstrecke ΔL relativ zur Aufnahme (A) zurückgelegt, und/oder
- 1.2.1b ΔL/Δφ, wobei Δφ eine zu erfassende Drehwinkeleinheit des um seine Längsachse (Z) gedrehten Befestigungsmittels (S) darstellt, während derer das Befestigungsmittel (S) eine zu erfassende Wegstrecke ΔL relativ zur Aufnahme (A) zurücklegt,
- 1.2.2 wobei die Nutzung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ eine Überwachung des zu bildenden Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ umfasst, und
- 1.2.3 wobei unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ erkannt wird, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist.
- Daneben schlägt das Klagepatent mit dem von der Klägerin in eingeschränkter Fassung geltend gemachten Anspruch 8 eine Vorrichtung mit den folgenden Merkmalen vor:
- 8. Vorrichtung zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels (S) relativ zu einer zugehörigen Aufnahme (A), insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorigen Ansprüche, aufweisend
- 8.1 a) Antriebsmittel zum Fügen oder Lösen des Befestigungsmittels (S) in seiner Längsrichtung (Z) entlang eines Weges (L) in die Aufnahme (A) oder aus dieser heraus,
- 8.2 b) eine Steuereinheit zur Steuerung der Antriebsmittel,
- 8.3 c) Sensormittel zur Erfassung einer vom Befestigungsmittel (S) relativ zur Aufnahme (A) zurückgelegten Wegstrecke ΔL,
- 8.4. d) Sensormittel
- 8.4.1 zur Erfassung der Zeit Δt, während derer das Befestigungsmittel (S) die Wegstrecke ΔL zurücklegt und/oder
- 8.4.2 zur Erfassung des Drehwinkels Δφ, um welche sich das Befestigungsmittel (S) während der zurückgelegten Wegstrecke ΔL um seine Längsachse (Z) dreht,
- 8.5 e) wobei die Steuereinheit zur Bildung und Überwachung des Differenzenquotienten ΔL/Δt oder ΔL/Δφ ausgebildet ist und dazu ausgebildet ist, unmittelbar anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten ∆L/∆t oder ∆L/∆φ zu erkennen, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist.
- Die erfindungsgemäße Lehre soll den Vorteil bieten, dass eine Füge- oder auch Lösebewegung eines Befestigungsmittels relativ zu einer das Befestigungsmittel aufnehmenden Aufnahme besonders sicher und genau kontrolliert und gesteuert werden kann, Absatz [0009].
-
II.
Das Klagepatentanspruch 1 bedarf im Hinblick auf das in Merkmal 1 genannte „Verfahren zum Fügen oder Lösen“ (siehe unten, Ziff. 1) und hinsichtlich der in Merkmal 1 und 1.1 genannten „Aufnahme“ der Auslegung (siehe unten, Ziff. 2). Ferner ist der in Merkmal 1.2.1a genannte Differenzenquotient ∆L /∆t auslegungsbedürftig (siehe unten, Ziff. 3). Hinsichtlich der Auslegung der in Klagepatentanspruch 8 beschriebenen Vorrichtung ergeben sich nur wenige Abweichungen (siehe unten, Ziff. 4). -
1.
Das Merkmal 1 des Anspruchs 1 sieht ein Verfahren zum Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels relativ zu einer zugehörigen Aufnahme vor. Die Präposition „zum“ leitet dabei eine Zweckangabe ein. - Eine Zweckangabe definiert den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin, dass er geeignet sein muss, für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendet zu werden (BGH, GRUR-RS 2023, 21360, Rz. 48 – Schiebeverpackung). Bei Betrachtung des Merkmals 1 umreißt die darin enthaltene Zweckangabe in der hier allein interessierenden Variante „zum Fügen“, in welchem Bereich das erfindungsgemäße Verfahren Anwendung findet. Konkret geht es um das fertigungstechnische Fügen, bei dem Teile miteinander verbunden werden. So beschreibt auch Absatz [0001] Fügeverfahren als üblicherweise automatisierte Schraubverfahren. Präzisiert wird das erfindungsgemäße Fügeverfahren in den Merkmalen 1.1 und 1.2, die mit der Konjunktion „wobei“ zusätzliche Informationen einleiten und jeweils die nähere Ausgestaltung erläutern. Dazu gehört gemäß Merkmal 1.1, dass das Befestigungsmittel entlang seiner Längsachse über einen Weg in die Aufnahme eingebracht oder aus dieser herausgelöst wird. Das heißt, das erfindungsgemäße Verfahren fängt an, sobald das Befestigungsmittel beginnt, entlang seiner Längsachse in die Aufnahme eingebracht zu werden, mithin wenn die Schraube bereits aufliegt und in das Werkstück eintaucht. Bestätigt wird dies durch Merkmal 1.2, welches besagt, dass die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels relativ zur Aufnahme erfolgt unter Nutzung eines in den weiteren Merkmalen näher beschriebenen Differenzenquotienten. Der Begriff der Fügebewegung begrenzt das erfindungsgemäße Verfahren auf die konkrete Bewegung, mit der zwei Teile – etwa eine Schraube und ein oder mehrere Werkstücke – miteinander verbunden werden. Nur in diesem Zusammenhang erweist sich laut Klagepatent die Nutzung des Differenzenquotienten als sinnvoll. Denn es geht um die Prozessoptimierung im Zusammenhang mit dem Detektieren der Kopfauflage. Deren besondere Bedeutung hebt Absatz [0004] hervor und verweist darauf, dass eine Schraube bis kurz vor der Kopfauflage mit erhöhter Drehzahl eingeschraubt werden könne, um dann mit verminderter Drehzahl festgezogen zu werden. Aus diesem Grunde sei es erforderlich, die genaue Lage des Schraubenkopfes relativ zur Aufnahme zu kennen. Die Kopfauflage kann erst eintreten, nachdem die Schraube in das Werkstück eingetaucht ist, so dass das erfindungsgemäße Verfahren technisch sinnvoll erst mit eben diesem Eintauchen Anwendung findet. Alle vor dem Eintauchen stattfindenden Schritte sind somit nicht Teil des erfindungsgemäßen Verfahrens. Es wird auch an keiner Stelle im Rahmen der Beschreibung angesprochen, inwiefern die erfindungsgemäße Lehre hinsichtlich das Fügeverfahren vorbereitender Schritte vorteilhaft sein soll.
-
2.
Der Begriff der Aufnahme wird zunächst in Merkmal 1 genannt und sodann in Merkmal 1.1 wieder aufgegriffen, in welchem es heißt, dass ein Befestigungsmittel in die Aufnahme eingebracht wird. Der Begriff findet sodann wieder Erwähnung in den weiteren Merkmalen des Anspruchs 1. - Die Aufnahme ist nicht mit der Ausnehmung gleichzusetzen, sondern meint den Bereich des Werkstücks, in den das Befestigungsmittel eingebracht werden soll.
- Zunächst lässt sich dem Anspruch selbst keine entsprechende Beschränkung entnehmen. Dem Wortlaut nach deutet der Begriff der „Aufnahme“ nicht darauf hin, dass es sich um ein Loch oder Ähnliches handeln müsste. Technisch-funktional geht es um das Fügen oder Lösen eines Befestigungsmittels relativ zu einer zugehörigen Aufnahme. Würde sich die Aufnahme auf das Loch beschränken, würde dieses gewissermaßen luftleer im Raum hängen. Um aber überhaupt ein Loch als solches identifizieren zu können, muss dieses in Zusammenhang mit dem Bereich des Werkstücks gesehen werden, in welchem es sich befindet.
- Die Beschreibung erläutert bereits in Absatz [0002] einen Schraubvorgang dahingehend, dass eine Schraube in eine dafür vorgesehene Ausnehmung einer Aufnahme eingeschraubt wird. Damit unterscheidet auch die Beschreibung explizit zwischen der Aufnahme und der Ausnehmung. In Absatz [0004] heißt es sodann, dass unter einer „Kopfauflage“ die Berührung eines Schraubenkopfes mit der die Schraube aufnehmenden Aufnahme zu verstehen sei. Eine Berührung ist aber nur mit dem Werkstück, nicht mit dem Loch an sich, möglich. Nur so macht auch die in Absatz [0004] genannte Vorhersage beziehungsweise Ermittlung der Position des Schraubenkopfes relativ zur Aufnahme Sinn. Darüber hinaus nennt Absatz [0013] das Innengewinde der Aufnahme, was verdeutlicht, dass mit der Aufnahme der Bereich des Werkstücks gemeint ist, in welchen das Befestigungsmittel eingebracht wird. Außerdem nennt die Beschreibung explizit nicht vorgeschnittene Gewinde, zu denen selbstformende oder selbstfurchende Schrauben gehören und die damit keiner Ausnehmung bedürfen, Absatz [0006].
- Letztlich zeigt auch die Figur 2 und der diese Figur beschreibende Absatz [0038], dass es sich bei der Aufnahme um den Bereich des Werkstücks selbst handelt, in den das Befestigungsmittel eingebracht wird. Denn die darin gezeigte Aufnahme ist mit A gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung bezieht sich eindeutig nicht auf das Loch, sondern auf das dieses umgebende Material.
-
3.
Nach Merkmal 1.2 nutzt die erfindungsgemäße Lehre einen Differenzenquotienten, der eine zurückgelegte Wegstrecke entweder mit einem Zeitintervall, Merkmal 1.2.1a, oder einer Drehwinkeleinheit, Merkmal 1.2.1b, in Verhältnis setzt. Da sich der Verletzungsvorwurf allein auf den Differenzenquotienten ∆L/∆t stützt, beschränkt sich die hier vorgenommene Auslegung auf das Merkmal 1.2.1a. - Im Allgemeinen ergibt sich ein Delta (∆) aus der Differenz zwischen zwei (gemessenen) Werten. So stellt ∆L die Längendifferenz zwischen einer Anfangs- und einer Endposition dar, bezeichnet also eine bestimmte Wegstrecke. Merkmal 1.2.1a nennt insofern ausdrücklich die Wegstrecke, die das Befestigungsmittel S relativ zur Aufnahme A zurückgelegt hat. Daneben ergibt sich ∆t aus einer Differenzbetrachtung zweier Zeitpunkte, gibt also einen bestimmten Zeitraum an. Damit gibt der Differenzenquotient ∆L/∆t nichts Anderes an als die mittlere Geschwindigkeit, mit der sich das Befestigungsmittel während einer bestimmten Zeit relativ zur Aufnahme bewegt hat.
- Dies bestätigt auch die Beschreibung. Danach soll ∆L eine Wegstrecke sein, die das Befestigungsmittel relativ zur Aufnahme zurücklegt und ∆t soll der dafür benötigten Zeiteinheit entsprechen, Absatz [0009]. Mit anderen Worten soll eine Änderung der Vorschubgeschwindigkeit überwacht werden, Absatz [0010], wobei ein im Wesentlichen konstanter Wert ∆L/∆t eine im Wesentlichen konstante Vorschubgeschwindigkeit bedeutet, Absatz [0011]. Dies verdeutlicht auch die Figur 1, die im dritten Graphen die Einschraubtiefe L zeigt und im darunterliegenden Graphen den Differenzenquotienten ∆L/∆t beziehungsweise ∆L/∆φ. Dieser bleibt so lange konstant, wie die Einschraubtiefe in gleicher Weise zunimmt wie die Zeit. Dieses Verhältnis ändert sich ab dem Zeitpunkt tk, so dass sich der Quotient ∆L/∆t zu diesem Zeitpunkt im Wesentlichen auf null verändert, Absatz [0036]. Diese Veränderung kann dann zur Detektion der Kopfauflage herangezogen werden, Absatz [0037].
- Die Ermittlung der Wertänderung des Differenzenquotienten kann nach der Beschreibung des Klagepatents zyklisch oder im Wesentlichen permanent erfolgen, so dass Änderungen auch im Millisekundenbereich sofort erkennbar sind. Ferner kann die Ermittlung durch geeignete Grenzwerte oder Toleranzen auf den jeweiligen Fügevorgang abgestimmt werden, was durch die Vorgabe geeigneter Parameter, beispielsweise in einer Steuereinheit, realisiert werden kann, Absatz [0019]. Dadurch soll erreicht werden, dass die Einschraubdrehzahl nach Erreichen der Kopfauflage so schnell erfolgen kann, dass das Anzugsmoment beim Verspannen der Schraube erst auftritt, wenn die angepasste Drehzahl bereits eingestellt bzw. vorgegeben ist, Absatz [0020].
- Der Differenzenquotient ∆L/∆t dient also der Überwachung der momentanen Einschraubgeschwindigkeit zum Zweck der Detektion der Kopfauflage. Das Klagepatent lässt in diesem Zusammenhang offen, wie genau das Delta beziehungsweise die Differenzen ermittelt werden. Nicht notwendig ist, dass sowohl ∆L als auch ∆t aus variablen Anfangs- und Endpunkten bestehen. Möglich erscheint es vielmehr, für die Geschwindigkeitsmessung auf feste Zeitabschnitte abzustellen. Dann ergibt sich für ∆t immer der gleiche Wert und die Geschwindigkeit lässt sich aus der in diesem Zeitraum zurückgelegten Wegstrecke geteilt durch den Wert für das immer gleichbleibende Zeitintervall herleiten.
-
4.
Hinsichtlich der Auslegung der in Klagepatentanspruch 8 geschützten Vorrichtung gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Unterschiede ergeben sich nur hinsichtlich der Zweckangabe. - Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch belehren den Fachmann über den möglichen Einsatz- und Gebrauchszweck der patentierten Erfindung (BGH, GRUR 2010, 1081 – Bildunterstützung bei Katheternavigation). Sie können dabei so ausgestaltet sein, dass die durch das Patent geschützte Sache nicht nur räumlich-körperlich so ausgestaltet sein muss, wie es der Patentanspruch explizit formuliert, sondern dass die Sache darüber hinaus so ausgebildet sein muss, dass die im Patentanspruch erwähnte Wirkung oder Funktion herbeigeführt werden kann (BGH, GRUR 2009, 837 – Bauschalungsstütze; BGH GRUR 2021, 462 – Fensterflügel). Der Gegenstand muss demnach objektiv geeignet sein, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen (BGH, GRUR 2018, 1128, Rn. 12 – Gurtstraffer). Die Merkmale eines Vorrichtungsanspruchs definieren jedoch die geschützte Sache als solche, sodass der hierdurch definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, zu welchem Zweck er tatsächlich verwendet wird (vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 11.01.2022 – Az. X ZR 4/20, Rn. 50 mwN – SRS-Zuordnung). Dabei kommt es für eine Verletzung lediglich darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Unerheblich ist, ob diese regelmäßig, nur in Ausnahmefällen oder nur zufällig erreicht werden. Deshalb liegt eine Patentverletzung auch dann vor, wenn eine Vorrichtung regelmäßig so eingesetzt wird, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nicht eintreten (BGH, Urt. v. 13.12.2005 – Az. X ZR 14/02 – Rangierkatze).
- Anders als in Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch reicht es für die Verwirklichung des Klagepatentanspruchs 8 demnach aus, wenn die Vorrichtung geeignet ist, das erfindungsgemäße Fügen durchzuführen, selbst wenn der tatsächliche Einsatzzweck davon abweicht. Insbesondere muss die Vorrichtung geeignet sein, den Differenzenquotienten beim eigentlichen Fügevorgang zu ermitteln und zu überwachen und die Antriebsmittel entsprechend zu steuern. Die Anwendung des Differenzenquotienten beim Positionieren des Befestigungsmittels auf der Aufnahme genügt dafür nicht. Dies ergibt sich daraus, dass das Antriebsmittel zum Fügen oder Lösen des Befestigungsmittels in seiner Längsrichtung entlang eines Weges in die Aufnahme geeignet sein muss, Merkmal 8.1. Ein Fügen entlang des Weges in die Aufnahme setzt voraus, dass die Schraube bereits aufliegt und in das Werkstück eintaucht. Das hat ferner zur Folge, dass auch die in den Merkmalen 8.3, 8.4a und 8.5 genannten Sensormittel geeignet sein müssen, Δt und ΔL während genau dieses Fügevorgangs zu ermitteln, um den Differenzenquotienten zu berechnen und anzuwenden.
-
III.
Die angegriffene Ausführungsform verletzt weder Klagepatentanspruch 1 mittelbar noch Klagepatentanspruch 8 unmittelbar. Denn sie ist weder geeignet, das in Klagepatent 1 beschriebene Verfahren zu verwirklichen (siehe unten, Ziff. 1), noch stellt sie eine Vorrichtung im Sinne des Klagepatentanspruchs 8 dar (siehe unten, Ziff. 2). Zudem stellt das Zurverfügungstellen der Schulungsunterlagen keine patentverletzende Angebotshandlung dar (siehe unten, Ziff. 3). -
1.
Die angegriffene Ausführungsform stellt kein Mittel zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Klagepatentanspruch 1 dar. -
a)
Das entsprechende Verfahren verwirklicht bereits die Merkmale 1 bis 1.2 nicht. - Nach dem Vortrag der Klägerin überwacht das angegriffene System „B“ mit der darauf installierten Software „C“ mittels eines Gradienten einer Positionsdifferenz (im Folgenden auch „D“ genannt) die innerhalb einer bestimmten, gleichbleibenden Maschinentaktung zurückgelegte Wegstrecke, wobei das Abfallen des Gradienten eine Bewegung anzeigt und beim anschließenden Wiederansteigen des Gradienten das Aufsetzen der Schraube am Werkzeugteil als erkannt gilt. Die Klägerin trägt vor, dass die angegriffene Ausführungsform das Aufsetzen der Spitze des fließlochformenden Elements auf dem Werkstück detektiere, um einen definierten Fügeprozess zu gewährleisten. Dies sei notwendig, weil das fließlochformende Element, wenn es vom Haupthub-Schlitten gehalten werde, keine definierte Position zur Oberfläche des Werkstücks habe. Das liege unter anderem daran, dass bei jedem Einspannen eines neuen fließlochformenden Elements die Winkelstellung dieses Elements relativ zum Haupthub-Schlitten und damit zur Oberfläche des Werkstücks leicht unterschiedlich sei und die exakte Position der Spitze von Fertigungsungenauigkeiten und Toleranzen abhänge. Denn zwischen einzelnen fließlochformenden Elementen gebe es immer gewisse Längen- und Formunterschiede, selbst wenn es sich nominell um das gleiche Produkt handele.
- Selbst wenn man diesen Vortrag als unstreitig zu Grunde legte, wäre damit eine Verwirklichung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht dargetan. Denn das klagepatentgemäße Verfahren beginnt erst mit dem Fügevorgang an sich, also sobald das Befestigungsmittel in das Werkstück eintaucht. Hingegen endet die Detektion der Position der Schraube nach dem Vortrag der Klägerin bereits mit dem Aufsetzen derselben auf das Werkstück.
- Daran ändert auch die von der Klägerin behauptete, mit dem Aufsetzen der Schraube erfolgende, Drehmomentänderung nichts. Denn auch diese ist allein abhängig von dem Aufsetzen der Schraube auf dem Werkstück und ist nötig, um überhaupt erst mit dem Fügevorgang an sich zu beginnen. Es handelt sich demnach nicht um die innerhalb des Fügevorgangs vorgenommene Drehmomentänderung, die bei der Detektion der Kopfauflage vorgenommen wird.
-
b)
Daneben fehlt es auch an der Verwirklichung der weiteren Merkmale. Die angegriffene Ausführungsform dient zwar dem Fügen eines Befestigungsmittels in eine Aufnahme und kennt einen Differenzenquotienten gemäß der Merkmale 1.2 bis 1.2.2. Jedoch erfolgt weder die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels unter Nutzung dieses Differenzenquotienten (Merkmal 1.2), noch dient er dazu, zu erkennen, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist (Merkmal 1.2.3). Dies gilt sowohl für den eigentlichen Fügevorgang, für den auch die Klägerin nicht behauptet, dass dieser über einen Differenzenquotienten gemäß der Merkmale 1.2 und 1.2.3 gesteuert wird, als auch für den zeitlich vorgelagerten Abschnitt, in dem das Befestigungsmittel auf dem Werkstück positioniert wird und auf den sich die Klägerin im Wesentlichen stützt. -
aa)
Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Klägerin führt die angegriffene Ausführungsform mit dem D während fester Zeitintervalle (Maschinentakt von 10ms) wiederholt eine Längenmessung durch. Während eine Messung allein die während eines Maschinentakts zurückgelegte Positionsdifferenz ermittelt, wird der Gradient durch die wiederholte Messung gebildet; denn diese zeigt, ob sich die während der Bewegung zurückgelegte Strecke ändert oder nicht. - Damit nimmt der von der Software „C“ verwendete D nur eine reine Längenmessung vor und wertet diese aus, wohingegen der erfindungsgemäße Differenzenquotient die Ermittlung der Geschwindigkeit erfordert. Um zu dem erfindungsgemäßen Differenzenquotienten zu gelangen, müsste der D also noch einmal durch den Maschinentakt von 10ms geteilt werden. Dass dies geschieht, hat die Klägerin nicht behauptet und ist auch anderweitig nicht ersichtlich.
- Dieser zusätzliche – in der Teilung durch 10 ms liegende – Schritt bietet jedoch keinen Erkenntnisgewinn, da die Taktzeiten, in denen die Weglängen gemessen werden, identisch sind. Da es technisch-funktional keinen Unterschied macht, ob direkt mit den gemessenen Weglängen gearbeitet wird oder ob diese noch einmal durch die Zeit geteilt werden, liegt, wenn man in dem Gradienten der Positionsdifferenz keine wortsinngemäße Verwirklichung des patentgemäßen Differenzenquotienten sehen wollte, jedenfalls eine äquivalente Verletzung vor. Denn die Wirkung ist für die Zwecke der technischen Lehre gleich. Die Verwendung des Positionsgradienten wie in der angegriffenen Ausführungsform ist für einen Techniker naheliegend, denn er ist rechnerisch ohne weiteres ermittelbar. Die Gleichwertigkeit liegt ebenfalls vor, weil sich an der Methodik und Funktion der erfindungsgemäßen Lehre insgesamt und des in Rede stehenden Merkmals im Einzelnen überhaupt nichts ändert. Es wird ein umgerechneter, mathematisch gleichwertiger Parameter verwendet. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass die wiederholte Messung in gleichbleibenden zeitlichen Abständen der in Absatz [0019] beschriebenen Vorgehensweise entspricht, nach der die Ermittlung des Differenzenquotienten entweder zyklisch oder permanent erfolgen kann und damit zeitlich gleichbleibende Messabstände ausdrücklich vorgesehen sind.
-
bb)
Eine Verwirklichung von Merkmal 1.2, wonach die Steuerung der Füge- oder Lösebewegung des Befestigungsmittels unter Nutzung dieses Differenzenquotienten erfolgen soll, und Merkmal 1.2.3, nach welchem anhand einer Verringerung des überwachten Differenzenquotienten erkannt wird, dass das Befestigungsmittel auf ein Hindernis getroffen ist, lässt sich jedoch nicht feststellen. - Die Klägerin trägt vor, dass sich eine derartige Funktion sowohl aus den Schulungsunterlagen der Beklagten ergebe als auch aus der „Hilfe“-Funktion der Software „C“, die insofern mit den Schulungsunterlagen identisch sei. Sie meint, dass der anderslautende Vortrag der Beklagten, demgemäß die angegriffene Ausführungsform nicht funktioniere wie in den Schulungsunterlagen, inkonsistent und daher unbeachtlich sei. Schließlich würden durch die Schulungsunterlagen Fachkreise informiert, die sich auf die darin beschriebene Funktionsweise verlassen würden. Die Beklagte würde hingegen inkonsistent vortragen, da sie zunächst eine den Schulungsunterlagen entsprechende Funktionsweise gar nicht in Abrede gestellt und im Laufe des Verfahrens ihre Argumentation mehrfach geändert habe. Jedoch erscheine es nicht plausibel, dass die in den Schulungsunterlagen beschriebene Prüfung nicht stattfinde. Schließlich müsse überprüft werden, ob eine Schraube vorhanden sei und auf der Oberfläche des Werkstücks aufgesetzt habe. Insofern sei der Vortrag der Beklagten unvollständig und widersprüchlich.
- Angesichts des hinreichend substantiierten Vortrags der Beklagten hat die Klägerin der ihr obliegenden Darlegungslast nicht genügt. Nach § 138 Abs. 2 ZPO hat sich jede Partei über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. Diese Erklärung muss – wie jede Erklärung über tatsächliche Umstände – vollständig und der Wahrheit gemäß abgegeben werden, § 138 Abs. 1 ZPO. Kein erhebliches Bestreiten stellt es dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstantiiert.
- Die Beklagte hat sich vorliegend jedoch nicht auf ein bloß pauschales Bestreiten des klägerischen Vortrags zurückgezogen, sondern substantiiert zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorgetragen, wobei sie ihren Vortrag im Laufe des Verfahrens immer weiter präzisiert hat. In der Klageerwiderung hat sie bereits ausgeführt, dass der Hub-Schlitten zur Positionierung des fließlochformenden Elements auf der Werkstückoberfläche mit geringer Kraft über eine fest vorgegebene Zeit im Niederhalter vorgeschoben werde, wodurch das fließlochformende Element zur Werkstückoberfläche verfahren werde. Erst im Anschluss finde die Auswertung der Messsysteme statt. Die Beklagte hat ihren Vortrag später dahingehend korrigiert, dass die vorgegebene Zeit nicht – wie noch in der Klageerwiderung angegeben – bei 5ms liege, sondern bei 100ms. Jedoch hat sie – anders als von der Klägerin behauptet – bereits in der Klageerwiderung vorgetragen, dass sich die Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform nicht aus den Schulungsunterlagen ergebe. Sie hat weiter klargestellt, dass die angegriffene Ausführungsform nach Ablauf der voreingestellten Zeit nur den gesamten Weg kontrolliere und die ermittelte Wegstrecke L mit einem Minimalüberstand und einem Maximalüberstand vergleiche. Ferner hat die Beklagte im Rahmen der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage zu Protokoll gegeben, dass die angegriffene Ausführungsform in allen Schritten von Finden bis Endanzug keine wiederholten einzelnen Streckenmessungen während kurzer Zeitintervalle vornehme und deren Veränderung auswerte, mithin keinen Differenzenquotienten oder Gradienten der Positionsdifferenz auswerte, sondern die zurückgelegte Gesamtstrecke messe und für die Steuerung verwende. Der D werde zwar angezeigt, aber nicht zur Steuerung verwendet.
- Im Hinblick auf das konkrete Bestreiten der Beklagten hätte es der Klägerin oblegen, aufzuzeigen, dass der D wie in den Schulungsunterlagen angegeben zur Ermittlung des Auftreffens der Schraube auf ein Hindernis genutzt wird. Dies ist der Klägerin nicht gelungen, obwohl sie in Besitz der Software „C“ war. Sie konnte zwar anhand eines Screenshots aufzeigen, dass der D gebildet wird, der mit dem erfindungsgemäßen Differenzenquotienten gleichgesetzt werden kann. Jedoch konnte sie nicht aufzeigen, dass dieser Wert dafür verwendet wird, ein Aufsetzen der Schraube auf dem Werkstück tatsächlich zu erkennen, geschweige denn das Drehmoment oder die Winkelgeschwindigkeit bei Erreichen der Kopfauflage zu steuern.
-
cc)
Da die Klägerin ihrer Darlegungslast insoweit nicht genügt hat, kommt auch die von ihr beantragte Vorlageanordnung nach § 142 ZPO nicht in Betracht. Nach § 142 Abs. 1 Var. 1 ZPO kann das Gericht die Vorlage von Urkunden im Besitz einer der Parteien anordnen. Die Anordnung steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts und kann den Zweck verfolgen, undeutliches oder lückenhaftes Tatsachenvorbringen der Parteien zu klären; sie gibt dem Gericht jedoch nicht die Befugnis, unabhängig von einem schlüssigen Vortrag zum Zwecke der Informationsgewinnung Urkunden anzufordern; dies würde eine prozessordnungswidrige Ausforschung darstellen (MüKoZPO/Fritsche, 6. Aufl. 2020, ZPO §§ 142-144 Rn. 1). Wie aufgezeigt fehlt es hier bereits an einem ausreichend substantiierten Vortrag der Klägerin, weshalb die Urkundenanordnung nicht angezeigt war. -
2.
Für die Verwirklichung der Merkmale des Vorrichtungsanspruchs 8 gelten die obigen Ausführungen entsprechend. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass die Zweckangabe im Rahmen eines solchen Vorrichtungsanspruchs anders zu behandeln wäre. Denn auch nach Anspruch 8 muss die Eignung der Vorrichtung bestehen, zum Fügen eines Befestigungsmittels relativ zu einer zugehörigen Aufnahme eingesetzt zu werden. Diese Eignung liegt nicht vor, wie unter Ziffer 1. a) ausgeführt wurde. -
3.
Selbst wenn man für den Verletzungsvorwurf der Klägerin allein auf die Schulungsunterlagen (rop6) sowie die entsprechenden Anzeigen in der „Hilfe“-Funktion der Software „C“ abstellte mit dem Gedanken, dass die Beklagte jedenfalls patentgemäße Geräte angeboten habe, ergibt sich kein anderes Ergebnis. -
a)
Aus den Schulungsunterlagen und der „Hilfe“-Funktion der Software für sich genommen ergibt sich keine Verwirklichung der Merkmale der Klagepatentansprüche 1 oder 8. Denn auch das in den Schulungsunterlagen beschriebene Verfahren betrifft nicht das patentgemäße Fügeverfahren, da es mit dem Erkennen des Auftreffens des Befestigungsmittels auf ein Hindernis endet. Das Verfahren nach Anspruch 1 des Klagepatents beschränkt sich jedoch auf den eigentlichen Füge- bzw. Lösevorgang beginnend mit dem Zeitpunkt, ab dem das Befestigungsmittel in das Werkstück eintaucht. Bei diesem Vorgang muss der Differenzenquotient verwendet werden, was die Schulungsunterlagen und die „Hilfe“-Funktion nicht zeigen. Gleiches gilt für den Anspruch 8 des Klagepatents, der eine Vorrichtung zum Gegenstand hat, die jedenfalls geeignet sein muss, den Differenzenquotienten für das eigentliche Fügeverfahren zu verwenden. -
b)
Zudem ist weder in den Schulungsunterlagen noch in der die Software „C“ begleitenden „Hilfe“-Funktion überhaupt eine Angebotshandlung im Sinne von §§ 9 S. 2 Nr. 1, 10 Abs. 1 PatG zu sehen. - Das Anbieten ist eine eigenständige Benutzungsart, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 – Simvastin; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 419 – Cholesterinspiegelsenker). Der Begriff des Anbietens ist rein wirtschaftlich zu verstehen. Er umfasst jede im Inland begangene Handlung, die nach ihrem objektiven Erklärungswert den Gegenstand der Nachfrage in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. März 2014 – I-15 U 19/14 = = GRUR-RS 2014, 16067). Maßgeblich ist, ob mit der fraglichen Handlung tatsächlich eine Nachfrage nach dem schutzrechtsverletzenden Gegenstand geweckt wird, die zu befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Voraussetzung für ein Anbieten ist grundsätzlich nicht das tatsächliche Bestehen einer Lieferbereitschaft (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte) oder ob das Angebot Erfolg hat, es also nachfolgend zu einem Inverkehrbringen kommt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 6. Oktober 2016 – I-2 U 19/16 – Rn. 97 bei Juris m.w.N.).
-
aa)
Nach diesen Grundsätzen ist in den Schulungsunterlagen keine Angebotshandlung zu sehen. Solche Unterlagen werden typischerweise erst nach dem Kauf eines Schraubautomaten zur Verfügung gestellt bzw. gezeigt und können damit keine Nachfrage wecken. Die Beklagte hat zudem vorgetragen, dass die Schulungsunterlagen nicht von ihr stammten, sondern von ihrer Rechtsvorgängerin, der A GmbH. Derartige Unterlagen würden von ihr – der Beklagten – grundsätzlich zur Schulung an der Maschine verwendet. Die Beklagte hat ferner zu Protokoll gegeben, dass die Schulungsunterlagen (rop6) weder im Internet noch zu Ausschreibungszwecken an potentielle Abnehmer herausgegeben worden seien. - Dem ist die Klägerin nicht erheblich entgegengetreten. Auch nach dem Vortrag der Klägerin standen die von ihr in Form der Anlage rop6 zur Akte gereichten Unterlagen nicht frei im Internet zum Download zur Verfügung und konnten damit nicht einfach vom interessierten Publikum eingesehen werden. Sofern die Klägerin meint, dass derartige Schulungsunterlagen typischerweise im Rahmen von Ausschreibungen oder danach zur Verfügung gestellt würden, handelt es sich um eine reine Vermutung. Sie hat jedenfalls nicht aufgezeigt, dass dies tatsächlich auch für die Schulungsunterlagen der Beklagten zutraf.
- Noch weniger kann die Beschreibung im Rahmen der „Hilfe“-Funktion der Software „C“ eine Angebotshandlung begründen, da diese erst nach dem Kauf der angegriffenen Ausführungsform einsehbar ist.
-
bb)
Auch in der Weiterverwendung der Bezeichnung „B“ für die angegriffene Ausführungsform und „C“ für die zugehörige Software kann keine Angebotshandlung gesehen werden. - Zwar kann eine Werbeabbildung, die in der Vergangenheit für ein Schutzrecht verletzendes Erzeugnis eingesetzt wurde, sich in unveränderter Form auch auf einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen, wenn die angesprochenen Kreise das beworbene Erzeugnis bei objektiver Betrachtung als schutzrechtsverletzend ansehen (BGH, GRUR 2005, 665, LS 2 – Radschützer; GRUR 2003, 1031 – Kupplung für optische Geräte).
- Das ist hier jedoch nicht der Fall. Bis auf die Lieferung eines Prototyps durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat es nie eine Ausführung entsprechend den Schulungsunterlagen auf dem Markt gegeben. Auf Grund der Komplexität derartiger Geräte können die Verkehrskreise nicht davon ausgehen, dass die Maschinen dauerhaft in unveränderter Form angeboten werden und die Steuerung keine Änderungen erfährt. Dies wird durch den Vortrag der Beklagten bestätigt, die erklärt hat, dass nach dem Vortrag der Beklagten interessierte Fachleute nicht jede einzelne Seite von Schulungsunterlagen zur Grundlage ihrer Kaufentscheidung machten, sondern die Funktionalität der zu verkaufenden Schraubautomaten gemeinsam erarbeitet werde.
-
B
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. - Der Streitwert wird gemäß § 51 Abs. 1 GKG auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.