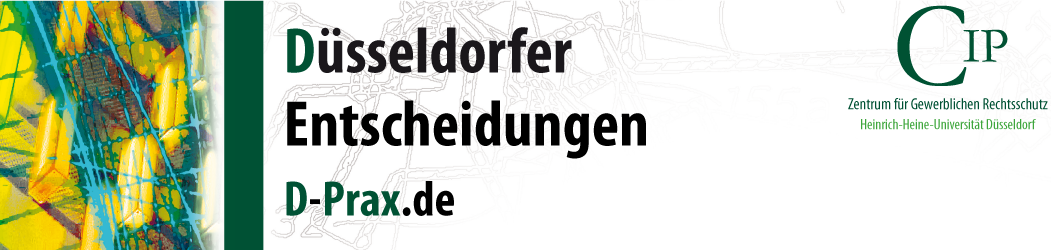Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3393
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 30. Oktober 2024, Az. 4b O 56/14
- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Streithelferin. Diese trägt die Streithelferin selbst.
- III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
- Tatbestand
-
Die Klägerin macht gegen die Beklagte wegen einer von ihr behaupteten Verletzung des deutschen Teils (DE 60 2008 XXX 911) des europäischen Patents 2 XXX 744 (Klagepatent, Anlage EIP D1, deutsche Übersetzung Anlage EIP D1a) Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung geltend und begehrt die Feststellung der Schadensersatzpflicht.
Das Klagepatent wurde am 07.10.2008 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 08.01.2008 von der Streithelferin in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Patentanmeldung wurde am 22.09.2010 veröffentlicht, der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 22.05.2013. Am 17.04.2014 (Veröffentlichungstag) wurde die Klägerin als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen. Mit Urteil vom 04.09.2018 – X ZR 14/17 – änderte der Bundesgerichtshof das auf die Nichtigkeitsklage ergangene Urteil des Bundespatentgerichts vom 20.09.2016 ab und hielt das Patent in abgewandelter Form aufrecht (Anlage FF D13).
Das in englischer Verfahrenssprache verfasste Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Anordnung in einem Funkkommunikationsnetzwerk. Der von der Klägerin hier allein geltend gemachte Patentanspruch 12 lautet in der deutschen Übersetzung wie folgt:
Erster Knoten (110), umfassend eine Anordnung (400) zum Anfordern eines Statusberichts von einem zweiten Knoten (120), wobei der erste Knoten (110) und der zweite Knoten (120) beide für ein drahtloses Kommunikationsnetz (100) verwendet werden, der Statusbericht positive und/oder negative Bestätigung von Daten umfasst, die vom ersten Knoten (100) gesendet werden und die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen, und wobei die Anordnung umfasst:
einen Sender (406), der so ausgelegt ist, dass er eine Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten sendet, die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen,
wobei die Anordnung ferner umfasst:
einen Zählmechanismus (407), der so ausgelegt ist, dass er die Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und die Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählt,
eine Anforderungseinheit (410), die so ausgelegt ist, dass sie einen Statusbericht vom zweiten Knoten (120) anfordert, wenn die gezählte Anzahl von gesendeten Dateneinheiten einen ersten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, oder die gezählte Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten einen zweiten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, und
eine Rücksetzeinheit, die angepasst ist, um den Zählmechanismus zurückzusetzen, um dadurch sowohl die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten als auch die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes zurückzusetzen, wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten den ersten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist, oder wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes den zweiten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist.
(Anspruch 12) - Die nachstehend wiedergegebene Zeichnung stammt aus der Klagepatentschrift und zeigt ein Blockdiagramm, das eine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anordnung in einem ersten Knoten darstellt.
-
Die Beklagte gehört zur A-Gruppe, die LTE-fähige Mobiltelefone wie das A XXX (angegriffene Ausführungsform) herstellt und auch auf dem deutschen Markt vertreibt, unter anderem über ihre Internetseite unter der Domain www.A.com, auf der die angegriffene Ausführungsform beworben und zum Verkauf, auch in der Bundesrepublik Deutschland, angeboten wird (Anlage EIP D8). Die Domain-Adresse www.A.com gehört der A Corporation, der Muttergesellschaft der Beklagten. Allerdings wurde die Beklagte jedenfalls bis zum 27.03.2016 im Impressum aufgeführt (Anlage EIP D8).
Mit der Klage greift die Klägerin sämtliche von den Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen und vertriebenen LTE-fähigen Mobiltelefone an.
Bei LTE (Long Term Evolution) handelt es sich um einen von der ETSI geschaffenen Mobilfunkstandard. Die für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche technische Spezifikation des Standards ist die Technical Specification (TS) 136 322 ab der Version V8.1.0. Die TS 136 322 V8.8.0 liegt als Anlage EIP D11 (in deutscher [Teil-]Übersetzung als Anlage EIP D11a) vor (nachfolgend vereinfacht: LTE-Standard). Die Spezifikation betrifft das Radio Link Control (RLC) protocol des Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E_UTRA). Die angegriffene Ausführungsform genügt den Anforderungen dieser technischen Spezifikation, für deren Einzelheiten auf die Anlagen EIP D11 und EIP D11a verwiesen wird.
Am 15.04.2015 schlossen die B, LLC und die A Corporation unter Einbeziehung von verbundenen Unternehmen für die Dauer von zwei Jahren bis zum 15.04.2017 ein Global Patent License Agreement (GPLA), mit dem der A Corporation und ihren verbundenen Unternehmen eine Lizenz an allen unter anderem für den LTE-Standard essentiellen oder jedenfalls als essentiell deklarierten Patenten, soweit diese zu irgendeinem Zeitpunkt von der Streithelferin erworben wurden oder werden oder auch nur zu Eigentum gehalten oder kontrolliert wurden oder jedenfalls von ihr lizenzierbar waren. Der GPLA enthielt neben der eigentlichen Lizenz auch Nichtangriffs- und Freistellungsabreden für die Vergangenheit und in Ziffer 10.2 eine Schiedsabrede. Wegen der Einzelheiten des GPLA wird auf die Anlage FF DH 55, in deutscher Übersetzung FF DH 55a Bezug genommen.
Im Jahr 2016 veräußerte die C, Inc., die Muttergesellschaft der Klägerin, ihr IP-Lizenzgeschäft, darunter auch die Klägerin. Erwerberin war die D, LLC, die zusammen mit der B, LLC von der E, LLC gehalten wird.
Die Klägerin sieht in dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents. LTE-fähige Mobiltelefone und Basisstationen verwirklichten zwangsläufig die Lehre des Klagepatents. Denn der LTE-Standard setze zwingend voraus, dass ein Mobiltelefon oder eine Basisstation, die den Anforderungen des LTE-Standards genügen, von der Lehre des Klagepatents Gebrauch machten. Unter anderem weise die angegriffene Ausführungsform einen Zählmechanismus im Sinne des Klagepatents auf. Nach dem LTE-Standard werde beim Zusammenstellen der PDUs, also der Dateneinheiten, jeweils der Zähler PDU_WITHOUT_POLL für jede PDU und der Zähler BYTE_WITHOUT_POLL in Abhängigkeit von der Menge der Bytes inkrementiert. Dass nach dem LTE-Standard die Dateneinheiten und Bytes nicht im Zeitpunkt ihrer (physischen) Übertragung vom Mobilfunkgerät an den eNodeB oder umgekehrt gezählt werden, sei unschädlich. Unter dem im Klagepatentanspruch genannten Übermitteln der Dateneinheiten („transmission“) verstehe der Fachmann die Weitergabe der PDUs von der RLC-Schicht an die darunterliegenden Schichten (wie die Medium Access Control (MAC)-Schicht). Es reiche daher aus, wenn die Dateneinheiten und Bytes im Zeitpunkt ihrer Zusammenstellung („upon assembly“) gezählt würden. Technisch ergebe sich kein Unterschied zu einer Zählung bei Übertragung an die nächste Schicht.
Mit dem im Klagepatentanspruch verwendeten Begriff der „Datenbytes“ sei nur der Payload einer Dateneinheit gemeint, nicht aber dessen Header, der nur Steuerinformationen enthalte. Die Lehre des Klagepatents umfasse daher auch Ausführungsformen, wie vom LTE-Standard vorausgesetzt, die nur die Bytes des Datenfeldes und nicht die des Headers zählten. Abgesehen davon sei es für die Beurteilung des Speicherfüllstandes irrelevant, ob die Bytes des Headers mitgezählt würden oder nicht. Denn der Header mache durchschnittlich nur 0,33 % der Größe einer RLC-PDU aus.
Zur Passivlegitimation der Beklagten behauptet die Klägerin, die Beklagte selbst biete die angegriffene Ausführungsform in Deutschland an und vertreibe sie. Jedenfalls aber fördere sie durch ihr Handeln die Vertriebstätigkeit der A Corporation in Deutschland. Für die als Anlage EIP D8 vorgelegten Internetseiten www.A.com werde als Verantwortliche die Beklagte genannt. Dies stimme überein mit den Angaben im Handelsregister, wonach die Beklagte verantwortlich sei für den Vertrieb, den Kundendienst sowie die Verkaufs- und Marketingunterstützung. Die A Corporation zeige auf ihrer Internetseite Smartphones des LTE-Standards, die über die streitgegenständliche Technologie verfügten. Dies sei ausreichend, um die Beklagte in der geltend gemachten Weise in Anspruch nehmen zu können.
Auf die Schiedseinrede aus dem GPLA könne sich die Beklagte nicht mit Erfolg berufen, weil sie – die Klägerin – im Zeitpunkt des Abschlusses des GPLA keine Tochtergesellschaft der F-Gruppe gewesen sei und daher nicht in das GPLA einbezogen sei und infolgedessen auch das Klagepatent nicht vom GPLA erfasst sei.
Die Klägerin hat die Klage ursprünglich auch auf die Ansprüche 1, 3, 4, 5, 6, 9 und 10 des Klagepatents gestützt sowie einen Antrag auf Urteilsveröffentlichung angekündigt. Nach Rücknahme dieser Anträge mit Zustimmung der Beklagten sowie eines erweiterten Auskunftsantrags beantragt die Klägerin nunmehr, - I.
die Beklagte zu verurteilen, ihr Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie seit dem 22.06.2013
erste Knoten in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,
die eine Anordnung zum Anfordern eines Statusberichts von einem zweiten Knoten umfassen, wobei der erste Knoten und der zweite Knoten beide für ein drahtloses Kommunikationsnetz verwendet werden, der Statusbericht positive und/oder negative Bestätigung von Daten umfasst, die vom ersten Knoten gesendet werden und die durch den zweiten Knoten empfangen werden sollen,
wenn die Anordnung einen Sender, der so ausgelegt ist, dass er eine Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten sendet, die durch den zweiten Knoten empfangen werden sollen, ferner einen Zählmechanismus, der so ausgelegt ist, dass er die Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und die Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählt, und eine Anforderungseinheit, die so ausgelegt ist, dass sie einen Statusbericht vom zweiten Knoten anfordert, wenn die gezählte Anzahl von gesendeten Dateneinheiten einen ersten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, oder die gezählte Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten einen zweiten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht, umfasst, und eine Rücksetzeinheit, die angepasst ist, um den Zählmechanismus zurückzusetzen, um dadurch sowohl die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten als auch die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes zurückzusetzen, wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten den ersten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist, oder wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes den zweiten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist,
(Anspruch 12 des Klagepatents) - wobei die Auskunft in Form einer geordneten Aufstellung gegenüber der Klägerin zu erfolgen hat, und zwar, soweit zutreffend, unter Angabe
a) der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, aufgeschlüsselt nach der jeweiligen Menge, Zeiten, Preisen sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Fall von Internetwerbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne;
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns; - wobei die Beklagte die Richtigkeit ihrer Angaben nach a) und b) belegen muss, indem sie Belegkopien von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen vorlegt, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen, und
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- II.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die der C LLC durch die vom 22.06.2013 bis zum 26.02.2014 begangenen und der Klägerin durch die seit dem 27.02.2014 begangenen, unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden. - Die Beklagte beantragt,
- die Klage abzuweisen.
- Die Beklagte erhebt die Einrede der entgegenstehenden Schiedsvereinbarung. Das GPLA beziehe auch solche Unternehmen ein, die erst nach Vertragsschluss verbundene Gesellschaften der Vertragsparteien wurden. Das sei bei der Klägerin der Fall, die zudem – nach ihrer Behauptung – ein für den LTE-Standard essentielles Patent geltend mache, das vormals im Eigentum der Streithelferin gestanden habe. Jedenfalls könne sich die Beklagte erfolgreich auf eine Lizenz bzw. eine Nichtangriffsabrede für den gesamten Verletzungszeitraum bis zum Ablauf des GPLA berufen.
Im Hinblick auf die Passivlegitimation behauptet die Beklagte, sie sei weder Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform noch in den vorwiegend in Asien stattfindenden Herstellungsprozess der streitgegenständlichen Mobiltelefone eingebunden. Allein aus ihrer Nennung im Impressum der Website www.A.com ergebe sich nicht, dass sie die angegriffene Ausführungsform in äußerlich wahrnehmbarer Weise zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitgestellt habe. Dies sei aber zur Verwirklichung eines patentrechtlich relevanten Anbietens erforderlich. Im Übrigen sei das Impressum auch nicht zutreffend, da die genannte Webseite nicht von ihr, sondern von der A Corporation betrieben werde. Aufgrund seiner rein deklaratorischen Natur sei das Impressum für die Entstehung von Sorgfaltspflichten und deren Verletzung nicht konstitutiv. Die tatsächliche und rechtliche Herrschaftsmacht über die Gestaltung der Website – einschließlich der deutschsprachigen Fassung – liege allein bei der A Corporation. Die Unrichtigkeit des auf der Webseite aufgeführten Impressums ergebe sich schon daraus, dass dort als Geschäftsführer Herr G genannt werde. Dieser sei aber nicht Geschäftsführer der Beklagten, sondern CEO der A Corporation. Auch der Handelsregisterauszug könne den konkreten Nachweis einer Verletzungshandlung nicht ersetzen, da die Eintragung keine Angabe enthalte, welche Waren vertrieben würden. Sie – die Beklagte – nehme in Deutschland lediglich Repräsentationspflichten für die A Corporation wahr. Eine konkrete Unterstützung im Rahmen der Vertriebstätigkeit erfolge nicht.
Die Beklagten sind weiter der Ansicht, der LTE-Standard setze nicht die Benutzung der Lehre des Klagepatents voraus. So verlange der Klagepatentanspruch, dass die Anzahl der übertragenen Dateneinheiten und die Anzahl der übertragenen Datenbytes der übertragenen Dateneinheiten gezählt würden. Die Zählung setze also bei der Übertragung der Dateneinheiten vom Sender an den Empfänger an. Der LTE-Standard sehe hingegen die Zählung der zusammengesetzten Dateneinheiten und die Anzahl der Datenbytes der zusammengesetzten Dateneinheiten „upon assembly“, also bei der Zusammensetzung vor. Dies habe zur Folge, dass ein- und dieselbe Dateneinheit nur einmal gezählt werde, auch wenn sie – etwa nach einem nicht bestätigten Empfang – erneut übertragen werde. Umgekehrt würden zusammengesetzte Dateneinheiten gezählt, auch wenn sie senderseitig verworfen würden, bevor sie überhaupt übertragen worden seien. Bei einer Zählung „upon assembly“ ergäben sich danach andere Ergebnisse als bei einer Zählung im Zeitpunkt der Übertragung. So werde bei einer Zählung bei Zusammensetzung die Statusabfrage bei Erreichen des Grenzwertes oder erstmaliger Überschreitung gesetzt, bei einer Zählung der gesendeten Dateneinheiten bzw. Datenbytes jedoch erst nach Erreichen des Grenzwertes mit der darauffolgenden Übertragung.
Der Klagepatentanspruch setze weiterhin voraus, dass alle übertragenen Datenbytes der übertragenen Dateneinheiten gezählt würden. Tatsächlich würden nach dem LTE-Standard aber nur die Bytes des Datenfeldelements gezählt, jedoch nicht die des Headers. Die Header seien im LTE-Standard variabel und von ganz unterschiedlicher Größe. Es mache daher einen ganz erheblichen Unterschied, ob sämtliche Bytes einer PDU oder nur die Bytes des Datenfeldelements einer PDU ohne deren Header gezählt würden. - Die Streithelferin beantragt,
- der Beklagten die durch die Nebenintervention verursachten Kosten aufzuerlegen.
- Sie macht sich den Vortrag der Klägerin zu eigen. Zudem ist sie der Auffassung, dass die Übertragung des Klagepatents auf die Klägerin nicht aus kartellrechtlichen Gründen nichtig sei. Die an der Übertragung beteiligten Unternehmen hätten sich nicht nur zur Übernahme der ETSI-Verpflichtung verpflichtet, die Klägerin habe eine solche auch ausdrücklich abgegeben.
- Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen
- Entscheidungsgründe
- Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.
- A
Die Klage ist zulässig. - I.
Die Klage ist nicht aufgrund der von der Beklagten erhobenen Einrede der entgegenstehenden Schiedsvereinbarung unzulässig. - 1.
Gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO hat das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen, wenn eine Klage in einer Angelegenheit erhoben wird, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, wenn nicht das Gericht feststellt, dass die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder undurchführbar ist. - 2.
Es kann dahinstehen, ob die Beklagte die Schiedseinrede rechtzeitig erhoben hat. Denn die Klage ist jedenfalls nicht in einer Angelegenheit erhoben, die Gegenstand der Schiedsvereinbarung ist. - a)
Eine Klage betrifft im Sinne von § 1032 Abs. 1 ZPO eine Angelegenheit, die Gegenstand der Schiedseinrede ist, wenn der Streitgegenstand des Gerichtsverfahrens von der Schiedseinrede umfasst ist; mit anderen Worten der im gerichtlichen Verfahren geltend gemachte Anspruch muss schiedsgebunden sein (Münch in MüKo-ZPO, 6. Aufl. 2022: § 1032 Rn 9; Wolf/Eslami in BeckOK ZPO, 53. Ed. Stand 01.09.2022: § 1032 Rn 7). Es findet eine volle Präventivkontrolle statt, um sich effektiven Rechtsschutzes zu versichern. Das staatliche Gericht setzt also den Rechtsstreit fort, wenn und soweit die Schiedsvereinbarung den Streitgegenstand der Klage nicht betrifft (Münch in MüKo-ZPO, 6. Aufl. 2022: § 1032 Rn 9). Der Umfang der Schiedseinrede ist durch Auslegung zu ermitteln. Generell ist die Tragweite einer Schiedsvereinbarung als weit gemeint auszulegen (BGH, NJW, 1960, 1462; NJW 1989, 1477; SchiedsVZ 2007, 215). Ist etwa von „Auslegung dieses Vertrags“ die Rede, so kann das Schiedsgericht auch über die (gesetzlichen) Rechtsfolgen eines Vertragsbruchs entscheiden (Schlosser in Stein/Jonas, Komm. zur ZPO, 23. Aufl. 2024: § 1029 Rn 36). Die Klausel „Ansprüche aus diesem Vertrag“ deckt sogar Ansprüche aus unerlaubter Handlung, wenn und soweit sie sich mit Vertragsverletzungen decken (Schlosser in Stein/Jonas, Komm. zur ZPO, 23. Aufl. 2024: § 1029 Rn 38). Schiedsvereinbarungen über vertragliche Verhältnisse werden mangels gegenteiliger Vereinbarungen nicht nur auf Streitigkeiten über die Wirksamkeit des Vertrages, sondern auch auf gesetzliche Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrag erstreckt, zum Beispiel auf deliktische Ansprüche, wenn sich die behauptete unerlaubte Handlung tatbestandlich mit einer Vertragsverletzung deckt (BGH, NJW 1965, 300) oder die schädigende Handlung in einem einheitlichen Lebensvorgang mit einer Vertragsverletzung steht (BGH, NJW 1988, 1215; LG Düsseldorf, Urteil vom 18.11.2003, 4a O 395/02). Das ist bei Ansprüchen aus Patentverletzungen, die in keinem Zusammenhang mit der Schiedsvereinbarung stehen, jedoch nicht der Fall (LG Düsseldorf, Urteil vom 18.11.2003, 4a O 395/02). - b)
So liegt der Fall im Ergebnis auch hier.
Die Klägerin macht mit der Klage gesetzliche Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung wegen einer Patentverletzung geltend. Bei der Auseinandersetzung über diese Ansprüche handelt es sich nicht um Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Fragen, die Gegenstand der Schiedsvereinbarung sind. Denn gemäß der in Ziffer 10.2 des GPLA getroffenen Schiedsvereinbarung sollen alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Fragen, die durch oder in Bezug auf die Interpretation, Durchführung, Verletzung oder Beendigung des GPLA zwischen den Vertragsparteien entstehen, in New York nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem Schiedsgericht endgültig entschieden werden.
Zwar streiten die Parteien aufgrund des Lizenzeinwands der Beklagten auch über die Auslegung des GPLA und seine Anwendbarkeit. Die Klägerin ist aber der Ansicht, dass sie schon nicht in den Anwendungsbereich des GPLA einbezogen sei und macht daher keine vertraglichen Ansprüche, sondern von der Auslegung, Durchführung, Verletzung oder Beendigung des Vertrages losgelöste gesetzliche Ansprüche geltend. Insofern geht es auch nicht darum, dass die Parteien über Umfang und Reichweite des GPLA streiten und die Klägerin aus der Überschreitung des GPLA folgende Ansprüche geltend macht (so aber der Fall in BGH, SchiedsVZ, 2017, 144). Vielmehr sind die streitgegenständlichen Ansprüche einer solchen Fragestellung noch vorgelagert, weil die Klägerin sich darauf beruft, dass das GPLA überhaupt nicht anwendbar sei. Auch die Beklagte vertritt nicht die Ansicht, dass die von der Klägerin behaupteten streitgegenständlichen deliktischen Handlungen in einem einheitlichen Lebensvorgang mit einer Vertragsverletzung stehen oder sich in irgendeiner Weise mit einer solchen decken.
Der Streit über die Auslegung und Anwendbarkeit des GPLA betrifft daher auch nicht die streitgegenständlichen Ansprüche als solche, sondern den von der Beklagten erhobenen Lizenzeinwand. Die Einwendung einer Berechtigung ist jedoch kein streitgegenständlicher Anspruch, auf den die Schiedseinrede gestützt werden könnte. Andernfalls hätte es ein Beklagter in der Hand, durch eine entsprechende Einwendung im Zusammenhang mit einer Schiedseinrede einen auch nur fernliegenden Streit über die Auslegung dieser Schiedseinrede zu begründen, der dann zum Erfolg der Schiedseinrede und zur Unzulässigkeit der Klage führen würde (aA LG Düsseldorf, Urteil vom 14.12.2017, 4a O 43/16). Dass ein solches Ergebnis auch im Streitfall widersprüchlich ist, zeigt sich daran, dass die Klägerin bei Erfolg der Schiedseinrede gehalten wäre, ein Schiedsgericht anzurufen, dessen Zuständigkeit sie selbst mangels Anwendbarkeit des GPLA in Abrede stellt. Müsste sie die hier streitgegenständlichen Ansprüche vor dem Schiedsgericht geltend machen, könnte sie diese vor allem nur damit begründen, dass das GPLA gerade nicht anwendbar ist. Denn die streitgegenständlichen Ansprüche sind losgelöst von jeglichen möglichen Vertragsverletzungen. Die Schiedsklausel in Ziffer 10.2 des GPLA kann aber nicht dahingehend verstanden werden, dass das Schiedsgericht zur Entscheidung über gesetzliche Ansprüche berufen sein sollte, die in keinem Zusammenhang mit dem GPLA stehen. Im Ergebnis läge bei Erfolg der Schiedseinrede eine Rechtsschutzverweigerung vor (Münch in MüKo-ZPO, 6. Aufl. 2022: § 1032 Rn 9). - c)
Die Schiedseinrede greift schließlich auch nicht mit der Begründung durch, dass das Schiedsgericht gemäß Ziffer 10.2 GPLA auch zur Interpretation des GPLA und damit zur Beantwortung der Frage berufen sein soll, ob eine Angelegenheit der Schiedseinrede unterfällt, einschließlich der damit verbundenen Frage, ob die Klägerin und die Benutzung ihrer Patente durch die Beklagte als Tochtergesellschaft der A Corporation – einer Vertragspartei des GPLA – vom GPLA erfasst und damit der Schiedseinrede unterworfen sind. Denn aus § 1032 Abs. 1 ZPO folgt, dass die Kompetenz-Kompetenz, also die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Zuständigkeit des Schiedsgerichts, letztlich bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit liegt und auch nicht auf das Schiedsgericht übertragen werden kann (Zöller/Geimer, ZPO, 35. Aufl. 2024: § 1032 Rn 22 f. m.w.Nw.). Demnach hat die Kammer im Streitfall zu befinden, ob mit der Klage eine Angelegenheit betroffen ist, die Gegenstand der Schiedseinrede ist und somit der Zuständigkeit der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen ist, was – wie zuvor ausgeführt – nicht der Fall ist. - II.
Die Klägerin ist prozessführungsbefugt.
Dies ist unproblematisch der Fall, soweit die Klägerin – wie vorliegend – Ansprüche aus eigenem oder abgetretenem Recht geltend macht. Soweit die Klägerin aus eigenem Recht klagt, ist lediglich weitere Voraussetzung für die Prozessführungsbefugnis, dass die Klägerin im Patentregister eingetragen ist (Schulte/Voß, PatG 11. Aufl., § 139 Rn 32). Das ist mittlerweile der Fall. - B
Die Klage ist unbegründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz. Solche folgen insbesondere nicht aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB. - I.
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Anordnung in einem ersten Knoten, der in einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk enthalten ist, zur Funkverbindungssteuerung (Radio Link Control, RLC), die zur kontinuierlichen Übertragung innerhalb des drahtlosen Kommunikationsnetzes dient.
In der Klagepatentschrift wird einleitend ausgeführt, dass die Übertragungsqualität bei einer drahtlosen Kommunikation und die Koheränzeigenschaften eines Kommunikationskanals zwischen zwei Knoten – etwa einer Basisstation und einem Endgerät (etwa einem Mobiltelefon) in einem drahtlosen Kommunikationssystem – sehr unterschiedlich sein können. Dies könne dazu führen, dass von einem Knoten gesendete Dateneinheiten wie beispielsweise eine Protokolldateneinheit (Protocol Data Unit, nachfolgend: PDU) beim Empfangsknoten verzerrt oder gar nicht ankommen. Ebenso könne es vorkommen, dass die Reihenfolge einer Anzahl von PDUs verändert und eine Neuordnung erforderlich sei (Abs. [0002]; Textstellen ohne Bezugsangabe stammen aus der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift, Anlage EIP D1a).
Sind Dateneinheiten verloren oder verzerrt, könne es erforderlich sein, diese erneut an den Empfangsknoten zu senden. Dafür müsse jedoch der Sendeknoten in irgendeiner Weise darüber informiert werden, ob und gegebenenfalls welche Daten dem Empfangsknoten erneut gesendet werden sollen. Eine Lösung dieses Problems bestehe darin, den Empfangsknoten aufzufordern, einen Statusbericht zurück an den Sendeknoten zu senden (Abs. [0003] und [0004]).
Ein entsprechendes Abfrageverfahren sei Teil eines Funkverbindungssteuerungs-Protokolls (Radio-Link-Control, nachfolgend: RLC), das bei einem „evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network“ (E-UTRAN), auch als Long Term Evolution (LTE) bezeichnet, zum Einsatz komme und in dem Dokument 3GPP TS 36,322 „Evolved Universal Terrestrial Radio Acces (E-UTRA), Radio Link Control (RLC) protocol specification Release 8“ des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) definiert sei. Bei diesem Abfrageverfahren sende der RLC-Sender ein Abfrage-Bit im RLC-Kopf (sog. „P-field“), wobei das Abfrage-Bit als Aufforderung für einen Kommunikationspartner diene, um einen RLC-Statusbericht zu senden. Ob eine Abfrage erfolge, hänge von einer Anzahl von Kriterien ab, die für die Einstellung des Abfrage-Bit maßgeblich seien (Abs. [0005]):
Erstens sei erforderlich, dass die letzte PDU in einen Puffer (etwa den Zwischenspeicher eines Mobiltelefons) übertragen werde. Es werde also eine Abfrage gesendet, wenn die letzte PDU zur Übertragung oder Weiterleitung übertragen werde. Zweitens sei der Ablauf eines Zeitgebers für die Abfrageübertragung erforderlich. Es werde also ein Zeitgeber gestartet, wenn eine PDU mit der Abfrage gesendet werde, und die PDU werde erneut übertragen, wenn die PDU mit dem Abfrage-Bit nach Ablauf des Zeitgebers nicht bestätigt worden sei (Abs. [0006] und [0007]).
Die Klagepatentschrift sieht diese Kriterien für die Festlegung von Abfrage-Bits für den Datenverkehr mittels Bursts als geeignet an, da die Abfrage mit der letzten PDU in jedem Burst gesendet werde. Bei einer kontinuierlichen Datenübertragung müssten jedoch gegebenenfalls weitere Kriterien berücksichtigt werden, um die Anzahl an ausstehenden, das heißt übertragenen, aber nicht bestätigten PDUs oder Bytes zu begrenzen und Blockierungszustände zu vermeiden. Der Ausdruck Protokollblockierung (STALL) bedeute dabei, dass keine neuen Daten mehr übertragen werden können. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn der Puffer voll ist und für alle gepufferten PDUs die Bestätigung ihres Empfangs noch aussteht. Es seien zwei Techniken bekannt, um solche Blockierungen zu vermeiden, nämlich eine zählerbasierte und eine fensterbasierte Technik (Abs. [0008]).
Bei der zählerbasierten Technik werde die Anzahl von übertragenen PDUs beziehungsweise Bytes gezählt und das Abfrage-Bit dann gesetzt, wenn eine eingestellte Anzahl von PDUs beziehungsweise Bytes übertragen worden sei. Die fensterbasierte Technik sehe ein RLC-Fenster vor, in dem ein Satz gesendeter PDUs mit einer individuellen Sequenznummer für jede PDU eingestellt sei. Das Fenster schreite erst weiter, wenn alle PDUs positiv bestätigt wurden. Eine Abfrage werde immer dann übertragen, wenn die Menge der ausstehenden Daten, für die noch keine Bestätigung empfangen wurde, eine bestimmte Anzahl von PDUs beziehungsweise Bytes überschreitet. Gegebenenfalls sei, solange der Schwellwert im fensterbasierten Modus überschritten sei, eine zusätzliche Logik erforderlich, um die Abfrage gleichmäßig zu übertragen (Abs. [0009] und [0010]).
In der Klagepatentschrift wird weiterhin die Druckschrift US 2006/XXX genannt, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern der Paketübertragung offenbart. Dabei werden Datenpakete, die von der Sendeseite übertragen werden, von der Empfangsseite bestätigt und nichtbestätigte Datenpakete erneut zur Empfangsseite übertragen. Auch dieses Verfahren arbeite mit einem Paketzählerwert und einem Zeitgeberwert (Abs. [0011]).
Als nachteilig wird in der Klagepatentschrift angesehen, dass keine der bestehenden Techniken berücksichtige, dass die Blockierung teilweise infolge der beschränkten Anzahl von Sequenznummern (nachfolgend: SN) und teilweise infolge einer Beschränkung des Speicherplatzes auftrete, letzteres etwa bei einem begrenzten Pufferspeicher in einem Endgerät wie zum Beispiel einem Mobiltelefon.
Wird nur die Anzahl der Bytes gezählt, könne es aufgrund der begrenzten Anzahl der Sequenznummern im Fenster zur Blockierung kommen. Wird hingegen nur die Anzahl der PDUs gezählt, kann eine Blockierung auftreten, wenn der begrenzte Pufferspeicher in einem Endgerät wie zum Beispiel einem Mobiltelefon, ausgeschöpft ist. Hinzu kommt, dass die Qualität des Benutzerzugriffs und die Gesamtkapazität einer drahtlosen Kommunikationsnetzumgebung nicht nur durch Datenverlust und Protokollblockierung beeinträchtigt werden, sondern auch durch unnötige Abfragen und erneutes Senden von Daten (Abs. [0012] und [0013]).
Davon ausgehend liegt dem Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, ein verbessertes drahtloses Kommunikationssystem bereitzustellen (Abs. [0014]).
Dafür schlägt das Klagepatent unter anderem einen ersten Knoten mit den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 12 vor, die wie nachstehend gegliedert werden können: - 1. Erster Knoten (110), umfassend eine Anordnung (400) zum Anfordern eines Statusberichts von einem zweiten Knoten (120).
1.1 Der erste Knoten (110) und der zweite Knoten (120) werden beide für ein drahtloses Kommunikationsnetz (100) verwendet.
1.2 Der Statusbericht umfasst positive und/oder negative Bestätigung von Daten, die vom ersten Knoten (100) gesendet werden und die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen.
2. Die Anordnung umfasst:
2.1 einen Sender (406), der so ausgelegt ist, dass er eine Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten sendet, die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen;
2.2 einen Zählmechanismus (407), der so ausgelegt ist, dass er
2.2.1 die Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und
2.2.2 die Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählt;
2.3 eine Anforderungseinheit (410), die so ausgelegt ist, dass sie einen Statusbericht vom zweiten Knoten (120) anfordert,
2.3.1 wenn die gezählte Anzahl von gesendeten Dateneinheiten einen ersten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht,
2.3.2 oder die gezählte Anzahl von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten einen zweiten vordefinierten Wert überschreitet oder diesem entspricht.
2.4 eine Rücksetzeinheit, die angepasst ist, um den Zählmechanismus zurückzusetzen, um dadurch sowohl die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten als auch die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes zurückzusetzen,
2.4.1 wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Dateneinheiten den ersten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist, oder
2.4.2 wenn die gezählte Anzahl der übertragenen Datenbytes den zweiten vorgegebenen Wert überschreitet oder gleich ist. - Das Klagepatent sieht die mit der patentgemäßen Lehre verbundenen Vorteile darin, dass mit Hilfe eines einzigen Mechanismus überflüssige Abfragen infolge der Beschränkungen der Sequenznummern und des Speicherplatzes vermieden werden. Durch die Kombination der beiden Kriterien „Anzahl der gesendeten Dateneinheiten“ und „Anzahl der gesendeten Bytes“ in einer Einrichtung werde vermieden, dass eine Abfrage unnötig gesendet werde, wenn das erste Kriterium in einer Situation erfüllt ist und eine solche Abfrage bereits kürzlich durch das andere, zweite Kriterium ausgelöst wurde. Es gebe keine unnötigen Signalübertragungen zwischen den Knoten, was zu einem reduzierten Signalgebungsaufwand und dadurch zu einer erhöhten Systemkapazität führe (Abs. [0017]). Darüber hinaus liege ein weiterer Vorteil der Erfindung darin, dass durch die Kombination der beiden Kriterien Blockaden durch Beschränkungen der Sequenznummern und des Speicherplatzes vermieden werden könnten (Abs. [0018]).
- II.
Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Es lässt sich nicht feststellen, dass das Merkmal 2.2.2 verwirklicht wird. Der LTE-Standard verlangt nicht, dass die Anzahl aller gesendeten bzw. gespeicherten Datenbytes der gesendeten bzw. zu sendenden Dateneinheiten gezählt werden. Im Übrigen ist dies in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform nicht dargetan. - 1.
Der Klagepatentanspruch bedarf im Hinblick auf das Merkmal 2.2.2 der Auslegung. - a)
Die patentgemäße Lehre zeichnet sich gegenüber dem Stand der Technik dadurch aus, dass ein Zählmechanismus für die Zählung sowohl der Anzahl gesendeter Dateneinheiten als auch die Anzahl gesendeter Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten vorgesehen ist (Merkmalsgruppe 2.2). So waren im Stand der Technik nur Zählmechanismen bekannt, die entweder die Anzahl der gesendeten Dateneinheiten oder die Anzahl der Datenbytes zählten (Abs. [0008] und [0009]). Dies ist im Hinblick auf die beschränkte Anzahl von Sequenznummern und den beschränkten Speicherplatz in einer Mobileinheit ausreichend, solange alle Dateneinheiten eine einheitliche Größe, mithin dieselbe Anzahl an Bytes haben (wie im UMTS-Standard). Denn dann kann von der Anzahl gesendeter Dateneinheiten auf die Anzahl gesendeter Datenbytes (und umgekehrt) geschlossen werden. Werden nur Dateneinheiten gezählt, kann gleichwohl ein Grenzwert für die Anzahl übertragener Dateneinheiten angegeben werden, der in Abhängigkeit von der beschränkten Größe des Speichers und der Anzahl speicherbarer Datenbytes festgelegt ist. Umgekehrt kann, wenn nur die Datenbytes gezählt werden, in Abhängigkeit von der beschränkten Anzahl an Sequenznummern ein Grenzwert für die Anzahl der Datenbytes berechnet werden, bei dessen Erreichen eine Statusabfrage erfolgt.
Die Lehre des Klagepatents gewinnt ihre Bedeutung erst vor dem Hintergrund, dass Dateneinheiten unterschiedlicher Größe übertragen werden sollen. Genügte im Stand der Technik eines der beiden Kriterien, um eine Blockierung aufgrund beider Ursachen zu verhindern, ist dies bei der Verwendung von Dateneinheiten unterschiedlicher Größe nicht mehr ausreichend. Dies kommt auch in der Beschreibung des Klagepatents unmittelbar zum Ausdruck, in der darauf hingewiesen wird, dass die Prinzipien der Erfindung, das heißt die Kombination der beiden Kriterien „Anzahl übertragener Dateneinheiten“ und „Anzahl übertragener Datenbytes“, auch für UTRAN angewendet werden können, „wenn flexible Größen von Dateneinheiten eingeführt werden, z.B. flexible RLC PDU-Größen“ (Abs. [0051]). Herkömmlich wurden im UTRAN Dateneinheiten einheitlicher Größe verwendet.
Die patentgemäße Lehre verlangt daher, dass ein Zählmechanismus sowohl die Anzahl gesendeter Dateneinheiten als auch die Anzahl gesendeter Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählt (Merkmalsgruppe 2.2) und jeweils mit einem vordefinierten Wert vergleicht. Je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird, wird eine Statusabfrage ausgelöst (Merkmalsgruppe 2.3). Damit werden die in der Klagepatentschrift genannten Blockierungszustände vermieden (Abs. [0018]). Die Zählung der Anzahl von gesendeten Dateneinheiten und ihr Abgleich mit dem ersten vordefinierten Wert hat nach alledem die Funktion, eine Blockierung infolge der beschränkten Anzahl an Sequenznummern zu vermeiden (Merkmale 2.2.1 und 2.3.1). Hingegen hat die Zählung der Anzahl von gesendeten Datenbytes und ihr Abgleich mit dem zweiten vordefinierten Wert die Aufgabe, eine Blockierung infolge des beschränkten Speicherplatzes zu vermeiden (Merkmale 2.2.2 und 2.3.2; Abs. [0018], [0052]).
Der weitere in der Beschreibung des Klagepatents genannte Vorteil, dass unnötige Abfragen durch die Kombination der beiden Kriterien vermieden werden können (Abs. [0017]), kann dadurch erzielt werden, dass nach Anforderung eines Statusberichts beide Zähler wieder zurückgesetzt werden und von neuem gezählt wird (Merkmalsgruppe 2.4; vgl. auch Abs. [0040]). - b)
Soweit in Merkmal 2.2.2 der Lehre des Klagepatents von gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten (Merkmal 2.2.1.) die Rede ist, die von dem Zählmechanismus gezählt werden, ist unter „gesendet“ („transmitted“) nach dem Sprachgebrauch zu verstehen, dass die Datenbytes von dem ersten Knoten über die Luftschnittstelle übertragen werden. Dieses Verständnis lässt sich gleichsam Merkmal 2.1 des Klagepatents entnehmen, wonach der Sender (406) („transmitter“) „so ausgelegt ist, dass er eine Folge von Dateneinheiten oder Dateneinheitssegmenten sendet, die durch den zweiten Knoten (120) empfangen werden sollen“ (Abs. [0095]). Auch danach ist mit „Senden“ eine physische Übertragung über die Luftschnittstelle gemeint.
Soweit sich die Klägerin in ihren Ausführungen auf die Urteilsgründe des High Court of Justice in Rn. 63, 64 (Urteil vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat) in der deutschen Übersetzung, Anlage 17a) beruft, wonach der Begriff „übertragen“ nicht nur die Übertragung in der physischen Schicht, also über die Luft, beinhaltet, sondern auch den vorhergehenden Schritt innerhalb des Senders, wenn die RLC-Schicht eine PDU weitergibt, um sie an die darunterliegende MAC-Schicht zu übertragen, finden sich im Klagepatent keine Anhaltspunkte für ein derartiges Verständnis. Denn von einer Übertragung zwischen der RLC-Schicht und der MAC-Schicht ist weder im Patentanspruch 12 noch in der Klagepatentschrift die Rede.
Vielmehr folgt aus der Funktion des ersten Knotens, wonach dieser anhand des Statusberichts bestimmen kann, welche Daten sicher empfangen wurden, so dass Ressourcen freigegeben werden können, sowie aus der Bestimmung, welche Daten erneut übertragen werden müssen, dass nur ein Senden über die physische Schicht gemeint sein kann. Dies ergibt sich auch aus Merkmal 1.2, wonach Daten zwischen zwei physischen Einheiten übertragen werden sollen, d.h. von einem ersten Knoten [110] gesendet und durch den zweiten Knoten [120] empfangen, sowie aus Merkmal 1.1., das insoweit ein drahtloses Kommunikationsnetz voraussetzt (vgl. auch Figur 2, Abs. [0034], [0070])).
Soweit es aber auf den Zeitpunkt der Zählung ankommt, ist der Anspruch dahingehend auszulegen, dass von der Merkmalsgruppe 2.2 auch zu sendende Dateneinheiten und Datenbytes umfasst sind, von denen bei einem ungestörten Ablauf der Datenverarbeitung zu erwarten ist, dass sie nach Zusammenstellung der Dateneinheit ohne Verzögerung an ggfs. untere Schichten weitergereicht, verarbeitet und dann unmittelbar gesendet werden. Insofern sind auch zu sendende Dateneinheiten und -bytes von der Lehre des Klagepatents umfasst.
Vor allem bei einem schichtenbasierten Netzwerkprotokoll für die Paketübertragung ist für den Fachmann nicht einzusehen, warum die Zählung der übertragenen Dateneinheiten und Datenbytes erst im Zeitpunkt der Übertragung erfolgen soll. Denn dies würde eine Rückmeldung der Transportschicht oder gar der physikalischen Schicht an eine darüber liegende Schicht wie die MAC-Schicht verlangen, dass eine Übertragung erfolgte, um eine Zählung der Dateneinheiten und -bytes zu bewirken und eine Überschreitung des Grenzwertes zu prüfen und ggf. die Anforderung eines Statusberichts auszulösen. Eine solche komplexe Vorgehensweise würde der Fachmann vermeiden. Für ihn ist klar, dass die Zählung, die Prüfung des Grenzwertes und ggf. die Anforderung eines Statusberichts auf einer bestimmten Schicht erfolgen und zwar sinnvoller Weise dann, wenn diese Schicht auch die zu übertragende Dateneinheit verarbeitet. Demnach werden zwangsläufig „zu übertragende“ Dateneinheiten und -bytes gezählt.
Dies ergibt sich auch aus der Beschreibung des Klagepatents. Diese bezieht sich unter anderem auf den LTE-Standard, der im RLC-Protokoll ein Polling-Verfahren installiert (Abs. [0005]). Es liegt nahe, weil das Verfahren auf der RLC-Schicht implementiert ist und der Statusbericht nach Überschreiten des Grenzwertes von der RLC-Schicht angefordert wird, hier auch die Zählung der Dateneinheiten und Bytes vorzunehmen. Funktional macht es keinen Unterschied, ob die Dateneinheiten vor oder nach dem Senden gezählt werden, wenn die ausreichende Sicherheit besteht, dass – wenn vor dem Senden gezählt wird – die Dateneinheit auch tatsächlich gesendet wird. - c)
Mit dem Begriff der Dateneinheit beschreibt der Klagepatentanspruch eine für die Übertragung an den zweiten Knoten vorgesehene Anzahl von Bytes, die sowohl vom ersten Knoten, als auch vom zweiten Knoten als eine individualisierbare, zählbare Einheit von Bytes anzusehen ist. Die Notwendigkeit der Individualisierbarkeit und Zählbarkeit ergibt sich daraus, dass der Zählmechanismus die Dateneinheiten zählen können (Merkmal 2.2.2) und der zweite Knoten im Statusbericht den Empfang der Daten gegenüber dem zweiten Knoten positiv oder negativ bestätigen muss (Merkmal 1.2). Das Klagepatent sieht beispielsweise RLC PDUs, die im eUTRAN verwendet werden, als Dateneinheiten im Sinne des Klagepatents an (vgl. bspw. Abs. [0005] bis [0008], [0035], [0051]), die jeweils mit einer individuellen Sequenznummer versehen sind. - d)
Der im Klagepatentanspruch verwendete Begriff der Datenbytes kennzeichnet sämtliche Bytes, aus denen die jeweilige Dateneinheit besteht. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass das Klagepatent für die Dateneinheiten zwischen Datenbytes und sonstigen Bytes unterscheidet, beispielweise in der Form, dass mit Datenbytes solche Bytes der Dateneinheit beschrieben werden, mit denen Inhalte transportiert werden, während andere Bytes Metainformationen liefern. - aa)
Aus dem im Klagepatentanspruch verwendeten Begriff „Datenbytes“ kann in Abgrenzung zum Begriff „Bytes“ eine solche Unterscheidung nicht hergeleitet werden. Denn in der Klagepatentschrift werden die Begriffe „Datenbytes“ und „Bytes“ nicht voneinander unterschieden und sogar synonym verwendet. So ist in der allgemeinen Beschreibung sowohl von Datenbytes (Abs. [0015] und [0016]) als auch von Bytes (Abs. [0017] und [0018]) die Rede, ohne dass die Begriffe in irgendeiner Weise unterschieden werden. Für die Darstellung des ersten Ausführungsbeispiels wird durchweg der Begriff „Bytes“ verwendet (Abs. [0023] bis [0052]), für die Beschreibung der Figuren 3 und 4 hingegen der Begriff „Datenbytes“. Eine derart synonyme Verwendung der Begriffe „Datenbytes und „Bytes“ entspricht auch dem Verständnis des Bundesgerichtshofes zu Patentanspruch 1 (Urteil vom 04.09.2018, X ZR 14/17 – Drahtloses Kommunikationsnetz) und des Bundespatentgerichts (Urteil vom 28.01.2020 – 4 Ni 6/19) im parallelen Nichtigkeitsverfahren.
Auch findet sich weder im Klagepatent noch in der Klagepatentschrift eine Unterscheidung zwischen Header- und Nutzlastdaten, obwohl diese Differenzierung im Stand der Technik bekannt war. Vielmehr nimmt die Patentschrift an verschiedenen Stellen lediglich auf die „vollständige“ PDU Bezug, die sich aus Header und Datenfeld zusammensetzt (Abs. [0035], [0050], [0067] und [0095]). - bb)
Abgesehen davon kann nach den vorstehenden Ausführungen nicht davon ausgegangen werden, dass das Klagepatent den Begriff „Datenbytes“ in diesem engen Sinne, also unter Ausschluss von in einer Dateneinheit enthaltenen Steuerinformationen, verstehen möchte. Die Merkmale eines Patentanspruchs sind aus der Patentschrift selbst auszulegen. Dies kann zu einem weiteren Begriffsinhalt führen als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Es kann sich aber ebenso ein engeres Verständnis ergeben (BGH GRUR 1999, 912 – Spannschraube). Insoweit findet sich an keiner Stelle der Klagepatentschrift eine Differenzierung zwischen Header und Datenfeld beziehungsweise Steuerinformationen und Daten. Vielmehr wird der Begriff der Daten („data“) völlig unspezifisch verwendet und beschreibt den gesamten Inhalt der Dateneinheit, wie sich schon dem Begriff der Dateneinheit („data unit“) entnehmen lässt. Im Streitfall ist danach – wie gezeigt – von einem weiten Verständnis des Begriffs „Datenbytes“ auszugehen. Für eine abweichende Auslegung bestehen keine Anhaltspunkte. - cc)
Solche Anhaltspunkte lassen sich auch nicht dem im Klagepatent erwähnten LTE-Standard entnehmen. Auch wenn das Klagepatent maßgeblich von dem im Stand der Technik bekannten LTE-Standard ausgeht (vgl. Abs. [0005]), ist die patentgemäße Lehre nicht auf Dateneinheiten im Sinne des LTE-Standards beschränkt. Vor allem können Einzelheiten eines Standes der Technik – hier des vorprioritär veröffentlichten LTE-Standards –, mit denen sich das Klagepatent überhaupt nicht auseinandersetzt, nicht zu einer beschränkenden Auslegung führen (vgl. für den Fall der Abgrenzung vom Stand der Technik: BGH, Urteil vom 26.04.2022, X ZR 44/20 – Verbundelement; Urteil vom 07.05.2024, X ZR 51/22 – Festhalteanordnung). Abgesehen davon verwendet auch der LTE-Standard den Begriff der „data bytes“ nicht bzw. nicht eindeutig. Gleiches gilt für den Umstand, dass in der vor dem Prioritätsdatum des Klagepatents veröffentlichten Version des LTE-Standards TS 36.322 V8.0.0 das in den Figuren zum Aufbau der PDU dargestellte Datenfeld mit „Data“ beschrieben wird (vgl. Figur 6.2.1.1-1 bis 6.2.1.5-3 der Anlage EIP D6). Der Fachmann wird aus der Verwendung des Begriffs „Data“ zur Beschreibung des Inhalts des Datenfeldes nicht schließen, dass mit den im Klagepatentanspruch genannten Datenbytes („Data bytes“) genau die Bytes dieses Datenfeldes gemeint sind.
Diese von der Klägerin vertretene Auffassung vermag die Kammer nicht zu teilen. Es ist schon nicht ersichtlich, dass es sich bei dem Begriff „Datenbyte“ um einen in der Fachwelt geläufigen, mit einem bestimmten Inhalt versehenen Fachbegriff handelt. Dass in dem weitverbreiteten Universitätslehrbuch „Computer Networks“ von Andrew S. Tanenbaum im Zuge der Erläuterung des Schichtenmodells zwischen Headern und Daten („data“) unterschieden wird, macht den Begriff „Datenbytes“ („data bytes“) noch nicht zu einem geläufigen Fachbegriff für die Bytes eines Datenfeldes unter Ausschluss des Headers. So weit ersichtlich, verwendet auch Tanenbaum nicht den Begriff „Datenbytes“. Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht aus dem Stand der Technik. Auch hier werden die Begriffe unspezifisch verwendet. Es lässt sich daher weder feststellen, dass es sich bei dem Begriff „Datenbytes“ („data Bytes“) um einen geläufigen Fachbegriff handelt, noch dass dies bei dem Begriff „Daten“ („data“) der Fall ist.
Auch soweit der sachverständige Zeuge H in dem parallelen High Court Verfahren die Klagepatentschrift hinsichtlich Absatz [0002] so versteht, dass sich dieser im Zusammenhang mit dem LTE-Standard ausdrücklich auf ausstehende PDUs oder Bytes beziehe, überzeugt dies nicht. Die Auffassung, der Fachmann würde wissen, dass man technisch keine Header-Bytes bestätige, sondern ganze PDUs, mit der Ausnahme, dass es im Fall von segmentierten Übertragungen eine Bestätigung bestimmter Bytes, nämlich Nutzlastbytes, geben kann, lässt nicht den zwingenden Schluss zu, dass mit Datenbytes im Sinne des Klagepatents nur Nutzlastbytes gemeint sein können. Im Gegenteil, soweit insoweit auf PDUs Bezug genommen wird, enthält eine PDU auch zwangsläufig einen Header mit entsprechenden Systeminformationen. Hinsichtlich der weiteren sachverständigen Zeugen fehlt es in Bezug auf Dr. I an einer zutreffenden Beantwortung der Beweisfrage, während die gleichlautende Auffassung von Dr. J im Urteil eine Begründung vermissen lässt (Urteil des High Court of Justice vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat) in der deutschen Übersetzung, Anlage 17a Rn. 84, 124 – 128). Letztlich kommt auch der High Court zu dem Schluss, dass es sich bei „data“ um einen allgemeinen Begriff handelt, der sich einfach nur auf PDUs beziehen kann, ohne detailgenauer zu sein. - e)
Dass der Begriff der Datenbytes nicht auf Nutzlastdaten beschränkt ist, bedeutet noch nicht, dass auch zwingend alle Bytes einer Dateneinheit vom Zählmechanismus gezählt werden müssten. Allerdings ist das Merkmal 2.2.2 dahingehend auszulegen, dass jedenfalls dann alle Bytes der gesendeten Dateneinheiten – sowohl solche des Headers als auch solche des Payloads – gezählt werden müssen, wenn sie für den Fall einer erneuten Übertragung („retransmission“) zwischengespeichert werden. - aa)
Nach dem Wortlaut des Klagepatentanspruchs muss der Zählmechanismus eines erfindungsgemäßen ersten Knotens grundsätzlich sämtliche gesendeten Dateneinheiten beziehungsweise gesendeten Datenbytes der gesendeten Dateneinheiten zählen (Merkmalsgruppe 2.2). Der Wortlaut kann nicht dahingehend verstanden werden, dass nur ein Teil der gesendeten Dateneinheiten oder Datenbytes gezählt werden muss. - bb)
Dieses Verständnis erfährt durch die gebotene technisch-funktionale Auslegung jedoch dahingehend eine Einschränkung, dass nur solche Dateneinheiten und -bytes gezählt werden müssen, die für eine ggfs. erforderliche erneute Übertragung in den Zwischenspeicher („puffer“) der Mobilstation gelangen.
Insoweit ist die Auslegung eines Patentanspruchs auch dann geboten, wenn dessen Wortlaut nach dem allgemeinen Sprachgebrauch oder Fachverständnis eindeutig zu sein scheint (vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2021, X ZR 170/18, Rn. 21 – Anhängerkupplung II). Denn Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des technischen Sinngehalts des Patentanspruchs (BGH, Urteil vom 2. März 1999, X ZR 85/96 – Spannschraube; Urteil vom 12. Mai 2015, X ZR 43/13 – Rotorelemente). Dabei sind Aufgabe und Lösung der beanspruchten Erfindung heranzuziehen.
Nach der Beschreibung in der Klagepatentschrift hat der Zählmechanismus in Merkmal 2.2 die Funktion, eine Blockierung infolge einer Beschränkung des Speicherplatzes zu vermeiden, indem die Anzahl von gesendeten Datenbytes gezählt und mit dem zweiten vordefinierten Wert abgeglichen wird (Merkmale 2.2.2 und 2.3.2). Darauf, ob dies „upon assembly“, also nach dem Zusammensetzen der PDU oder nach der Übertragung über die Luftschnittstelle erfolgt, macht entsprechend vorstehender Ausführungen (unter B II. 1.b)) für das Erreichen des erfindungsgemäßen Ziels keinen Unterschied. Insoweit kommt es bei der gebotenen funktionalen Betrachtungsweise nur darauf an, dass sämtliche zwischengespeicherten Dateneinheiten und Datenbytes gezählt werden, um eine zuverlässige Information darüber zu erhalten, wieviel Speicherplatz im Zwischenspeicher nach dem Speichern der Daten noch vorhanden ist und ob ggfs. der Schwellenwert erreicht oder überschritten ist, um eine Abfrage zu senden (vgl. High Court of Justice vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat) in der deutschen Übersetzung, Anlage 17a Rn. 79). Ein Fachmann würde danach für erforderlich halten, all die Daten zu speichern, die für eine ggfs. erforderliche „retransmission“, also eine erneute Übertragung benötigt werden, so dass auch sämtliche hierauf entfallenen Bytes zu zählen sind.
Demnach müssen neben den Nutzlastdaten einer PDU auch die auf die Teile des Headers entfallenen Bytes von dem Zähler erfasst werden, soweit diese ebenfalls für eine ggfs. erforderliche neue Versendung zwischengespeichert werden. - cc)
Der Klagepatentanspruch kann jedoch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass Bytes, die im Header enthalten sind, von der Zählung ausgenommen sind, unabhängig davon, ob sie für eine eventuelle „retransmission“ gespeichert werden oder nicht. Für eine solche Auslegung bietet das Klagepatent keine Anhaltspunkte. Weder der Begriff der Dateneinheit noch der Begriff der Datenbytes ist – wie zuvor ausgeführt – dahin zu verstehen, dass er nur die Nutzlastdaten umfasst und infolgedessen die Zählung auf diese Bytes beschränkt ist.
Auch bei der gebotenen funktionalen Auslegung kann von einer Zählung von Dateneinheiten oder -bytes, die gespeichert werden, grundsätzlich nicht abgesehen werden (s.o.). Denn eine Aussage darüber, wie viele Sequenznummern bereits verbraucht sind und wie viel Speicherplatz belegt ist, kann nur dann zuverlässig getroffen werden, wenn sämtliche gesendeten Dateneinheiten und Datenbytes in die Zählung einfließen. Andernfalls ist es möglich, dass der erste oder zweite vordefinierte Wert (Merkmale 2.3.1 und 2.3.2) noch nicht erreicht oder noch nicht überschritten ist, obwohl tatsächlich sämtliche Sequenznummern verbraucht sind oder der gesamte Speicherplatz belegt ist. Dies umfasst aber auch Headerdaten, soweit diese zwischengespeichert werden. Denn auch Headerdaten nehmen „wertvollen“ Speicherplatz in Anspruch, der insbesondere bei einem Mobiltelefon begrenzt ist (vgl. High Court of Justice, Urteil vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat) in der deutschen Übersetzung, Anlage 17a Rn. 81). Insoweit besteht die Funktion der Zählung der Bytes gerade darin, eine Aussage über den bereits verbrauchten Speicherplatz treffen zu können, so dass gespeicherte Bytes ebenso wie gespeicherte Dateneinheiten in die Zählung einfließen müssen.
Etwas anderes könnte allenfalls dann gelten, wenn bestimmte Bytes in Elementen fester Größe der Dateneinheiten enthalten sind, so dass aus der Anzahl der gesendeten Dateneinheiten die Anzahl dieser gespeicherten Bytes berechnet werden könnte, sofern die übrigen Bytes der Elemente unterschiedlicher Größe der Dateneinheiten im Einzelnen gezählt werden. Ebenso wäre es denkbar, dass bestimmte, in jeder Dateneinheit enthaltene Elemente zwar eine unterschiedliche Anzahl von Bytes enthalten, die Anzahl dieser Bytes aber immer in einem festen, für alle Dateneinheiten geltenden Verhältnis zur Gesamtzahl der Bytes einer Dateneinheit steht. In einem solchen Fall wird es nicht erforderlich sein, jedes einzelne Byte auch dieser, in einem festen Verhältnis zur Gesamtgröße der Dateneinheit stehenden Elemente zu zählen, sondern die Anzahl gespeicherter Bytes aus der Anzahl der übrigen Bytes zu berechnen. Von diesen besonderen Fällen, in denen eine Berechnung die Zählung ersetzt, ausgenommen, sind jedoch grundsätzlich alle Dateneinheiten und -bytes, die gespeichert werden, auch zu zählen, um den Verbrauch an Sequenznummern und den Speicherstand abbilden zu können.
Diesem Verständnis scheint auch der High Court of Justice in seiner Auslegung zu folgen (Urteil vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat), Anlage 17a, Rn 81), ohne allerdings daraus irgendwelche Konsequenzen für die Verletzungsfrage zu ziehen (vgl. a.a.O. Rn 100 ff.). In keinem Fall kann aber – wie die Klägerin meint – von der Zählung der Bytes des Headers einer Dateneinheit immer abgesehen werden, selbst wenn diese für eine etwaige „retransmission“ zwischengespeichert werden. Eine solche Auslegung kann nicht aus dem am Prioritätstag geltenden LTE-Standard (3GPP TS 36.322 V8.0.0, vorgelegt als Anlage EIP D6) abgeleitet werden.
Das Klagepatent enthält keine Ausführungen zum Umfang der Speicherung von Dateneinheiten und -bytes nach dem damaligen LTE-Standard, so dass sich insofern aus der Beschreibung des Klagepatents für eine auf die Zählung ausschließlich der Bytes des Payloads beschränkte Auslegung nichts herleiten lässt. Abgesehen davon lässt sich auch dem damaligen LTE-Standard nicht entnehmen, dass die Header-Daten für etwaige „retransmissions“ nicht gespeichert wurden. Im Gegenteil gibt es Hinweise, dass diese Daten gespeichert wurden. So soll im Fall einer „retransmission“ die AMD PDU so, wie sie ist, mit Ausnahme des P-Feldes erneut gesendet werden („as it is except for the P field“, vgl. Ziff. 5.2.1 der Anlage EIP D6), wenn die AMD PDU vollständig in den Transportblock passt. Das P-Feld ist aber Teil des Headers. Umgekehrt soll, wenn die AMD PDU nicht vollständig in den Transportblock passt, die PDU segmentiert und eine neue AMD PDU gebildet werden. Für diese soll lediglich das Datenfeld der ursprünglichen PDU übernommen und der Header neu gebildet werden („Only map the Data field of the original AMD PDU (…) Set the header of the new AMD PDU segment (…)“, vgl. Ziff. 5.2.1 der Anlage EIP D 6). Selbst wenn die genannten Textstellen es nicht ausschließen, dass der Header einer AMD PDU für eine etwaige „retransmission“ nicht gespeichert wird, ließ der damalige LTE-Standard es bestenfalls offen, welche Teile des Headers zu speichern sind. So scheint es auch der High Court of Justice im englischen Parallelverfahren gesehen zu haben (Urteil vom 23.11.2015 – [2015] EWHC 3366 (Pat), Anlage 17a Rn. 81). Im Übrigen ist der LTE-Standard nicht der einzige Mobilfunkstandard; in anderen Standards wie etwa dem vorherigen UMTS-Standard wurde beispielsweise die gesamte PDU einschließlich Header für „retransmission“ zwischengespeichert. Vor diesem Hintergrund verbietet sich eine Auslegung, die von den gemäß Merkmal 2.2.2 zu zählenden Bytes solche des Headers zwingend ausschließt. Der Fachmann würde stattdessen davon ausgehen, dass die im Header enthaltenen Bytes dann gezählt werden müssen, wenn sie auch für eine etwaige „retransmission“ gespeichert werden. - dd)
Ebenso wenig können zwischengespeicherte Elemente der Dateneinheiten wie etwa die Headerdaten aufgrund ihrer geringen Größe bei der Zählung vernachlässigt werden. Die Klägerin vertritt insoweit die Auffassung, je nach Varianz der Größe der Dateneinheiten ließe sich durchweg mit einem Durchschnitts- oder Maximalwert für die Größe der PDU rechnen, ohne überhaupt irgendwelche Bytes zu zählen.
Dem vermag die Kammer nicht zu folgen. Der Anteil der Header- an der Gesamtgröße der PDU ist kein fester oder in jeder Hinsicht vernachlässigbarer Wert, der in keinem Fall Auswirkungen auf die Größe des Puffer-Speichers und die Auswahl des Grenzwertes hat. Die Klägerin hat den Anteil der Header an einer AMD PDU durchschnittlicher Größe mit etwa 0,33 % angegeben, während die Beklagte von einem höheren Anteil von bis zu 13% ausgeht. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass Mobilfunkgeräte nur über eine begrenzte Pufferkapazität verfügen und ein Volllaufen des Speichers erfindungsgemäß gerade vermieden werden soll. Für die Auslegung der Klägerin bieten weder der Patentanspruch noch die Patentschrift Anhaltspunkte. Denn unabhängig davon, wie groß der Anteil der gesamten PDU ist, der bei der Zählung vernachlässigt oder lediglich geschätzt wird, sind derartige Lösungen durch Zugrundelegung eines Durchschnitts- oder Maximalwertes für die Größe der PDU letztlich nicht von der Lehre des Klagepatents umfasst, weil sie nicht auf einer Zählung der Anzahl gesendeter Datenbytes beruhen, sondern das Problem der Protokollblockierungen mit anderen Mitteln lösen.
Das Klagepatent schlägt eine im Grundsatz in sich geschlossene, ausführbare technische Lehre vor, um das mit der Sequenznummernbeschränkung und der Speicherplatzbeschränkung verbundene Problem der Protokollblockierung zu lösen, indem es die Anzahl der gesendeten Dateneinheiten und Datenbytes zählt und jeweils mit einem vordefinierten Wert vergleicht, um bei dessen Erreichen oder Überschreiten einen Statusbericht anzufordern. Das Zählen der Dateneinheiten und Datenbytes ermöglicht eine zuverlässige Aussage darüber, wie viele Sequenznummern verbraucht sind und wie viel Speicherplatz belegt ist. Die Definition des jeweiligen Grenzwertes erlaubt die Anforderung eines Statusberichts, bevor die Sequenznummern verbraucht sind oder der Speicher gefüllt ist und es zu Protokollblockierungen kommt. Werden die Anzahl der Dateneinheiten und der Datenbytes der Dateneinheiten – und seien es auch nur die des Headers, die tatsächlich gespeichert werden – hingegen nur geschätzt bzw. Durchschnitts- oder Maximalwerte zugrunde gelegt, erlaubt das jeweilige Ergebnis grundsätzlich keine zuverlässige Aussage über die verbrauchten Sequenznummern beziehungsweise den Speicherfüllstand. Dies steht im Widerspruch zu der mit dem Zählmechanismus verbundenen Funktion. Um Protokollblockierungen zuverlässig vermeiden zu können, müsste der vordefinierte Grenzwert entsprechend niedriger gewählt werden. Dies hätte jedoch zur Folge, dass, wenn die tatsächliche Anzahl gesendeter Dateneinheiten bzw. Datenbytes fortdauernd oder wiederholt unterhalb des Schätzergebnisses liegt, wertvoller Speicherplatz oder auch Sequenznummern regelmäßig ungenutzt bleiben. Diesen Nachteil des Standes der Technik (Abs. [0012], [0013]) gilt es durch die patentgemäße Erfindung gerade zu vermeiden.
Nähme man hinsichtlich der gespeicherten Headerdaten eine Schätzung vor, würden andere als die patentgemäßen Mittel genutzt, um das mit der unterschiedlichen Größe von Dateneinheiten verbundene Problem der Protokollblockierung zu lösen. Die Abschätzung der Anzahl von Dateneinheiten oder Datenbytes stellt eine andere technische Lösung dar, die vom technischen Wortsinn des Klagepatentanspruchs nicht mehr erfasst wird.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Beschreibung des Klagepatents. Aus dieser erfährt der Fachmann, dass es im Stand der Technik zählerbasierte Lösungen zur Vermeidung von Protokollblockierungen gab (Abs. [0008] bis [0010]). Dass von diesen Zählmechanismen auch die bloße Abschätzung der Anzahl gesendeter Dateneinheiten oder Datenbytes erfasst und im Stand der Technik überhaupt bekannt war, behauptet auch die Klägerin nicht. Das Klagepatent greift jedenfalls mit der erfindungsgemäßen Lehre lediglich die aus dem Stand der Technik bekannten zählerbasierten Lösungen auf. Es ist insofern nicht ersichtlich, dass der im Klagepatentanspruch verwendete Begriff des Zählens anders als im Stand der Technik verstanden werden sollte. Der Kern der Erfindung besteht vielmehr darin, die Dateneinheit- und die -bytebasierte Zählung zu kombinieren, um beiden Ursachen für die Protokollblockierung – Sequenznummernbeschränkung und Speicherplatzbeschränkung – zuverlässig begegnen zu können. - ee)
Die Klägerin hat weiterhin im Termin zur mündlichen Verhandlung gegen die funktionale Auslegung nach vorstehendem Abschnitt bb) eingewandt, dass der Zähler den Speicherstand ohnehin nicht immer zuverlässig wiedergebe und dies sozusagen systemimmanent sei. Dies folge etwa aus Merkmal 2.4, wonach der Zählmechanismus bereits auf „0“ zurückgesetzt werde, wenn z.B. die gezählte Anzahl an übertragenen Datenbytes den zweiten vorgegebenen Schwellenwert erreiche, obwohl sich noch nicht bestätigte PDUs im Puffer befänden, die bei der weiteren Zählung unberücksichtigt blieben.
Dies rechtfertigt jedoch keine generelle Vernachlässigung von einzelnen Bytes wie etwa den Headerbytes bei der Zählung gemäß Merkmalsgruppe 2.2 des Klagepatentanspruchs. Eine solche Auslegung kann nicht damit begründet werden, dass der Anspruch an anderer Stelle eine Ungenauigkeit des Zählerstands hinnimmt. Sie ist – wie ausgeführt – weder vom Wortlaut des Anspruchs, noch von seiner Funktion umfasst und widerspricht auch der Anspruchssystematik, selbst wenn die vernachlässigten Datenbytes lediglich eine geringe Größe ausmachen und wenig Speicherplatz beanspruchen. Der Klagepatentanspruch scheint hinsichtlich der Merkmalsgruppe 2.4 jedenfalls davon auszugehen, dass auf die gemäß Merkmalsgruppe 2.3 erfolgte Anforderung eines Statusberichts die im Zwischenspeicher befindlichen Dateneinheiten alsbald bestätigt und gelöscht werden können. Diese zeitweise Diskrepanz zwischen Zählerstand und Speicherfüllstand nimmt das Klagepatent hin und lässt sich mit einem entsprechend gewählten Grenzwert überbrücken. Sollte dies nicht ausreichen, da eine Bestätigung der übertragenen Dateneinheiten ausbleibt, handelt es sich um einen unbeachtlichen Ausnahmefall; die Lehre des Klagepatents schließt nicht aus, dass es in besonderen Fällen gleichwohl zu Blockaden kommt. - ff)
Auch der weitere Einwand der Klägerin, dass nach der Lehre des Klagepatentanspruchs „retransmissions“ ebenfalls nicht erneut gespeichert und gezählt würden und danach nicht alle Datenbytes gezählt würden, überzeugt die Kammer nicht. Zum einen verhält sich der Klagepatentanspruch nicht zu „retransmissions“. Zum anderen handelt es sich im Fall von „retransmissions“ wiederum um einen Ausnahmefall, weil grundsätzlich gewünscht ist, dass sämtliche übertragenen Dateneinheiten bestätigt werden und nicht erneut gesendet werden müssen. Im Übrigen nimmt das Klagepatent auch diese Ungenauigkeit hin. Dass der Zähler nicht immer ein getreues Abbild des Speicherstandes ist, rechtfertigt es nicht, von zu übertragenen Dateneinheiten beliebige andere Elemente wie die Header prinzipiell von der Zählung auszunehmen. Dafür bietet das Klagepatent keine Anhaltspunkte. - 2.
Es lässt sich nicht feststellen, dass die angegriffene Ausführungsform einen Zählmechanismus aufweist, der so ausgelegt ist, dass er die Anzahl von gesendeten bzw. zu sendenden Datenbytes der gesendeten bzw. zu sendenden Dateneinheiten im Sinne des Merkmals 2.2.2 des Klagepatentanspruchs zählt.
Die angegriffenen Mobilgeräte stellen einen ersten Knoten im Sinne des Klagepatentanspruchs dar, mit denen ein Statusbericht von einem zweiten Knoten angefordert werden kann (Merkmal 1). Es ist unstreitig, dass die angegriffene Ausführungsform entsprechend den Vorgaben des LTE-Standards konfiguriert ist. - a)
Nach dem LTE-Standard nehmen RLC-Einheiten sowohl in Mobilgeräten als auch in eNodeBs die Funktionen der RLC-Schicht wahr. Unter anderem empfangen und versenden die RLC-Einheiten PDUs an und von der Partner-RLC-Einheit über untere Schichten (vgl. Ziffer 4.2.1 der Anlage EIP D11). Die Partner-RLC-Einheit stellt den zweiten Knoten im Sinne des Klagepatentanspruchs dar (Merkmalsgruppe 1).
Zu den von den RLC-Einheiten gesendeten PDUs gehören auch AMD PDUs („Acknowledged Mode Data PDU“) (vgl. Ziffer 4.2.1 a.E. und 4.2.1.3 der Anlage EIP D11). Bei den AMD PDUs handelt es sich um Dateneinheiten im Sinne des Klagepatentanspruchs, da es sich um eine bestimmte, individualisierbare und zählbare Menge von Bytes handelt. Die Dateneinheiten bestehen aus einem Header („AMD PDU header“) und einem Datenfeld („Data field“), die nach bestimmten Vorgaben des LTE-Standards aufgebaut und zusammengesetzt sind (Ziffer 6.2.1.4 der Anlage EIP D11). Unter anderem weisen die AMD PDUs eine individuelle Sequenznummer auf.
Die Sendeseite einer RLC-Einheit zählt sowohl AMD PDUs als auch Bytes, wenn eine neue AMD PDU zusammengesetzt wird („upon assembly of a new AMD PDU“). Die Zählung erfolgt dergestalt, dass eine Zustandsvariable in der Form eines Zählers beim Zusammensetzen der AMD PDU um „eins“ inkrementiert wird („increment PDU_WITHOUT_POLL by one“, Ziffer 5.2.2.1 der Anlage EIP D11; vgl. zur Definition des PDU-Zählers Ziffer 7.1 der Anlage EIP D11). Allerdings zählt die sendende RLC-Einheit nicht sämtliche Bytes der AMD PDU, sondern nur die Bytes des Datenfeldes einer neu zusammengesetzten PDU, also die Nutzlastbytes („increment BYTE_WITHOUT_POLL by every new byte of Data field element …“, Ziffer 5.2.2.1 der Anlage EIP D11; vgl. zur Definition des Byte-Zählers Ziffer 7.1 der Anlage EIP D11).
Die Bytes der Header einer AMD PDU werden nicht gezählt, obwohl dies bei zutreffender Auslegung des Klagepatentanspruchs erforderlich wäre. Wird der Klagepatentanspruch dahingehend verstanden, dass alle gesendeten Datenbytes gezählt werden müssen, ist eine Verletzung schon zu verneinen, weil die Bytes des Headers einer AMD PDU nicht gezählt werden. Aber auch wenn nur solche Datenbytes gezählt werden müssen, die tatsächlich zwischengespeichert werden, kann eine Verletzung nicht festgestellt werden. Denn der LTE-Standard scheint davon auszugehen, dass neben dem Datenfeld auch die Header für eine etwaige „retransmission“ zwischengespeichert werden. Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus Ziffer 5.2.1 zu den „retransmissions“. Danach soll die AMD PDU „as it is except for the P-field“ der nächsten Schicht übergeben werden, wenn sie vollständig in eine RLC PDU passt. Da das „P-field“ Teil des Headers ist, spricht dies dafür, dass auch der Header gespeichert wird. Insoweit heißt es auch, „store sequence number of the corresponding RLC data PDU in memory“ (Anlage EIP D11). Dass eine Speicherung der Sequenznummer nicht erfolgt, lässt sich im Übrigen dem LTE-Standard nicht entnehmen und hat auch die Klägerin nicht dargelegt.
Umgekehrt soll in dem Fall, dass die erneut zu übertragende AMD PDU nicht vollständig in eine RLC PDU passt, eine neue „AMD PDU segment“ gebildet werden, in die nur das Datenfeld der ursprünglichen AMD PDU übernommen wird („only map the Data field of the original AMD PDU to the Data field of the new AMD PDU segment“ [Ziff. 5.2.1 der Anlage EIP D11]). Dieser Hinweis wäre nicht nötig, wenn der Header der ursprünglichen AMD PDU ohnehin nicht zur Verfügung stünde, mithin nicht gespeichert wäre.
Die Header der AMD PDU haben auch keine feststehende Größe, die einen eindeutigen Rückschluss von der Anzahl gesendeter Dateneinheiten auf den von den Headern verbrauchten Speicherplatz zuließe, so dass sie nicht gezählt werden müssten. Jeder Header einer AMD PDU weist zwar einen Abschnitt fester Größe von zwei Byte auf („fixed part“). Er kann aber auch weitere Abschnitte aufweisen („extension part“), die dazu führen, dass die Header der AMD PDU unterschiedliche Größen haben können (vgl. zu Vorstehendem: Abschnitt 6.2.1.4 der Anlage EIP D11). Ebenso wenig steht die Größe der Header in einem festen Verhältnis zur Größe der gesamten PDU. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. Ob und wie die variierende Größe der Header zu berücksichtigen ist, damit sichergestellt wird, dass es nicht zu Protokollblockierungen kommt, gibt der LTE-Standard nicht vor.
Auch nach den Ausführungen des High Court of Justice wäre es für einen Fachmann offenkundig, dass Header gespeichert werden können oder auch nicht (z.B. wenn eine Neusegmentierung erforderlich ist, vgl. High Court of Justice, aaO., Anlage 17a Rn. 82). Insoweit wird in der Urteilsbegründung der Schluss gezogen, dass es auch sinnvoll wäre, die Header zu zählen. Dieser Gedanke wird dann aber nicht weiterverfolgt. - b)
Selbst wenn es der LTE-Standard offen lässt und damit der Implementierung überlässt, ob der Header einer AMD PDU für etwaige „retransmissions“ zwischengespeichert wird oder nicht, lässt sich gleichwohl nicht feststellen, ob die angegriffene Ausführungsform die Lehre des Klagepatentanspruchs verwirklicht. Denn es bleibt letztlich unklar, wie sich insoweit die angegriffene Ausführungsform verhält. Es ist nicht vorgetragen, ob diese die in den Headern der AMD PDU enthaltenen Bytes speichert oder ob lediglich die Synchronisationsnummer SN gespeichert wird und im Falle einer „retransmission“ der Header „on the fly“ gebildet wird. Die genaue Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform ist jedoch entscheidend, weil der LTE-Standard jedenfalls vorgibt, nur die Bytes des Datenfeldes zu zählen. Sollte die angegriffene Ausführungsform aber – was offen ist – auch die Bytes des Headers zwischenspeichern, wird das Merkmal 2.2.2 nicht verwirklicht. Die angegriffene Ausführungsform zählt dann nicht alle zu übertragenden Datenbytes, jedenfalls nicht soweit sie auch gespeichert werden. Dass es der Klägerin nicht möglich ist, zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorzutragen, ist weder dargelegt, noch anderweitig ersichtlich, so dass sich auch die Frage einer sekundären Darlegungslast der Beklagten nicht stellt. -
C
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 101 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. - Der Streitwert wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.