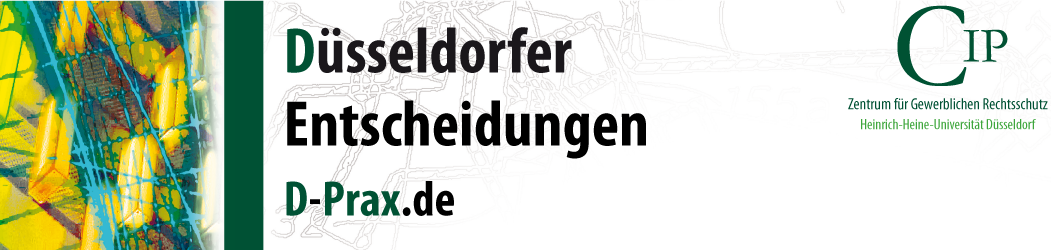Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3392
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 30. Oktober 2024, Az. 4b O 55/23
- Die Klage wird abgewiesen.
- Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
- Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
- Tatbestand
- Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 3 522 XXX B1 (im Folgenden: Klagepatent; siehe für das Klagepatent Anlage K 1, für die deutsche Übersetzung Anlage K 1 a) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Vernichtung und Rückruf der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.
- Das Klagepatent wurde am 26. Mai 2015 unter Inanspruchnahme mehrerer US-amerikanischer Prioritäten, wovon die früheste auf den 27. Mai 2014 datiert, angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 31. August 2022 im Patentblatt bekannt gemacht.
- Die Beklagte zu 2) hat gegen das Klagepatent unter dem 31. Oktober 2023 Nichtigkeitsklage bei dem Bundespatentgericht erhoben. Das Verfahren wird dort unter dem Aktenzeichen 6 Ni 39/23 (EP) geführt. Eine Entscheidung ist bislang nicht ergangen.
- Das in englischer Sprache abgefasste Klagepatent bezieht sich allgemein auf Solarzellenmodule, bei denen die Solarzellen schindelförmig angeordnet sind.
- Die Klägerin stützt ihre Klage auf den Anspruch 1 des Klagepatents, der in der deutschen Übersetzung wie folgt lautet:
-
Solarmodul, umfassend:
eine Vielzahl von Superzellen (100), die in physisch parallelen Reihen angeordnet sind, wobei jede Superzelle eine Vielzahl von Siliziumsolarzellen umfasst, die so angeordnet sind, dass sich gegenüberliegende Kanten benachbarter Solarzellen überlappen und leitend miteinander verbunden sind, um die Siliziumsolarzellen elektrisch miteinander in Reihe zu schalten, wobei jede Solarzelle eine während des Betriebs des Moduls durch Sonnenlicht zu beleuchtende vordere Oberfläche und eine gegenüberliegend positionierte hintere Oberfläche umfasst; wobei die Superzellen (100) elektrisch parallel geschaltet sind, wobei jede Superzelle elektrisch in eine Vielzahl von Superzellensegmenten durch verborgene Abgriffverbindungen (3400) an Zwischenstellen entlang einer Superzelle segmentiert ist, während eine physisch kontinuierliche Superzelle aufrechterhalten wird, wobei die verborgenen Abgriffverbindungen (3400) benachbarte Superzellensegmente elektrisch parallel miteinander verbinden und dadurch Gruppen von parallel verbundenen Superzellensegmenten bilden, wobei jede Zwischenverbindung (3400) leitend mit mindestens einer verborgenen Abgriffkontaktfläche (3320, 3325) auf der hinteren Oberfläche einer Superzelle und mit mindestens einer weiteren verborgenen Abgriffkontaktfläche (3320, 3325) auf der hinteren Oberfläche der Superzelle verbunden ist und wobei jedes Superzellensegment parallel mit einer entsprechenden Überbrückungsdiode (1300A bis 1300C) verbunden ist, die durch Busverbindungen (1500A bis 1500C) verbunden sind, die sich hinter den Superzellen befinden, wobei jede Überbrückungsdiode (1300A bis 1300C) auf der Rückseite des Moduls innerhalb eines Anschlusskastens angeordnet ist. - Wegen der in Form von „insbesondere“-Ansprüchen geltend gemachten Unteransprüche des Klagepatents wird auf die Anträge der Klägerin verwiesen.
- Die nachfolgend wiedergegebene Figur 42A zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung:
- Die Beklagte zu 1) ist ein XXX Unternehmen mit Sitz in XXX, XXX. Sie ist auf den Gebieten der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten für die Solarenergiegewinnung tätig und entwickelt und vertreibt weltweit unter anderem die mit der Klage angegriffenen „A“ Schindelmodule.
- Die Beklagte zu 2) ist ein in Deutschland ansässiges verbundenes Unternehmen der Beklagten zu 1). Laut ihres Handelsregisterauszuges liegt der Gegenstand ihres Unternehmens unter anderem in dem Vertrieb von Solarenergieprodukten, dem Handel, Import und Export von Polysilizium, Ingots und Wafern, Solarzellen und PV-Modulen und dem Bau von Solaranlagen, sowie dem Technologieaustausch und der Marktforschung und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, wozu insbesondere Kundendienst und Wartung, Finanzierung oder Investition von PV-Anlagenprojekten gehören.
- Die Klägerin wendet sich gegen Angebot und Vertrieb der „A“-Schindelmodule, darunter exemplarisch das Modell mit der Bezeichnung B und alle kerngleichen Schindelmodule. Die angegriffene Ausführungsform wird über die Webseite http://de.XXX.com/XXXhtml angeboten, auf der die Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich als Exportregion angegeben ist.
- Die Klägerin meint, dass nicht nur die Beklagte zu 1), sondern auch die Beklagte zu 2) aktivlegitimiert sei. Dies gehe bereits aus dem Jahresbericht der Beklagten zu 1) hervor, aus welchem sich ergebe, dass die Beklagten im Jahr 2022 in nicht unerheblichem Umfang Solarmodule in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben hätten und in dem die Beklagte zu 2) als „Überseeische Betriebsstätte“ der Beklagten zu 1) aufgelistet sei. Darüber hinaus finde sich bei „LinkedIn“ das Profil eines im Inland ansässigen Mitarbeiters der Beklagten zu 2).
- Die Klägerin ist der Auffassung, dass die angegriffene Ausführungsform alle Merkmale der erfindungsgemäßen Lehre verwirkliche. Sie meint, dass dem Klagepatent das Problem zu Grunde liege, dass eine Zelle umgekehrt vorgespannt sein könne, weil sie beispielsweise eine Fehlfunktion aufweisen oder verschattet beziehungsweise verschmutzt sein könne. In diesem Fall sorge die Bypass-Diode dafür, dass die elektrische Energie nicht in umgekehrter Richtung durch die Solarzelle fließe und damit die Wärmeentwicklung in der Zelle begrenzt werde. Vor diesem Hintergrund stelle sich das Klagepatent die Aufgabe, das Risiko von Schäden durch umgekehrt vorgespannte Solarzellen in einem Solarmodul weiter zu minimieren beziehungsweise zu vermeiden. Die Aufgabe sei hingegen nicht in der Verbesserung der Modulästhetik zu sehen.
- Die Klägerin trägt vor, dass die erfindungsgemäßen Abgriffverbindungen die Superzellen miteinander verbänden, was es erforderlich mache, dass sich diese Abgriffverbindungen über mindestens zwei Superzellen erstreckten. Wenn die Superzellen dabei nicht nahtlos aneinander lägen – was von der erfindungsgemäßen Lehre auch nicht gefordert werde – sondern ein Spalt zwischen den Superzellen vorhanden sei, müssten die Abgriffverbindungen diesen etwaigen Spalt überbrücken und seien, auch wenn sie auf der Rückseite angebracht seien, von vorne durch den Spalt sichtbar.
- Vor diesem Hintergrund erfordere die klagepatentgemäße Lehre mit „verborgenen Abgriffverbindungen“ lediglich die Anordnung auf der Rückseite der Superzelle. An dem „Verborgensein“ fehle es nicht bereits, wenn die Abgriffverbindungen durch einen Spalt zwischen den Superzellen von der Vorderseite in einem kleinen Teilbereich sichtbar seien. Zudem bedeute der Begriff „verborgen“ auch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht, dass etwas unsichtbar sein müsse; ein Abdecken oder Tarnen reiche dazu aus. Dies werde bestätigt durch die Beschreibung, die ausdrücklich auf die mögliche Sichtbarkeit der Abgriffverbindung durch einen solchen Spalt verweise sowie durch die erfindungsgemäßen Figuren, die ebenfalls einen Spalt zeigten.
- Ferner sehe die erfindungsgemäße Lehre auch hinsichtlich der Bus-Verbindungen lediglich vor, dass diese hinter den Superzellen angeordnet seien, was bedeute, dass diese Verbindungen bei der Draufsicht in einer Ebene räumlich hinter den Superzellen angeordnet seien.
- Nach dieser Auslegung verletze die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent. Denn die Abgriffverbindungen seien hinter den Superzellen angeordnet und damit „verborgen“ im Sinne des Klagepatents. Auch die Überbrückungsdioden seien hinter den Solarzellen angeordnet, was sich bereits daraus ergebe, dass der zwischen den Solarzellen befindliche Spalt gar nicht breit genug für diese Dioden sei, diese also nicht gänzlich in dem Spalt verschwinden könnten.
- Die Klägerin ist schließlich der Auffassung, dass das Klagepatent rechtsbeständig sei. Es sei nicht nur neu, sondern auch erfinderisch.
- Die Klägerin beantragt,
- I. die Beklagten zu verurteilen,
- 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,
- Solarmodule, umfassend eine Vielzahl von Superzellen, die in physisch parallelen Reihen angeordnet sind
- in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
- wobei jede Superzelle eine Vielzahl von Siliziumsolarzellen umfasst, die so angeordnet sind, dass sich gegenüberliegende Kanten benachbarter Solarzellen überlappen und leitend miteinander verbunden sind, um die Siliziumsolarzellen elektrisch miteinander in Reihe zu schalten,
- wobei jede Solarzelle eine während des Betriebs des Moduls durch Sonnenlicht zu beleuchtende vordere Oberfläche und eine gegenüberliegend positionierte hintere Oberfläche umfasst;
- wobei die Superzellen elektrisch parallel geschaltet sind,
- wobei jede Superzelle elektrisch in eine Vielzahl von Superzellensegmenten durch verborgene Abgriffverbindungen an Zwischenstellen entlang einer Superzelle segmentiert ist, während eine physisch kontinuierliche Superzelle aufrechterhalten wird, wobei die verborgenen Abgriffverbindungen benachbarte Superzellensegmente elektrisch parallel miteinander verbinden und dadurch Gruppen von parallel verbundenen Superzellensegmenten bilden,
- wobei jede Zwischenverbindung leitend mit mindestens einer verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche einer Superzelle und mit mindestens einer weiteren verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche der Superzelle verbunden ist und wobei jedes Superzellensegment parallel mit einer entsprechenden Überbrückungsdiode verbunden ist, die durch Busverbindungen verbunden sind, die sich hinter den Superzellen befinden, und
- wobei jede Überbrückungsdiode auf der Rückseite des Moduls innerhalb eines Anschlusskastens angeordnet ist;
- 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 31.08.2022 begangen haben, und zwar unter Angabe
- a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
- b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
- c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden
- wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind,
- wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
- 3. der Klägerin darüber Rechnung zulegen, in welchem Umfang sie die zu I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 31.09.2022 begangen haben, und zwar unter Angabe
- a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
- b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;
- c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne;
-
d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns;
wobei - den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- und wobei die Auskunfts- und Rechnungslegungsdaten in einer mittels EDV auswertbaren elektronischen Form zu übermitteln sind;
- 4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
- 5. die unter I.1. bezeichneten, seit 31.08.2022 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den von der Kammer festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
- II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin sämtliche Schäden zu ersetzen, die ihr durch die zu I.1. bezeichneten und seit dem 31.09.2022 begangenen Handlungen entstanden sind und noch entstehen werden.
- Die Beklagten beantragen,
- I. die Klage abzuweisen;
- II. das Urteil wegen der Kosten, gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft), für vorläufig vollstreckbar zu erklären; den Beklagten notfalls zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf die Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden;
- hilfsweise,
- III. das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die vor dem Bundespatentgericht anhängige Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Europäischen Patents EP 3 522 XXX B1 (Aktenzeichen: 6 Ni 39/23 (EP) auszusetzen.
- Die Beklagten sind der Auffassung, dass die Beklagte zu 2) schon nicht passivlegitimiert sei. Sie sei an den von der Klägerin behaupteten Benutzungshandlungen nicht beteiligt. Die Klägerin habe keine Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass die Beklagte zu 2) sich in Zukunft an solchen Handlungen beteiligen werde, so dass auch keine Erstbegehungsgefahr vorliege. Tatsächlich sei die Beklagte zu 2) lediglich als Repräsentationsbüro errichtet worden. Sie habe keine eigenen Mitarbeiter und lasse eingehende Behördenpost von der Steuerberatungsgesellschaft entgegennehmen, deren Adresse sie teile. Sofern die Klägerin einen Jahresbericht vorgelegt habe, stamme dieser nicht von der Beklagten zu 1), sondern von der C Co., Ltd., bei der es sich um ein anderes Unternehmen handele. Ferner seien die in dem „LinkedIn“-Profil gemachten Angaben eines angeblichen Mitarbeiters falsch und dieser daher bereits abgemahnt worden.
-
Die Beklagten meinen zudem, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze. Die schindelförmige Anordnung von Solarzellen sei vorbekannt gewesen und es gehe bei dem klagepatentgemäß beanspruchten Solarmodul vielmehr darum, eine vollständig schwarze Erscheinung bereitzustellen. Die Beschreibung des Klagepatents verweise in diesem Zusammenhang nicht nur auf die ästhetischen Vorteile dieser Ausgestaltung, sondern auch auf die Erhöhung des Wirkungsgrads in einem Solarzellenmodul. Das im Stand der Technik vorbekannte Problem sei dabei, dass die Abgriffe und die die Zellen verbindenden Leitungen stark reflektierend seien und einen großen Kontrast zu den schwarzen Solarzellen bildeten.
Sofern die Klägerin darauf abstelle, dass es um einen effizienteren Wärmetransfer gehe, verkenne sie, dass dieser bereits mit der vorbekannten, schindelförmigen Anordnung erreicht werde. - Das patentgemäß erforderliche, vollkommen schwarze Erscheinungsbild werde dadurch erzielt, dass die Abgriffverbindungen auf der Rückseite des Solarmoduls angeordnet seien, wobei diese darüber hinaus auch versteckt sein müssten. Dazu reiche die bloße räumliche Anordnung hinter der Solarzelle nicht aus.
- Außerdem müssten sich die Überbrückungsdioden hinter den Solarzellen befinden, wozu eine Anordnung zwischen den Zellen nicht ausreiche. Bestätigt werde diese Auslegung durch die Äußerungen der Klägerin im Erteilungsverfahren, in welchem diese selbst davon ausgegangen sei, dass der Unterschied zwischen der – nicht patentgemäßen – Figur 40 und der erfindungsgemäßen Figur 42A darin liege, dass die Leiter zum einen entlang einer Mittellinie und zum anderen hinter den Superzellen angeordnet seien. Diese Aussage sei zwar im Verfahren relativiert worden, weil sie sich auf die damalige Fassung des Anspruchs 1 nicht bezogen habe, für die von der Klägerin geltend gemachte Fassung sei dies aber sehr wohl relevant. Da die Klägerin im Erteilungsverfahren deutlich gemacht habe, dass die Ausgestaltung gemäß Figur 40 nicht patentgemäß sei, müsse sie sich nunmehr daran festhalten lassen.
- Nach dieser Auslegung verwirkliche die angegriffene Ausführungsform die erfindungsgemäße Lehre nicht. Denn die Abgriffverbindungen seien bei dieser auch in der Vorderansicht zu sehen, denn dort sei der Spalt zwischen zwei benachbarten Superzellen durch einen transparenten EVA (Ethylen-Vinylacetat)–Leim gefüllt, durch den die jeweilige Abgriffverbindung sichtbar sei.
- Ferner seien die Bus-Verbindungen – zusammen mit den Dioden – auf einer zentralen Linie des Moduls positioniert, womit es sich nicht um eine erfindungsgemäße Positionierung hinter den Superzellen handele.
- Die Beklagten meinen zudem, dass das Klagepatent nicht rechtsbeständig sei. Die erfindungsgemäße Lehre sei nicht neu gegenüber der US 2012/XXX A1 und zudem auch nicht erfinderisch gegenüber weiteren Entgegenhaltungen.
- Entscheidungsgründe
-
A
Die zulässige Klage ist unbegründet. - Der Klägerin stehen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB nicht zu.
-
I.
Das Klagepatent betrifft allgemein Solarzellenmodule, bei denen die Solarzellen schindelartig angeordnet sind, Absatz [0001] des Klagepatents (alle folgenden, nicht näher bezeichneten Absätze sind solche des Klagepatents). - In Absatz [0002] heißt es, dass zur Deckung des weltweit ständig steigenden Energiebedarfs alternative Energiequellen benötigt werden und in vielen geografischen Regionen die Solarenergie-Ressourcen ausreichend seien, um den Bedarf zum Teil durch die Bereitstellung von mit Solarzellen erzeugtem Strom abzudecken.
- Das Klagepatent verweist auf die aus dem Stand der Technik bekannte US 2014/XXX A1, aus der eine Kette von Solarzellen bekannt sei, die in Reihe geschaltete Solarzellen umfasse, die in einem überlappenden Schindelmuster angeordnet seien.
- Das Klagepatent nennt nicht ausdrücklich eine bestimmte Aufgabe, sondern spricht mehrere Probleme an, für die die klagepatentgemäße Vorrichtung eine Lösung bieten soll. Dazu gehört unter anderem das Erzielen einer komplett schwarzen Modulästhetik, siehe Absatz [0348]. Um unter anderem eine solche Ästhetik zu erreichen, schlägt das Klagepatent mit dem Anspruch 1 die folgende Vorrichtung vor:
-
1.1. Solarmodul,
1.2. umfassend eine Vielzahl von Superzellen,
1.2.1. die in physikalisch parallelen Reihen angeordnet sind,
1.3.1. wobei jede Superzelle eine Vielzahl von Siliziumsolarzellen umfasst,
1.3.2. die so angeordnet sind, dass sich gegenüberliegende Kanten benachbarter Solarzellen überlappen
1.3.3. und leitend miteinander verbunden sind, um die Siliziumsolarzellen elektrisch miteinander in Reihe zu schalten,
1.4. wobei jede Solarzelle eine während des Betriebs des Moduls durch Sonnenlicht zu beleuchtende vordere Oberfläche und eine gegenüberliegend positionierte hintere Oberfläche umfasst;
1.5. wobei die Superzellen elektrisch parallel geschaltet sind,
1.6. wobei jede Superzelle elektrisch in eine Vielzahl von Superzellensegmenten durch verborgene Abgriffverbindungen an Zwischenstellen entlang einer Superzelle segmentiert ist, während eine physikalisch kontinuierliche Superzelle aufrechterhalten wird,
1.6.1. wobei die verborgenen Abgriffverbindungen benachbarte Superzellensegmente elektrisch parallel miteinander verbinden und dadurch Gruppen von parallel verbundenen Superzellensegmenten bilden,
1.6.2. wobei jede Zwischenverbindung leitend mit mindestens einer verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche einer Superzelle und mit mindestens einer weiteren verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche der anderen Superzelle verbunden ist,
1.7. und wobei jedes Superzellensegment parallel mit einer entsprechenden Überbrückungsdiode verbunden ist, die durch Busverbindungen verbunden sind, die sich hinter den Superzellen befinden,
1.8. wobei jede Überbrückungsdiode auf der Rückseite des Moduls innerhalb eines Anschlusskastens angeordnet ist.
II.
Der Klagepatentanspruch 1 betrifft ein Solarmodul bestehend aus einer Vielzahl von Superzellen, Merkmale 1.1 und 1.2. - Die Ausgestaltung und Anordnung der Superzellen innerhalb des Solarmoduls wird in den Merkmalen 1.2.1 bis 1.3.3 näher beschrieben. Jede Superzelle umfasst demnach eine Vielzahl von Siliziumsolarzellen, die überlappend angeordnet sind, Merkmale 1.3.1 und 1.3.2. Die Siliziumsolarzellen sind leitend miteinander verbunden, um sie elektrisch miteinander in Reihe zu schalten, Merkmal 1.3.3.
- Weiter definiert das Klagepatent die während des Betriebs durch Sonnenlicht zu beleuchtende Seite als vordere Oberfläche (front surface; im Folgenden auch als Vorderseite bezeichnet) und die gegenüberliegende Seite als hintere Oberfläche (rear surface; im Folgenden auch als Rückseite bezeichnet), Merkmal 1.4.
- Nach Merkmal 1.5 sind die Superzellen parallel geschaltet. Das Merkmal 1.6 unterscheidet sodann zwischen der jeweiligen physikalischen Superzelle einerseits und der elektrisch erfolgenden Aufteilung der Superzelle in Superzellensegmente andererseits. Die elektrische Aufteilung geschieht durch verborgene Abgriffverbindungen, Merkmal 1.6. Die Ausgestaltung dieser Abgriffverbindungen im Einzelnen ist Gegenstand der Merkmale 1.6.1 und 1.6.2. Die Superzellensegmente werden dazu durch Überbrückungsdioden miteinander verbunden, die wiederum Gegenstand der Merkmale 1.7 und 1.8 sind.
- Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedürfen die Merkmalsgruppe 1.6 und die Merkmale 1.7 und 1.8 der Auslegung.
-
1.
Das Merkmal 1.6 setzt sich mit dem Unterschied zwischen einer „physikalisch kontinuierlichen“ Superzelle einerseits und der Segmentierung in eine „elektrische Vielzahl“ von Superzellensegmenten andererseits auseinander. -
a)
Nach Merkmal 1.6.1 werden benachbarte Superzellensegmente durch Abgriffverbindungen elektrisch parallel miteinander verbunden, wodurch die Superzellensegmente Gruppen bilden. Die Abgriffverbindungen müssen verborgen sein, wobei es sich um eine Anforderung an die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Superzellen handelt, die jedoch keine Auswirkungen auf die elektrische Schaltung hat. - Gemäß Merkmal 1.6.2 ist jede Abgriffverbindung leitend mit mindestens einer verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche einer ersten Superzelle und mit mindestens einer weiteren verborgenen Abgriffkontaktfläche auf der hinteren Oberfläche einer zweiten Superzelle verbunden. In der deutschen Version des Klagepatentanspruchs heißt es zwar im Gegensatz zu Merkmal 1.6.1 nicht Abgriffverbindung, sondern Zwischenverbindung. Mit Blick auf die maßgebliche englische Version wird jedoch klar, dass beide Begrifflichkeiten dasselbe bezeichnen. Es heißt insofern in der englischen Version in Merkmal 1.6 und 1.6.1 „hidden tap interconnects“, während in Merkmal 1.6.2 mit der Bezeichnung „each interconnect“ auf eben diese „hidden tap interconnects“ Bezug genommen wird. Vor allem stellt das Wort „each“ in Merkmal 1.6.2 den Bezug zu den in Merkmal 1.6.1 genannten „hidden tap interconnects“ her. Zudem sind sowohl die in den Merkmalen 1.6 und 1.6.1 genannten „hidden tap interconnects“ als auch der in Merkmal 1.6.2 genannte „interconnect“ mit der Bezugsziffer 3400 bezeichnet. Insofern ist es belanglos, ob der Begriff als Abgriffverbindung oder Abgriffzwischenverbindung bezeichnet wird, inhaltlich ist dasselbe gemeint.
- Nach Merkmal 1.6.2 muss die Verbindung zwischen der Abgriffkontaktfläche und der Abgriffverbindung leitend sein. Mit dem Begriff „leitend“ wird Bezug genommen auf die elektrische Leitung; denn erst diese ermöglicht es, dass die Superzellensegmente elektrisch parallel miteinander verbunden sind, siehe Merkmal 1.6.1. Neben den Anforderungen an die elektrische Verbindung in Form der Leitfähigkeit erfordert der Klagepatentanspruch, dass die Abgriffkontaktflächen nicht nur auf der Rückseite der Oberfläche einer Superzelle angeordnet sind, sondern auch diese müssen darüber hinaus „verborgen“ sein.
- Diese Unterscheidung bestätigt die Beschreibung, die in Absatz [0312] Bezug nimmt auf die Abgriffkontaktflächen. Darin heißt es, dass die rückseitig angeordneten Kontaktpads elektrische Angriffspunkte bereitstellen, die von der Vorderseite des Solarmoduls nicht sichtbar sind und daher auch als „hidden taps“ bezeichnet werden. Diese werden noch einmal explizit dahingehend definiert, dass es sich um die Verbindung zwischen der Rückseite der Solarzelle und einer leitenden Verbindung handelt, also die Abgriffkontaktflächen im Sinne des Merkmals 1.6.2 gemeint sind. Damit bestätigt die Beschreibung, dass das Adjektiv „hidden“ eine „Nichtsichtbarkeit von der Vorderseite des Solarmoduls“ meint. Dass die Abgriffkontaktflächen verborgen sind, hat laut Beschreibung den Vorteil, dass diese nicht mit Sonnenlicht beleuchtet werden und die stark reflektierenden Leiter, die für diese Verbindungen benutzt werden, nicht in Kontrast zu den angeschlossenen Solarzellen stehen, Absatz [0348].
-
b)
Auch die Abgriffverbindungen müssen verborgen sein, Merkmal 1.6. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese „Nichtsichtbarkeit“ in Zusammenhang mit der in den Merkmalen 1.6 bis 1.6.2 genannten Abgriffverbindung anders auszulegen wäre als in Zusammenhang mit den Abgriffkontaktflächen, so dass auch das „Verborgensein“ dieser Abgriffverbindung nur vorliegt, wenn diese – in Frontalansicht des Solarmoduls – nicht sichtbar ist. - Für das Auge nicht sichtbar ist etwas nur dann, wenn es insgesamt nicht mehr zu sehen ist. Ein teilweises Verbergen ist insofern nicht ausreichend, denn auch eine nur teilweise Sichtbarkeit führt zu einer Sichtbarkeit und damit zu einem „Nicht-Verborgensein“. Insofern steht es einer Verwirklichung dieses Merkmals bereits dann entgegen, wenn eine teilweise Sichtbarkeit im Sinne eines „Durchscheinens“ gegeben ist. Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass das Merkmal zu der Modulästhetik beitragen soll, in Absatz [0316] jedoch nur auf ein „im Wesentlichen“ schwarzes Erscheinungsbild abgestellt wird. Es ist bereits unklar, ob sich die in diesem Absatz genannten „Cell-to-Cell“-Verbindungen überhaupt auf die Abgriffverbindungen beziehen. Selbst wenn dies der Fall wäre, kann dem lediglich entnommen werden, dass das Erscheinungsbild insgesamt gemeint ist, zu dem vor allem das Solarmodul selbst beiträgt. Eine Einschränkung hinsichtlich der Anforderungen an das „Verborgensein“ der Abgriffverbindungen lässt sich daraus nicht herleiten.
- Auf welche Art und Weise die erforderliche „Nichtsichtbarkeit“ erreicht wird, ergibt sich aus dem Klagepatentanspruch selbst zumindest nicht unmittelbar. In Zusammenhang mit den Merkmalen 1.6.1 und 1.6.2 ist jedoch ersichtlich, dass die Abgriffverbindungen die – ebenfalls verborgenen – Abgriffkontaktflächen mehrerer Superzellensegmente verbinden. Diese Abgriffkontaktflächen sind nach Merkmal 1.6.2 rückseitig angebracht, was wiederum bedeutet, dass auch die Abgriffverbindungen auf der Rückseite angebracht sein müssen. Schließlich wäre es technisch-funktional nicht sinnvoll, die Abgriffverbindungen auf der Vorderseite anzubringen, wenn diese ebenfalls verborgen sein sollen.
- In Bezug auf die Abgriffverbindungen reicht jedoch die rückseitige Lage allein nicht aus, um zu einer vollständigen Nichtsichtbarkeit zu führen. Die Beschreibung thematisiert die Sichtbarkeit der Abgriffverbindungen bei Solarmodulen in Absatz [0339]. Darin heißt es, dass ein Teil der jeweiligen Abgriffverbindung durch die zwischen zwei parallelen Reihen von Superzellen entstehende Lücke von der Vorderseite des Solarmoduls aus sichtbar sein könne. Die Beschreibung spricht in diesem Zusammenhang davon, dass der sichtbare Teil „optional“ geschwärzt und beispielsweise mit einer schwarzen Polymerschicht überzogen werden könne, um die Sichtbarkeit zu verringern. Sofern hier von einer „optionalen“ Verringerung der Sichtbarkeit gesprochen wird, sieht die erfindungsgemäße Lehre eine solche Optionalität nicht vor, sondern erfordert – unabhängig von einem solchen Schwärzen – das „Nichtsichtbarsein“. Dies ergibt sich auch daraus, dass sich Absatz [0339] auf die Figuren 37F-1 bis 37F-3 bezieht, die nach Absatz [0106] explizit keine erfindungsgemäßen Ausführungsformen zeigen.
- Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Klägerin ist zwischen den Solarzellen zudem immer eine Dehnungsfuge notwendig, um eine thermische Ausbildung zu ermöglichen, was ein komplett lückenloses Design unmöglich mache. Dies hat zur Folge, dass es immer einen Spalt geben muss, durch den die Abgriffverbindungen von vorne aus zu sehen sind, sofern nicht – wie von dem Klagepatent gefordert – Maßnahmen ergriffen werden, um dem entgegenzuwirken. Insofern ist allein die rückseitige Lage der Abgriffverbindungen nicht ausreichend, um das Merkmal „Verborgensein“ zu erfüllen.
-
c)
Eine andere Auslegung des Begriffs „Verborgensein“ kann weder der Beschreibung des Klagepatents noch den Figuren entnommen werden. - In Absatz [0106] wird klargestellt, dass weder die Figuren 1 bis 40 noch die Figuren 44A bis 82J und die entsprechende Beschreibung Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Lehre betreffen, aber das Verständnis fördern sollen.
- Das bedeutet, dass die Beschreibung im Hinblick auf diese Figuren nur allgemein zum Begriffsverständnis beiträgt. Umgekehrt folgt daraus aber nicht, dass die erfindungsgemäßen Figuren 41 bis 43 tatsächlich alle Merkmale der erfindungsgemäßen Lehre zeigen müssen. So soll nach Absatz [0349] die – nicht erfindungsgemäße – Figur 40 ein physisches Layout zeigen und die – erfindungsgemäße – Figur 41 einen elektrischen Schaltplan. Die Figuren zeigen demnach unvollständige, schematische Abbildungen, so dass auch die nachfolgend in den Absätzen [0350] ff. beschriebenen Figuren nicht alle erfindungsgemäßen Merkmale aufweisen müssen. Wenn es darin also heißt, dass die Abgriffkontaktflächen versteckt seien, das Adjektiv „versteckt“ aber nicht in Zusammenhang mit den Abgriffverbindungen genutzt wird, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass es der klagepatentgemäßen Lehre auf ein „Verborgensein“ der Abgriffverbindungen nicht ankäme. Dem steht bereits der eindeutige Wortlaut des Klagepatentanspruchs entgegen. Insofern verwundert es nicht, dass der in Absatz [0349] beschriebenen Figur 42A nicht entnommen werden kann, auf welche Art und Weise das „Verborgensein“ der Abgriffverbindungen erreicht wird. Die Figur 42A zeigt das Solarmodul in Rückansicht, was sich daraus ergibt, dass der Verlauf der auf der Rückseite befindlichen Busverbindungen zu sehen ist. Das Problem der durch die Spalte sichtbaren Abgriffverbindungen stellt sich jedoch nur in Frontalansicht.
- In der Figur 42A werden ferner zwei Bereiche durch Pfeile eingekreist, in denen sich die verborgenen Abgriffverbindungen befinden sollen. Diese werden dann noch einmal in der Figur 42B dargestellt, in der es ausdrücklich „hidden interconnect“ heißt. Jedoch lässt die in der Figur 42B gezeigte Ausgestaltung dieses „hidden interconnects“ nicht den Rückschluss darauf zu, dass die Abgriffverbindung bei entsprechender Ausgestaltung tatsächlich versteckt ist. Denn das „Verborgensein“ ist keine der Abgriffverbindung innewohnende Eigenschaft, sondern wird zunächst durch die rückseitige Anbringung erreicht, die die Abgriffverbindung in Frontalansicht zu einem großen Teil verdeckt, und in Bezug auf den Spalt nur durch zusätzliche Maßnahmen.
- Auch die erfindungsgemäße Figur 43 lässt keine weiteren Rückschlüsse auf die Auslegung des Begriffs „verborgen“ zu. Darin ist eine ähnlich der Figur 42A abgebildete Konfiguration zu sehen. Dort sind jedoch keine kurzen Abgriffverbindungen, sondern durch dicke, quer verlaufende Striche dargestellte lange Abgriffverbindungen zu sehen. Die Figur zeigt jedoch nicht die – nach den Angaben der Klägerin immer erforderlichen – Spalte und lässt damit ebenfalls keinen Rückschluss auf die Auslegung des Merkmals „verborgen“ zu.
-
d)
Demgegenüber ist das Merkmal „Verborgen“ nicht im Lichte der Absätze [0183] ff. auszulegen. Absatz [0183] verweist auf das Problem, dass eine Solarzelle eine umgekehrte Spannung aufweisen könne, beispielsweise auf Grund eines Defekts oder einer Verschmutzung. In diesem Fall komme es zur Wärmeentwicklung, was zu thermischen Schäden oder sogar einem Brand führen könne, Absatz [0184]. Dieses Problem wird durch die dünnen elektrisch und thermisch leitenden Verbindungen zwischen benachbarten, überlappenden Silizium-Solarzellen gelöst, da die Wärme über diese leicht transportiert werden kann, Absatz [0185]. Dieser Vorteil kommt bereits in der Merkmalsgruppe 1.3 zum Ausdruck, die die Anordnung der Solarzellen und die leitende Verbindung zwischen den überlappenden Kanten beschreibt. Die verborgenen Abgriffkontaktflächen oder Abgriffverbindungen tragen zu der Lösung dieses spezifischen Problems hingegen nichts bei. -
2.
Nach Merkmal 1.7 muss jedes Superzellensegment mit einer Überbrückungsdiode verbunden sein, die wiederum durch Bus-Verbindungen verbunden sind. Diese Bus-Verbindungen müssen sich hinter den Superzellen befinden. Während die Überbrückungsdioden und die Bus-Verbindungen der Herstellung der erforderlichen elektrischen Verbindung dienen, betrifft die Anordnung „hinter den Superzellen“ wiederum die räumlich-körperliche Ausgestaltung. Ob sich die erforderliche Anordnung „hinter den Superzellen“ zusätzlich auch auf die Überbrückungsdioden bezieht, kann dahinstehen. Denn in Bezug auf diese stellt das Merkmal 1.8 klar, dass sie auf der Rückseite angeordnet sein müssen. - Eine Anordnung der Busverbindungen hinter den Superzellen erfordert, dass diese von den Superzellen verdeckt werden und nicht sichtbar sind. Dies sieht der Wortlaut des Klagepatents zwar nicht mit einem gesondert genannten „hidden“ vor, wie dies in Bezug auf die Abgriffverbindungen der Fall ist, ergibt sich aber aus der mit dem Merkmal 1.7 verbundenen Funktion. Absatz [0348] gibt insofern den Zweck, der mit der Anordnung von Kontaktflächen und Leitungen hinter den Solarzellen verfolgt wird, allgemein für die in den nachfolgenden Absätzen dargestellten Ausführungsformen – darunter auch die erfindungsgemäßen Figuren 42A und 42B – wieder. Indem die Verbindungen auf der rückseitigen Überfläche der Solarzellen angeordnet sind und auch andere Leitungen – darunter die Busverbindungen gemäß Merkmal 1.7 – im Solarmodulkreis hinter den Solarzellen verlegt werden, sind die verschiedenen Leitungen nicht sichtbar, Abs. [0348]. Es geht der Lehre des Klagepatents mit dem Merkmal 1.7 also darum, dass die Busverbindungen nicht sichtbar sind. Wie auch zu Merkmal 1.6 ausgeführt, soll das Modul ein insgesamt schwarzes Erscheinungsbild aufweisen, vgl. Abs. [0348]. Genau eine solche Anordnung der Busverbindungen hinter den Solarzellen zeigt die erfindungsgemäße Figur 42A; dies wird in der zugehörigen Beschreibung ausdrücklich so benannt („bus connections 1500A-1500C, which are located behind the super cells“, Abs. [0348]). Die Busverbindungen sind infolgedessen nicht sichtbar. Hingegen sind die Busverbindungen in der Figur 40 gerade nicht hinter den Superzellen, sondern dazwischen angeordnet, mithin sichtbar; dementsprechend ist die Figur 40 auch nicht erfindungsgemäß, Abs. [0106].
- Damit ein möglichst schwarzes Erscheinungsbild geschaffen wird, ist es jedoch erforderlich, dass die Busverbindungen nicht beliebig in der Ebene hinter den Solarzellen platziert werden, sondern so, dass sie durch die Solarzellen verdeckt werden. Nach alledem reicht es für die Anordnung hinter den Superzellen nicht aus, wenn sich die Busverbindungen zwischen den Superzellen befinden, selbst wenn dies in der Ebene hinter den Solarzellen geschehen sollte. Denn aus der Frontalansicht heraus macht es für die Sichtbarkeit keinen Unterschied, ob sich die Busverbindungen unmittelbar in der Ebene der Solarzellen zwischen diesen befinden oder in der Ebene dahinter, aber noch immer zwischen den Solarzellen angeordnet sind.
- Die Beschreibung bestätigt diese Auslegung, indem sie bei der Anordnung der Busverbindungen unterscheidet zwischen einer Anordnung in einer Ebene mit den Superzellen rund um den Umfang des Solarmoduls oder in Lücken zwischen Superzellen oder hinter den Superzellen, siehe Absatz [0228]. Verschiedene Möglichkeiten der Positionierung werden zudem in Absatz [0349] angesprochen, in welchem es heißt, dass die Überbrückungsdioden direkt hinter den Superzellen oder zwischen den Superzellen angeordnet sein könnten. Gleiches wird noch einmal in Absatz [0356] beschrieben. Demzufolge wird der Positionierung zwischen den Solarzellen eine solche unmittelbar dahinter gegenübergestellt, also in einer Art und Weise, in welcher die Busverbindungen von den Solarzellen verdeckt werden. Genau eine solche Anordnung zeigt auch die Figur 42B, in der die Bus-Verbindungen in Relation zu den Spalten seitlich versetzt abgebildet sind.
- In dieses Verständnis fügt sich auch der Verweis der Beklagten auf die Erteilungsakte. Zwar bestehen Bedenken, ob die Erteilungsakte überhaupt zur Auslegung herangezogen werden darf (OLG Düsseldorf, Urt. v. 7.11.2013 – I-2 U 29/12, Rz. 3.6, in GRUR-RR, 2014, 185; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Auflage 2024, Kap A. Rn. 114). Bekundungen des Prüfers im Erteilungsverfahren stellen jedoch ein Indiz für das fachmännische Verständnis von der patentierten Lehre dar (BGH, GRUR 1998, 895 – Regenbecken). Gleiches gilt, wenn sich der Anmelder im Rahmen des Prüfungsverfahrens selbst zum Inhalt eines Merkmals oder Begriffs geäußert hat (BGH, NJW 1997, 3377, 3380 – Weichvorrichtung II). Auch im vorliegenden Fall steht die Eingabe der Klägerin im Rahmen des Erteilungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt vom 17. Februar 2022 (Anlage HE4) nicht nur mit der Beschreibung und den Figuren im Einklang, sondern stützt auch die hiesige Auslegung. In ihrer Eingabe wies die Klägerin darauf hin, dass die Figur 40 sich von der Figur 42A durch die physikalische Anordnung der Leiter unterscheide. Diese seien im Fall der – inzwischen nicht mehr erfindungsgemäßen Figur 40 – entlang einer Mittellinie angeordnet und im Fall der – patentgemäßen Figur 42A – hinter den Superzellen. Dies bestätigt, dass eine Positionierung der Busverbindungen hinter den Superzellen erfindungsgemäß ist, eine solche zwischen den Superzellen hingegen nicht.
-
3.
Das Merkmal 1.8 fordert schließlich die Anordnung der Überbrückungsdioden auf der Rückseite des Moduls innerhalb eines Anschlusskastens. Da die Busverbindungen unmittelbar rückseitig angeordnet sind und die Überbrückungsdioden mit diesen verbunden sind, folgt daraus, dass auch die in den Anschlusskästen befindlichen Überbrückungsdioden in der Ebene hinter den Solarzellen sein müssen und dabei nicht zwischen den Solarzellen angeordnet sein dürfen. Insofern gilt das unter Ziffer 2. Angeführte. -
III.
Die Beklagte zu 2) ist bereits nicht passivlegitimiert, da die Klägerin nicht dargelegt hat, dass die Beklagte zu 2) den Tatbestand einer Patentverletzung entweder allein oder in Zusammenwirken mit der Beklagten zu 1) verwirklicht. - Die Beklagten haben vorgetragen, dass die Beklagte zu 2) als bloßes Repräsentationsbüro errichtet worden sei und weder Angebot noch Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch sie vorgenommen werde.
- Der Verweis der Klägerin auf den Jahresbericht reicht insofern nicht aus, um eine tatsächliche Angebots- oder Vertriebshandlung durch die Beklagte zu 2) darzulegen. Dies gilt insbesondere, da es sich gar nicht um den Jahresbericht der Beklagten zu 1), sondern den der C Co., Ltd. handelt und unklar ist, in welchem tatsächlichen Verhältnis diese überhaupt zu der Beklagten zu 2) steht. Auch der Verweis auf die im Handelsregister angegebenen Tätigkeiten der Beklagten zu 2) genügt nicht, um eine konkrete Verletzungshandlung nachzuweisen, da sich daraus nur allgemein der Geschäftsgegenstand der Beklagten zu 2) ergibt. Gleiches gilt für das „LinkedIn“-Profil des angeblichen Mitarbeiters der Beklagten zu 2), aus dem sich weder Angebot noch Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform unmittelbar ergeben.
-
IV.
Die angegriffene Ausführungsform macht von den Merkmalen 1.6, 1.6.1 sowie 1.7 und 1.8 keinen Gebrauch. - Es handelt sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein Solarmodul bestehend aus sechs parallel angeordneten Superzellen, die wiederum aus einer Vielzahl von Siliziumsolarzellen gebildet sind, Merkmale 1.1 bis 1.3.1. Die gegenüberliegenden Ränder benachbarter Solarzellen überlappen sich und sind leitend miteinander verbunden, Merkmale 1.3.2 und 1.3.3. Die Solarmodule weisen eine von der Sonne zu beleuchtende Vorderseite und eine von der Sonneneinstrahlung abgewandte Rückseite auf, Merkmal 1.4. Die in den Merkmalen 1.6 bis 1.8 beschriebenen elektrischen Verbindungen weist die angegriffene Ausführungsform ebenfalls auf, was zwischen den Parteien unstreitig ist.
-
1.
Jedoch sind die über den Spalt zwischen zwei Superzellen verlaufenden Abgriffverbindungen sichtbar, womit es an der Verwirklichung der Merkmale 1.6 und 1.6.1 fehlt. - Die Abgriffverbindungen sind auf der von der Klägerin in ihrer Klageschrift vom 7. Juni 2023 eingefügten Abbildung 1.6-1 (Bl. 20 dA) zu erkennen:
- Auch in der von der Beklagten erstellen Abbildung aus der Klageerwiderung vom 16. November 2023 (Bl. 134) sind die Abgriffverbindungen in Frontansicht zu erkennen:
- Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten ist der Spalt mit transparentem EVA-Leim gefüllt, der die Abgriffverbindung durchscheinen lässt. Es handelt sich damit weder um das in Absatz [0339] der Patentbeschreibung genannte Schwärzen durch eine schwarze Polymerschicht zu dem Zweck, die Zwischenverbindungen unsichtbar zu machen, noch um eine andere geeignete Maßnahme, um die Abgriffverbindungen im Bereich der Spalte zu verbergen.
-
2.
Es fehlt zudem an einer Verwirklichung des Merkmals 1.7, das eine Positionierung der Busverbindungen hinter den Superzellen erfordert; ebenso fehlt es an einer Verwirklichung des Merkmals 1.8, das zusätzlich eine Positionierung der Überbrückungsdioden auf der Rückseite des Moduls erfordert. - Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sowohl die Busverbindungen als auch die in einem Anschlusskasten befindlichen Überbrückungsdioden zwischen den Solarzellen angeordnet sind. Wenngleich dies in der Ebene hinter den Solarzellen geschieht, ist dies nach der hier vorgenommenen Auslegung nicht ausreichend für eine Verwirklichung der Merkmale 1.7 und 1.8, die eine Anordnung direkt hinter den Solarzellen erfordern.
-
B
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. - Der Streitwert wird gemäß § 51 Abs. 1 GKG auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.