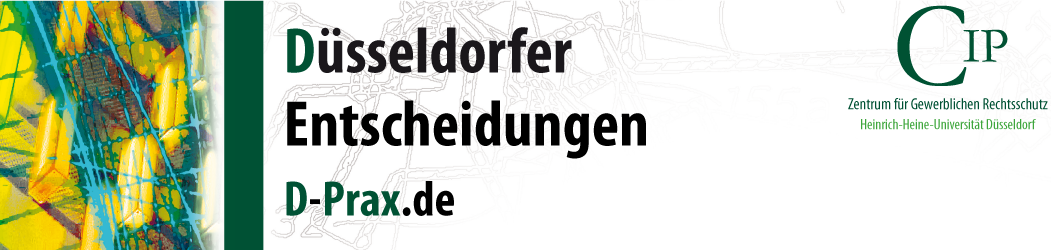Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3352
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 21. März 2024, Az. 4a O 28/23
- I.
Die Klage wird abgewiesen. - II.
Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt, - 1.
es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, letztere zu vollziehen an den jeweiligen Geschäftsführern, zu unterlassen, - in Bezug auf die Beklagte und/oder deren Abnehmer, insbesondere, aber nicht ausschließlich die B GmbH und die C GmbH,
gegenüber dem Betreiber der Verkaufsplattform D zu behaupten, die in der Bundesrepublik Deutschland verfügbaren Produkte mit den nachfolgend aufgeführten E verletzten die Rechte der Klägerin aus dem deutschen Teil des europäischen Patents mit der Nummer EP 2 947 XXA B1:
F
G
H
I
J
K
L
M
P
N
O
Q
R
S
Modell „T“
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ - 2.
die unter Ziffer II.1. genannte Produkte betreffenden Schutzrechtsverletzungsanzeigen (Complaints) gegenüber dem Betreiber der Verkaufsplattform D unverzüglich zurückzunehmen, und zwar dergestalt, dass sie die jeweiligen Schutzrechtsverletzungsanzeigen (Complaints) widerruft und mitteilt, dass sie keine solchen Einwände gegen die Wiederaufnahme des Verkaufs dieser Produkte hat, soweit die Produkte mit folgenden E betroffen sind
J
L
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AF
AI - und / oder
- ein Bestätigungsschreiben zur Verfügung zu stellen, dass die unter den genannten E benannten Produkte wieder zum Verkauf freigegeben werden können.
- III.
Auf die Widerklage wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer II.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. - IV.
Auf die Widerklage wird die Klägerin verurteilt, an die Beklagte EUR 4.613,64 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.12.2023 zu zahlen. - V.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. - VI.
Das Urteil ist bezüglich des Tenors zu II.1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000,00 EUR, bezüglich des Tenors zu II.2. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,00 EUR und bezüglich des Tenors zu IV. und V. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. - Tatbestand
- Die Klägerin und Widerbeklagte (im Folgenden bezeichnet als Klägerin) ist Inhaberin des europäischen Patents EP 2 947 XXA B1 (Anlage HE01, deutsche Übersetzung in Anlage HE02, im Folgenden: Klagepatent). Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent wurde am 22.05.2015 unter Inanspruchnahme zweier Prioritäten taiwanesischer Anmeldungen vom 23.05.2014 und vom 03.02.2015 angemeldet. Die Anmeldung wurde am 25.11.2015 offengelegt, der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 01.08.2018 veröffentlicht. Das Klagepatent steht unter anderem in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.
- Unter dem 14.09.2023 reichte die hiesige Beklagte und Widerklägerin (im Folgenden bezeichnet als Beklagte) Nichtigkeitsklage (Anlage KAP1) gegen den deutschen Teil des Klagepatents beim Bundespatentgericht ein. Nachdem es Uneinigkeit darüber gab, ob die Nichtigkeitsklage der hiesigen Klägerin wirksam zugestellt worden sei, erklärte das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 16.01.2024 die Zustellung für wirksam. Mit Schriftsatz vom 12.02.2024 (Anlage HE24) erwiderte die Klägerin auf die Nichtigkeitsklage, woraufhin das Bundespatentgericht unter dem 14.02.2024 einen qualifizierten Hinweis erteilte. Bislang ist noch nicht über die Nichtigkeitsklage entschieden.
- Das Klagepatent betrifft nach seinem Absatz [0002] (Absatzangaben ohne nähere Bezeichnung sind solche des Klagepatents) eine lichtemittierende Vorrichtung, einen Träger-Anschlussrahmen und eine aus dem Träger-Anschlussrahmen hergestellte lichtemittierende Vorrichtung, insbesondere einen Träger-Anschlussrahmen zur Aufnahme eines Leuchtdioden(LED)-Chips und eine aus dem Anschlussrahmen hergestellte lichtemittierende Vorrichtung.
- Anspruch 1 des Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung:
- „Lichtemittierende Einrichtung, die Folgendes umfasst: einen Träger (110); einen Leuchtdioden-Chip, LED-Chip, der in dem Träger getragen wird; und eine Einkapselung, die den LED-Chip abdeckt, wobei der Träger Folgendes umfasst:
mindestens einen Elektrodenabschnitt (112), wobei der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte mindestens einen Elektrodenabschnittsquerschnitt (112A) besitzt; und
ein Gehäuse (111), das einen Gehäusequerschnitt (111A) besitzt, wobei das Gehäuse mindestens teilweise den mindestens einen Elektrodenabschnitt abdeckt; wobei
der Gehäusequerschnitt (111A) und der Elektrodenabschnittsquerschnitt (112A) nicht höhengleich sind und
der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte ferner einen zentralen Bereich (112A1) und zwei Kantenbereiche (112A2) aufweist, wobei sich der Elektrodenabschnittsquerschnitt auf mindestens einem der beiden Kantenbereiche befindet, der zentrale Bereich und die beiden Kantenbereiche von dem Gehäusequerschnitt (111A) vorstehen und der zentrale Bereich (112A1) von den beiden Kantenbereichen (112A2) vorsteht.“ - Wegen des Wortlauts der lediglich im Rahmen von „insbesondere“-Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 10 wird auf die Klagepatentschrift (Anlage HE01) Bezug genommen.
- Zudem ist die Klägerin Inhaberin des am 22.05.2015 angemeldeten Gebrauchsmusters DE 20 2015 009 XXD U1 (im Folgenden: Klagegebrauchsmuster, Anlage HE07), das aus der Anmeldung des Klagepatents abgezweigt ist und am 30.06.2017 eingetragen wurde. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10.08.2017.
- Die Beklagte bietet an und vertreibt unter anderem über das Internet Leuchtmittel in Deutschland. Jedenfalls bis zum 02.12.2019 bot sie das LED-Leuchtmittel „AK“, Typ AL, 350mA (im Folgenden bezeichnet als angegriffene Ausführungsform 1), an und vertrieb es u.a. an (Elektro-)Fachhändler. Am 12.04.2023 erwarb die Klägerin über den D der in AN ansässigen AM GmbH ein Muster der angegriffenen Ausführungsform 1 (Rechnung vorgelegt als Anlage HE06), das sie in der Folge untersuchte. Die angegriffene Ausführungsform 1 ist ausgestaltet, wie aus den nachfolgend eingeblendeten Fotografien ersichtlich, die der Klageschrift entnommen sind:
. - Die nachfolgenden, mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Fotografien entstammen ebenfalls der Klageschrift und zeigen die angegriffene Ausführungsform 1 nach Entfernung des Lampenschirms und weiterer Bauteile:
- Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 1 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen:
- Folgende weitere Leuchtmittel der Beklagten waren in Deutschland jedenfalls bis zu ihrer dortigen Sperrung über den D bei der B GmbH erhältlich. Die Klägerin hat Muster dieser Leuchtmittel erworben und untersucht. Die Leuchtmittel sind ausgestaltet, wie aus den jeweils eingeblendeten Abbildungen, die zum Teil mit Anmerkungen der Klägerin versehen sind, ersichtlich:
- O (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2):
- sowie nach Abnahme des Lampenschirms und weiterer Bauteile
- Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 2 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen:
- AP (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 3):
- sowie nach Abnahme des Lampenschirms und weiterer Bauteile
- Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 200- bis 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 3 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen:
- AQ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 4):
- sowie nach Abnahme der Abdeckung und weiterer Bauteile
- Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 200- bis 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 4 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen:
- AR (angegriffene Ausführungsform 5):
- sowie nach Abnahme des Lampenschirms und weiterer Bauteile
- Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 200- bis 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 5 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen:
- AS (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 6):
- sowie nach Abnahme des Lampenschirms und weiterer Bauteile
.
Die nachstehend eingeblendeten weiteren mit Anmerkungen der Klägerin versehenen Abbildungen einer 200- bis 300-fachen Vergrößerung der angegriffenen Ausführungsform 6 sind dem Schriftsatz der Klägerin vom 12.02.2024 entnommen: - Die Beklagte legt zu den angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 das aus Anlage KAP15 ersichtliche Datenblatt, zu der angegriffenen Ausführungsform 4 das aus Anlage KAP16 ersichtliche Datenblatt und zu der angegriffenen Ausführungsform 5 das aus Anlage KAP 19 ersichtliche Datenblatt vor.
- Wegen des Vertriebes dieser angegriffenen Ausführungsformen 2 bis 5 sowie weiterer Leuchtmittel über die Plattform D leitete die Klägerin im Hinblick auf insgesamt 30 Produkte der Beklagten sog. Complaint-Verfahren bei AT ein. Erläuterungen zu dem Complaint-Verfahren sind über die Internetseite von AT abrufbar und auf Seite 29 des Schriftsatzes vom 11.01.2024 (Bl. 245 GA) eingeblendet. Zur Einleitung dieser Verfahren nutzte die Klägerin das unter der URL https://www.AT.de/AU abrufbare Formular, auf dem das betroffene Schutzrecht und die betroffenen Produkte angegeben werden können. Die Klägerin gab als betroffenes Schutzrecht das Klagepatent an, als betroffene Produkte nannte sie – mit Ausnahme des Produktes „Modell „T““(im Folgenden: „Modell T“) – die E der aus dem Widerklageantrag ersichtlichen Produkte, die der Produktbezeichnung im Antrag jeweils in Fettdruck vorangestellt ist und den aus dem Tenor zu Ziffer II.1. ersichtlichen E entsprechen. Daraufhin sperrte AT die aus dem Widerklageantrag ersichtlichen Produkte, die über den D – mit Ausnahme des Produktes „Modell „T“, das von der C GmbH angeboten wurde – allesamt von der B GmbH angeboten wurden. Das Leuchtmittel der mit der ursprünglichen Klage allein angegriffenen Ausführungsform 1 war in keinem der Produkte verbaut. In sechs der seitens der Klägerin bezeichneten Produkte war gar kein Leuchtmittel verbaut; sie waren geeignet, unterschiedlichste Leuchtmittel aufzunehmen. In einem weiteren angegriffenen Produkt wurde ein sog. Filamentleuchtmittel, also ein Leuchtstab, verwendet. Die B GmbH informierte die Beklagte am 09.10.2023 über die Sperrung der Produkte, die C GmbH informierte die Beklagte am 19.10.2023 über die Sperrung des von ihr angebotenen Produktes. Nachdem die B GmbH auf die Produktsperre hin Kontakt mit der hiesigen Klägerin gesucht hatte, kam es zu einer Email-Korrespondenz mit den Prozessbevollmächtigten der Klägerin. In der Korrespondenz verwiesen die Prozessbevollmächtigten darauf, dass Hintergrund des Complaints der von der Klägerin gegen die Beklagte geführte Rechtsstreit wegen Verletzung des Klagepatents sei, im Zuge dessen die Klägerin ihre Prozessbevollmächtigten beauftragt habe, die patentverletzenden Produkte von AT entfernen zu lassen. Sie boten der B GmbH an, ihr Unterlagen für einen Einspruch gegen den Complaint zur Verfügung zu stellen, falls die B GmbH eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung hinsichtlich der von ihr angebotenen und von dem Complaint betroffenen Produkte der Beklagten abgeben würde. Wegen der weiteren Einzelheit des Email-Verkehrs wird auf die Anlagen KAP5 und KAP6 Bezug genommen.
- Mit anwaltlichem Schreiben vom 24.10.2023 (Anlage KAP7) forderte die Beklagte die Klägerin unter Fristsetzung bis zum 31.10.2023, 14:00 Uhr, auf, die Complaint-Verfahren zurückzunehmen und ihrerseits eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben. Das Schreiben wurde am 27.10.2023 sowohl der Klägerin in Taiwan als auch unter c/o-Adresse bei der AV GmbH ausgeliefert (Zustellungsbestätigungen in Anlagen KAP8 und KAP9), und per Email unter anderem an die Prozessbevollmächtigten der Klägerin übersandt. Die Klägerin verweigerte die Annahme der Abmahnung in Taiwan mit dem Argument, sie könne nicht zugeordnet werden, und veranlasste deren Rücksendung.
- Am 06.11.2023 reichte die Beklagte einen gegen die Klägerin gerichteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei dem Landgericht Düsseldorf ein und gab als Zustelladresse die Anschrift der AW GmbH an. Diese sandte die Unterlagen unter dem 16.11.2023 an das Gericht zurück und gab an, die Zustellung müsse bei dem Mutterkonzern in Taiwan (also der Klägerin) erfolgen; die Klägerin habe ihr die Weiterleitung der Dokumente nach Taiwan untersagt. Am 14.11.2023 widerrief die Klägerin den gegen die aus der Anlage HE08 ersichtlichen acht Produkte gerichteten Complaint gegenüber AT Deutschland. Insgesamt hat sie zwischenzeitlich den Complaint bezüglich der 17 auf Seiten 25 und 26 des Schriftsatzes vom 11.01.2024 (Bl. 241, 242 GA) aufgeführten Produkte zurückgenommen, wobei die Rücknahme hinsichtlich aller genannten Produkte – möglicherweise mit Ausnahme des Produktes „Modell T“ – auch umgesetzt ist.
- Die Klägerin ist der Auffassung, alle sechs angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Insbesondere weise der Elektrodenabschnitt aller angegriffenen Ausführungsformen klagepatentgemäße Kantenbereiche, die von dem Gehäusequerschnitt vorstünden, sowie einen klagepatentgemäßen Elektrodenabschnittsquerschnitt, der nicht höhengleich mit dem Gehäusequerschnitt sei und sich auf mindestens einem der beiden Kantenbereiche befinde, auf.
- Entgegen der Ansicht der Beklagten falle die in Figur 6 der Klagepatentschrift gezeigte Gestaltung, der die Ausgestaltung der Kantenbereiche und Elektrodenabschnittsquerschnitte der angegriffenen Ausführungsformen ähnlich sei, unter den Anspruch 1 des Klagepatents. Dies ergebe sich bereits aus Absatz [0018] des Klagepatents, nach dem Figur 6 eine Ausführungsform der Erfindung zeige. Auch in Absatz [0041] heiße es, dass Figur 6 ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zeige. Dass die Vorgabe, dass Gehäusequerschnitt und Elektrodenabschnittsquerschnitt nicht höhengleich seien, in der Beschreibung zu Figur 6 keine Erwähnung finde, stehe dem nicht entgegen. Denn auch in der Beschreibung zu Figur 7, die unstreitig eine Ausführungsform der klagepatentgemäßen Lehre zeige, werde die entsprechende Vorgabe nicht erwähnt. Da die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext eine Einheit bildeten, interpretiere der Fachmann diese Einheit als sinnvolles Ganzes derart, dass sich Widersprüche nicht ergäben. Daher sei kein Grund erkennbar, warum die in Figur 6 gezeigte Gestaltung nicht erfindungsgemäß sein solle; vielmehr zeige Figur 6, dass unterschiedliche Ausführungsformen Gegenstand der Lehre des Klagepatents seien. Die Klägerin ist weiter der Ansicht, insbesondere zeige die Figur 6 Kantenbereiche im Sinne der Lehre des Klagepatents, die den von der Klägerin blau umrandeten Bereichen in der nachfolgend eingeblendeten Figur 6 des Klagepatents entsprächen:
- .
Dafür sprächen auch die Unteransprüche 2 und 4, nach denen der Elektrodenabschnittsquerschnitt eine schräge Oberfläche (Unteranspruch 2) oder eine gekrümmte Oberfläche (Unteranspruch 4) aufweisen könne. Selbiges ergebe sich auch aus Figur 9. - Die Beklagte komme nur deshalb zur Nichtverletzung, weil sie die zwei Kantenbereiche falsch verorte. Konkret gehe es darum, ob der in der nachfolgend eingeblendeten, dem Schriftsatz vom 12.02.2024 entnommenen Abbildung von Figur 7 von der Klägerin rot eingekreiste Bereich dem Kantenbereich oder dem zentralen Bereich zuzurechnen sei:
- Richtigerweise gehöre dieser Bereich zum Kantenbereich, wofür auch die Gestaltung gemäß Figur 9 spreche, in der der Elektrodenabschnittsquerschnitt ein schräg verlaufender Bereich sei. Da dieser Bereich dem Kantenbereich und dem Elektrodenabschnittsquerschnitt zuzuordnen sei, wiesen alle angegriffenen Ausführungsformen einen Elektrodenabschnittsquerschnitt auf, der nicht höhengleich mit dem Gehäusequerschnitt sei. Denn diese Vorgabe des Anspruchs 1 des Klagepatents beziehe sich nicht auf die Relation zwischen Gehäusequerschnitt und Kantenbereich, sondern auf die Relation zwischen einem Teil des Kantenbereichs – dem Elektrodenabschnittsquerschnitt – und dem Gehäusequerschnitt. Auch sei die Anforderung erfüllt, dass der zentrale Bereich und die beiden Kantenbereiche von dem Gehäusequerschnitt vorstünden. Zur Veranschaulichung des Verständnisses der Klägerin wird nachfolgend eine von der Klägerin mit Anmerkungen versehene Abbildung der angegriffenen Ausführungsform 1, die dem Schriftsatz vom 11.01.2024 entnommen ist, eingeblendet:
- .
- Letztlich sei diese Auslegung aber nicht entscheidend, da – wie die Klägerin erstmals mit Schriftsatz vom 12.02.2024 behauptet – die nunmehr vorgelegten hochauflösenden Fotografien ergäben, dass bei allen sechs angegriffenen Ausführungsformen der Kantenbereich und damit jedenfalls auch die beiden Enden der Elektrodenabschnittsquerschnitte dem Gehäusequerschnitt vorstünden. Auf den Fotografien aller sechs angegriffenen Ausführungsformen sei ein solches Vorstehen gut zu erkennen, es sei eine deutliche Kante sichtbar. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zu den Lichtbildern erläutert, es dürfe so sein, dass sich durch den Hitzeeintrag beim Verlöten im Herstellungsprozess ein Teil des Gehäuses verflüssigt habe und nach unten gelaufen sei. Durch die hohe Auflösung und starke Vergrößerung könne auf den Lichtbildern auch eine glatte Oberfläche rau erscheinen. Ein Höhenunterschied zwischen Kantenbereich und Gehäusequerschnitt sei bezüglich der angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 6 auf den Lichtbildern zu erkennen.
- Die Klägerin ist der Ansicht, das Klagepatent sei schutzfähig, insbesondere auch gegenüber den jeweiligen Lehren der Entgegenhaltungen JP 2014-41XXE A (im Folgenden bezeichnet als D1, Anlage KAP 2a, deutsche Übersetzung in Anlage KAP 2b), CN 203386XXF U (im Folgenden bezeichnet als D2, Anlage KAP 3a, deutsche Übersetzung in Anlage KAP 3b) und CN 20 34 66XXG U (im Folgenden bezeichnet als D3, Anlage KAP 4a, deutsche Übersetzung in Anlage KAP 4b) neu.
- Auch durch eine Kombination der drei Entgegenhaltungen könne der Fachmann nicht zur beanspruchten Lehre gelangen.
- Zur Widerklage ist die Klägerin der Ansicht, der Streitwert sei überhöht, was sich auch aus einem Vergleich mit dem im Rahmen der Abmahnung seitens der Beklagten angegebenen Streitwert ergebe. Zudem meint sie, die Erhebung der Widerklage sei im Hinblick darauf, dass die Beklagte zuvor den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt habe und das dortige Verfahren noch nicht abgeschlossen sei, wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig. Das ergebe sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, nach der die Erhebung der Hauptsacheklage ohne besonderen Anlass (etwa drohende Verjährung) vor Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens rechtsmissbräuchlich sein könne. Die Beklagte habe ihr durch Erhebung der Widerklage nicht nur die Möglichkeit genommen, durch Abgabe einer Abschlusserklärung ein Hauptsacheverfahren und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden, sondern auch die rechtsstaatlich gebotene Zustellung der Antragsschrift in Landessprache an ihrem Sitz in Taiwan verhindert. Zudem ist sie der Ansicht, die Widerklage greife auch inhaltlich nicht durch. Die Einleitung eines Complaint-Verfahrens sei einer Berechtigungsanfrage vergleichbar; es handele sich nicht um eine Abnehmerabmahnung. Sie selbst wisse nicht, ob AT nach Einleitung der Complaint-Verfahren die Beklagte zur Stellungnahme aufgefordert habe; sie gehe aber davon aus, da die Beklagte dazu schweige, wie die Complaint-Verfahren weiter verlaufen seien. Aus der seitens der Beklagten zitierten Rechtsprechung ergebe sich auch keine Kenntnis der Klägerin von einer abweichenden Praxis von AT. Insoweit behauptet sie, sie sei davon ausgegangen, dass AT zunächst die Beklagte zur Stellungnahme auffordern würde. Sie habe lediglich gegenüber AT erklärt, dass ihrer Meinung nach ein bestimmtes Schutzrecht verletzt sei; wie AT damit weiter umgehe, habe außerhalb ihres Einflussbereichs gelegen. Sie habe auch nicht gewusst, welche Händler überhaupt betroffen gewesen seien. Sie habe nur die E des jeweiligen Produktes angeben können, Händler habe sie nicht benennen können. Ihr sei bei Abgabe der Mitteilung nicht bewusst gewesen, dass AT auf den Complaint hin nicht nur die Beklagte, sondern auch deren Abnehmer bzw. Third Party Seller kontaktieren würde. Sie ist der Auffassung, die Sperrung der Produkte finde zudem im Verhältnis zwischen AT und der Beklagten statt, nicht im Verhältnis zwischen der Klägerin und den Verkäufern, so dass es für die Klägerin sehr schwierig sei, eine Mitteilung über eine mögliche Schutzrechtverletzung aufzuheben oder zu widerrufen. Die Korrespondenz mit einzelnen Third Party Sellers über die Abgabe strafbewehrter Unterlassungserklärungen habe den Hintergrund, dass diese Third Party Seller mit der Bitte, die Mitteilungsverfahren gegen sie zurückzuziehen, an die Klägerin herangetreten seien. Als reines Entgegenkommen habe sie diesen angeboten, für den Fall der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung die Mitteilung (den Complaint) zurückzuziehen, um über konkrete Schutzrechtsverletzungen hinausgehende Schäden durch eine etwaige Sperrung von Accounts der Third Party Seller zu vermeiden. Schließlich bestünden die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche auch inhaltlich nicht, da die Produkte, hinsichtlich derer die Klägerin die Mitteilung an AT nicht ohnehin zwischenzeitlich zurückgenommen habe, entweder das Klagepatent oder das Klagegebrauchsmuster verletzten. Dass das Klagegebrauchsmuster nicht explizit in den Complaint-Verfahren genannt worden sei, schade nicht, da der Beklagten insoweit kein Anspruch auf Unterlassung einer entsprechenden Mitteilung an AT zustehen könne. Maßgeblich sei, ob das Herstellen, Anbieten und Inverkehrbringen der betroffenen Produkte an sich auf Grund eines Schutzrechtsverstoßes verboten sei; darauf, gegen welches Schutzrecht genau verstoßen werde, komme es nicht an. Anderenfalls würde der Beklagten ein an sich verbotenes Verhalten erlaubt. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch der Beklagten scheitere auch daran, dass keine wirksame vorgerichtliche Abmahnung der Beklagten vorliege. Dazu behauptet sie, eine etwaige Abmahnung sei ihr nicht zugestellt worden. Auch sei nicht erkennbar, ob die Sperrung überhaupt zu Umsatzeinbußen bei der Beklagten geführt habe, da von einer gewissen Lagerhaltung der Abnehmer der Beklagten auszugehen sei.
- Die Klägerin bestreitet mit Nichtwissen, dass sie Herstellerin des in der Leuchte mit der E L verbauten Leuchtmittels sei. Weder lasse sich dem seitens der Beklagten vorgelegten Datenblatt entnehmen, dass das dort beschriebene LED-Modul in der Leuchte verbaut sei, noch sei für die Klägerin anhand der vorliegenden Informationen überprüfbar, wer genau dieses Modul wo hergestellt habe, so dass sie nicht überprüfen könne, ob eine ihrer Lizenznehmerinnen Herstellerin der Leuchte sei und ob ihre Schutzrechte auch gerade für Deutschland bzw. die EU erschöpft seien. Es obliege der Beklagten, neben der genauen Herkunft der LED auch das bestimmungsgemäße Inverkehrbringen der LED in der EU mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers darzulegen und zu beweisen.
- Die Klägerin beantragt,
- I.
die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an einem ihrer Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen, - lichtemittierende Einrichtungen
- in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
- die Folgendes umfassen: einen Träger; einen Leuchtdioden-Chip, LED-Chip, der in dem Träger getragen wird; und eine Einkapselung, die den LED-Chip abdeckt, wobei der Träger Folgendes umfasst:
- mindestens einen Elektrodenabschnitt, wobei der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte mindestens einen Elektrodenabschnittsquerschnitt besitzt; und
ein Gehäuse, das einen Gehäusequerschnitt besitzt, wobei das Gehäuse mindestens teilweise einen Elektrodenabschnitt abdeckt; wobei
der Gehäusequerschnitt und der Elektrodenabschnittsquerschnitt nicht höhengleich sind und
der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte ferner einen zentralen Bereich und zwei Kantenbereiche aufweist, wobei sich der Elektrodenabschnittsquerschnitt auf mindestens einem der beiden Kantenbereiche befindet, der zentrale Bereich und die beiden Kantenbereiche von dem Gehäusequerschnitt vorstehen und der zentrale Bereich von den beiden Kantenbereichen vor steht.
[EP 2 947 XXA B1, Patentanspruch 1] - II.
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I bezeichneten, seit dem 01.09.2018 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. - III.
die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin in elektronisch lesbarer Form darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer I. bezeichneten Handlungen seit dem 01.09.2018 begangen hat, und zwar unter Angabe
(1) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,
(2) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
(3) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; - wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in elektronisch lesbarer Form vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen.
- IV.
die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin in elektronisch lesbarer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die unter Ziffer I. aufgeführten Handlungen seit dem 01.09.2018 begangen hat, und zwar unter Angabe
(1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
(2) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
(3) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
(4) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten sowie des erzielten Gewinns, - wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer bzw. bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.
- V.
die Beklagte zu verurteilen, die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre (der Beklagten) Kosten herauszugeben. - VI.
die Beklagte zu verurteilen, die unter Ziffer I bezeichneten, seit dem 01.09.2018 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen, wobei der Klägerin ein Muster der Rückrufschreiben sowie eine Liste der Adressaten mit Namen und postalischer Anschrift oder – nach Wahl der Beklagten – eine Kopie sämtlicher Rückrufschreiben zu überlassen sind. - Darüber hinaus beantragt sie die Festsetzung von Teilsicherheiten.
- Die Beklagte beantragt,
- die Klage abzuweisen,
- hilfsweise, das Verfahren gemäß § 148 Abs. 1 ZPO bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen den deutschen Teil des EP 2 947 XXA B1 gerichtete Nichtigkeitsklage auszusetzen.
- Mit Schriftsatz vom 06.12.2023, der Klägerin zugestellt am 08.12.2023, hat die Beklagte und Widerklägerin im Hinblick auf die Complaint-Verfahren und die damit verbundene Sperrung von insgesamt 31 ihrer Produkte auf dem D Widerklage gegen die Klägerin und Widerbeklagte erhoben.
- Widerklagend beantragt die Beklagte und Widerklägerin, nachdem sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt hat, dass sie den Beseitigungsantrag nur noch bezüglich der Produkte mit den im Tenor unter Ziffer II.2. genannten E geltend macht
- wie erkannt.
- Ferner beantragt die Beklagte die Festsetzung von Teilsicherheiten.
- Die Klägerin und Widerbeklagte beantragt,
- die Widerklage abzuweisen.
- Die Beklagte ist der Auffassung, die angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 6 machten von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Es fehle jeweils an einem Vorstehen der beiden Kantenbereiche von dem Gehäusequerschnitt und an einem klagepatentgemäßen Elektrodenabschnittsquerschnitt. Elektrodenabschnittsquerschnitt und Gehäusequerschnitt seien nicht „nicht höhengleich“ im Sinne des Klagepatents. Die Klägerin verorte den Elektrodenabschnittsquerschnitt und die Kantenbereiche in nicht klagepatentgemäßer Weise.
- Nach der Lehre des Klagepatents sei unter dem Elektrodenabschnitt die Elektrode selbst zu verstehen. Aus Absatz [0036] ergebe sich, dass der zentrale Bereich und die beiden Kantenbereiche zusammen den Flügelbereich des Elektrodenabschnitts bildeten. Dieser Flügelbereich rage insgesamt aus dem Gehäuse und damit über den Gehäusequerschnitt hinaus, wobei es sich bei dem Gehäusequerschnitt nicht um einen Querschnitt im mathematischen Sinne, sondern um die Stirnseite des Gehäuses handele. Dieses Verständnis des Gehäusequerschnitts ergebe sich aus Absatz [0008] des Klagepatents und werde durch die Figuren, in denen die zum Gehäusequerschnitt gehörende Bezugsziffer 111A ausnahmslos die Umrandung des Gehäuses bezeichne, bestätigt. Auch aus Absatz [0035] folge, dass es sich bei dem Gehäusequerschnitt um eine Oberfläche, also eine reale Fläche, handele. Nach der Lehre des Klagepatents sei der zentrale Bereich (des Elektrodenabschnitts) der gesamte Bereich, der am weitesten hinausrage; die Seiten, die sich zwar über das Gehäuse hinaus erstreckten, aber gerade nicht der weiter hinausragende, zentrale Bereich seien, bildeten die Kantenbereiche. Der klagepatentgemäße Kantenbereich sei ein eigener Bereich, der sich von dem zentralen Bereich optisch abgrenze. Die in Draufsicht schrägen Seiten des zentralen Bereichs seien nicht Teil der Kantenbereiche. Dafür spreche Absatz [0013], in dem es heiße, dass der zentrale Bereich über die Kantenbereiche hinausstehe. Zudem könne ein Verlauf, der einen geraden und einen schrägen Verlauf aufweise, kein Querschnitt sein. Zur Veranschaulichung wird nachfolgend eine mit Markierungen der Beklagten versehene Abbildung der Figur 7 des Klagepatents, die dem Schriftsatz vom 18.09.2023 entnommen ist, eingeblendet. Nach dem Verständnis der Beklagten findet sich der zentrale Bereich in der roten Umrandung, während die Kantenbereiche blau umrandet sind:
- Dieses Verständnis werde bestätigt durch die Ausgestaltungen gemäß der nachfolgend eingeblendeten Figuren 9, 10 und 11, die ausdrücklich nicht Teil des Gegenstandes des Klagepatents seien:
- Denn bei diesen Gestaltungen sei kein Kantenbereich vorgesehen, der von dem Gehäuse vorstehe und von dem wiederum ein zentraler Bereich noch weiter vorstehe. Selbst wenn die jeweiligen Kanten bzw. Ecken unter den Anspruchswortlaut fallen würden, erstreckten sie sich nicht über den Gehäusequerschnitt hinaus. Insbesondere wiesen gerade die Figuren 9 und 10 keine zwei Bereiche auf, die unterschiedlich weit aus dem Gehäuse herausragten. Auch dies spreche dafür, dass der Bereich mit dem schrägen Verlauf zum zentralen Bereich und nicht zum Kantenbereich gehöre. Aus den Unteransprüchen 2 und 4 ergebe sich kein anderes Verständnis. Denn der jeweilige Wortlaut sehe für den Elektrodenabschnittsquerschnitt (Unteranspruch 2) bzw. den Gehäusequerschnitt (Unteranspruch 4), bei denen es sich jeweils um die Stirnseiten der Kantenbereiche bzw. des Gehäuses handele, besondere Oberflächen vor, betreffe jedoch nicht die Anordnung des Elektrodenabschnittsquerschnitts bzw. Gehäusequerschnitts im Verhältnis zum Gehäuse.
- Auch unter einem Elektrodenabschnittsquerschnitt verstehe das Klagepatent keinen Querschnitt im mathematischen Sinne, sondern die Stirnseite eines Bereichs des Elektrodenabschnitts. Dafür sprächen die Absätze [0035] und [0037], aus denen jeweils folge, dass es sich bei dem Elektrodenabschnittsquerschnitt um eine reale Oberfläche und nicht die Oberfläche nach einem vertikalen Schnitt handele. Auch Absatz [0045] beschreibe den Elektrodenabschnittsquerschnitt der Figur 10 als konvex gekrümmte Oberfläche. Anspruchsgemäß stelle der Elektrodenabschnittsquerschnitt die Stirnfläche mindestens eines Kantenbereichs dar. Zur Veranschaulichung wird eine ebenfalls dem Schriftsatz vom 18.09.2023 entnommene, von der Beklagten mit Pfeilen versehene Abbildung der Figur 7 des Klagepatents, die nach dem Verständnis der Beklagten die Elektrodenabschnittsquerschnitte zeigen, eingeblendet:
- Die im Anspruch für den Elektrodenabschnittsquerschnitt genannte Bezugsziffer 112A sei falsch; die Ziffer 112A bezeichne tatsächlich nicht den Elektrodenabschnittsquerschnitt, sondern den gesamten herausstehenden Bereich des Elektrodenabschnitts, also den Flügelabschnitt. Der Elektrodenabschnittsquerschnitt könne auch nicht irgendwo auf dem Kantenbereich bzw. auf einem Teil davon verortet sein. Aus der Beschreibung ergebe sich, dass der Elektrodenabschnittsquerschnitt die gesamte Stirnseite des Kantenbereichs sei. Dieses Verständnis spiegele sich in Absätzen [0043] und [0044] wider, in denen von dem Elektrodenabschnittsquerschnitt der beiden Kantenbereiche die Rede sei. Noch deutlicher seien Absätze [0045] und [0046], in denen der Elektrodenabschnittsquerschnitt als Außenlinie der Kantenbereiche – nicht als Teil der Kontur – bezeichnet werde. Auch wenn die dort beschriebene Figur 10 nicht in den Schutzbereich der Erfindung falle, sei grundsätzlich davon auszugehen, dass den in der Klagepatentschrift verwendeten Begriffen das gleiche Verständnis zugrunde zu legen sei.
- Die Vorgabe „nicht höhengleich“ des Klagepatents bedeute, dass der Gehäusequerschnitt und der Elektrodenabschnittsquerschnitt, also die Stirnseiten beider Teile, nicht auf gleicher Höhe endeten, sondern sich ihre Außenkanten in lateraler Richtung unterschiedlich weit ausdehnten. Dieses Verständnis werde ausdrücklich in Absatz [0035] beschrieben. Sie behauptet, bei den angegriffenen Ausführungsformen endeten Gehäusequerschnitt und Elektrodenabschnittsquerschnitt auf gleicher Höhe; soweit sie zu den angegriffenen Ausführungsformen zugehörige Datenblätter vorgelegt hat, ergäbe sich eine entsprechende Ausgestaltung auch aus den Datenblättern.
- Die Beklagte ist weiter der Auffassung, im Hinblick auf das gegen das Klagepatent geführte Nichtigkeitsverfahren sei der Rechtsstreit hilfsweise auszusetzen. Das Klagepatent sei nicht rechtsbeständig. Insbesondere fehle ihm die Neuheit gegenüber den Entgegenhaltungen D1, D2 und D3.
- Zur Widerklage ist die Beklagte zunächst der Ansicht, diese sei zulässig, insbesondere nicht rechtsmissbräuchlich. Es gebe keinen Grundsatz, dass die Einleitung eines Hauptsacheverfahrens vor Beendigung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens einen Rechtsmissbrauch darstelle. Mit der Geltendmachung der Ansprüche im Wege der Widerklage verfolge sie keine sachfremden Ziele, sondern versuche, Verzögerungen zu verhindern. Eine solche Verzögerung versuche die Klägerin herbeizuführen, indem sie etwa der AW GmbH untersagt habe, den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung an die Klägerin weiterzuleiten. Da Klage und Widerklage das gleiche Schutzrecht beträfen, sei die Erhebung der Widerklage prozessökonomisch.
- Die Beklagte ist weiter der Auffassung, das Vorgehen der Klägerin durch Complaint-Verfahren stelle eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung und damit einen Eingriff in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG dar. Mit der Einleitung der Complaint-Verfahren habe die Klägerin die Rechtsdurchsetzung nicht nur angedroht, sondern ihre vermeintlichen Rechte bereits durchgesetzt. Die Beklagte behauptet, es sei hinlänglich bekannt, dass AT auf solche Schutzrechtsverletzungsanzeigen rigoros mit der Sperrung der Produkte reagiere, um nicht selbst in Anspruch genommen zu werden. Die Klägerin sei nicht davon ausgegangen, dass der Beklagten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden würde. Es sei zudem schlicht falsch, dass sie oder ihre Abnehmer zu einer Stellungnahme im Complaint-Verfahren aufgefordert worden seien.
- Die Beklagte ist der Ansicht, keines der in den Complaint-Verfahren benannten Produkte verletze die Lehre des Klagepatents. Auf eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters komme es insoweit nicht an, da dieses – unstreitig – nicht Gegenstand der Complaint-Verfahren und auch nicht Streitgegenstand der Widerklage sei. Sie behauptet, das in dem Modell mit der E L verbaute Leuchtmittel stamme zudem von der Klägerin. Die Beklagte ist weiter der Auffassung, die Einleitung der Complaint-Verfahren sei eine Abnehmerverwarnung, die grundsätzlich nur dann zulässig sei, wenn eine Herstellerverwarnung erfolglos geblieben oder ausnahmsweise aufgrund besonderer Umstände unzumutbar sei. Da keines der von den Complaint-Verfahren betroffenen Produkte zum Zeitpunkt der Einleitung der Verfahren Gegenstand der vorliegenden Klage gewesen sei, sei sie, die Beklagte, insoweit nicht abgemahnt gewesen. Der Umstand, dass mehrere der von den Complaint-Verfahren betroffenen Produkte gar keine LED beinhalteten, zeuge von fehlender Recherche der Klägerin und grenze an Schikane. Die Klägerin sei ohne weiteres passivlegitimiert, da sie die als unberechtigte Schutzrechtsanzeigen einzuordnenden Complaints ausgesprochen habe.
- Der für die Widerklage angesetzte Streitwert sei angemessen, da es sich bei der Widerklage zum Einen um ein Hauptsacheverfahren handele, das eine Vielzahl von gesperrten Produkten betreffe, und zum Anderen auch ein Schadensersatzanspruch für die Kosten der außergerichtlichen Rechtsverfolgung sowie Schadensersatzfeststellung begehrt werde.
- Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20.02.2024 ergänzend Bezug genommen.
- Entscheidungsgründe
- Die Klage hat keinen Erfolg. Die Widerklage hat Erfolg.
- A.
Die zulässige Klage hat keinen Erfolg. Sie ist unbegründet. - I.
Das Klagepatent betrifft eine lichtemittierende Vorrichtung. - Aus dem Stand der Technik führt das Klagepatent in seinem Absatz [0003] zunächst Leuchtdioden (LEDs) an und verweist auf deren Vorteile einer langen Lebensdauer, eines kleinen Volumens, einer hohen Stoßfestigkeit, einer geringen Wärmeerzeugung und eines geringen Stromverbrauchs, weshalb sie verbreitet als Anzeigeelemente oder Lichtquellen in Haushaltsgeräten und verschiedenen anderen Geräten verwendet würden. Es sei sogar möglich, dass die LEDs in Zukunft zu gängigen Belichtungsquellen würden, die sowohl Stromspar- als auch eine Umweltschutzfunktion aufwiesen. In seinem Absatz [0004] führt das Klagepatent weiter aus, in den letzten Jahren seien von den Herstellern auf diesem Gebiet Träger-Anschlussrahmen vom Zerteilungstyp entwickelt worden. Insbesondere werde ein Kunststoffkörper an ein Metallblechmaterial geformt, dann würden ein Chipbond-Prozess, ein Drahtbond-Prozess und ein Ummantelungsprozess durchgeführt, und dann würden das Metallblechmaterial und der Kunststoffkörper gleichzeitig zerteilt, um einzelne lichtemittierende Vorrichtungen zu bilden, die voneinander getrennt seien.
- Hieran kritisiert das Klagepatent in seinem Absatz [0004], dass während des Zerteilungsprozesses meist eine große Menge an Kunststoff- und Metallstaub erzeugt würde, die die Oberflächen der Endprodukte erheblich verschmutze und daher die Zuverlässigkeit der Produkte verschlechtere. Zudem gestatte der aus dem Stand der Technik bekannte Prozess keine Einschaltprüfung vor dem Ummantelungsprozess, weshalb Messungen erst vorgenommen werden könnten, nachdem die Produkte vereinzelt worden seien. Die vereinzelten Endprodukte seien jedoch zufällig angeordnet, so dass maschinelle Messungen erst nach einer Oberflächenausrichtung und einer Richtungskorrektur vorgenommen werden könnten. Dies erfordere die Verwendung zusätzlicher Geräte und sei zeitaufwändig.
- Ohne ausdrücklich eine Aufgabe zu formulieren, erklärt das Klagepatent in Absatz [0005], durch die klagepatentgemäßen Vorteile eines näher beschriebenen Träger-Anschlussrahmens könnten die Produktionsgeschwindigkeit und der Produktionsertrag der lichtemittierenden Vorrichtung erheblich verbessert werden.
- Vor diesem Hintergrund schlägt das Klagepatent in seinem Anspruch 1 eine lichtemittierende Einrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
- 1. Lichtemittierende Einrichtung, die Folgendes umfasst:
2. einen Träger (110);
3. einen Leuchtdioden-Chip, LED-Chip,
1.1 LED-Chip, der in dem Träger getragen wird; und
4. eine Einkapselung, die den LED-Chip abdeckt,
5. der Träger umfasst Folgendes:
1.1 mindestens einen Elektrodenabschnitt (112),
1.1.1 wobei der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte mindestens einen Elektrodenabschnittsquerschnitt (112A) besitzt; und
1.2 ein Gehäuse (111),
1.2.1 das einen Gehäusequerschnitt (111A) besitzt,
1.2.2 das Gehäuse deckt mindestens teilweise den mindestens einen Elektrodenabschnitt ab;
6. der Gehäusequerschnitt (111A) und der Elektrodenabschnittsquerschnitt sind (112A) nicht höhengleich und
7. der eine oder jeder der mehreren Elektrodenabschnitte weist auf
1.1 einen zentralen Bereich (112A1) und
1.2 zwei Kantenbereiche (112A2)
8. der Elektrodenabschnittsquerschnitt befindet sich auf mindestens einem der beiden Kantenbereiche;
9. der zentrale Bereich und die beiden Kantenbereiche stehen von dem Gehäusequerschnitt (111A) vor;
10. der zentrale Bereich (112A1) steht von den beiden Kantenbereichen (112A2) vor. - II.
Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Merkmal 6 des Klagepatents keinen Gebrauch. Nach Merkmal 6 sind der Gehäusequerschnitt und der Elektrodenabschnittsquerschnitt nicht höhengleich. - 1.
Zur Prüfung dieses Merkmals ist zunächst die klagepatentgemäße Lage des Gehäusequerschnitts und des Elektrodenabschnittsquerschnitts zu verorten. - a.
Nach der Lehre des Klagepatents wird der Gehäusequerschnitt durch die in die gleiche Richtung wie der Flügelabschnitt zeigende Stirnseite des seitlich an den Elektrodenabschnitt angrenzenden Gehäuses gebildet. Insoweit besteht auch zwischen den Parteien Einigkeit. - b.
Das Klagepatent versteht unter dem Elektrodenabschnittsquerschnitt zunächst die Stirnseite eines Bereichs des Elektrodenabschnitts, was zwischen den Parteien zu Recht außer Streit steht. Ebenfalls unstreitig ist, dass der Elektrodenabschnittsquerschnitt sich – entsprechend Merkmal 8 – auf (mindestens) einem (in Merkmalsgruppe 7 beschriebenen) Kantenbereich (des Elektrodenabschnitts) befindet. - Die Kantenbereiche umfassen unstreitig jedenfalls die in der nachfolgend eingeblendeten Figur 7 seitens der Kammer rot eingefassten Bereiche.
- Unabhängig davon, ob die Kantenbereiche jeweils auch die in der nachstehend eingeblendeten Abbildung der Figur 7 seitens der Kammer rot umrandeten Bereiche umfassen,
- liegt der Elektrodenabschnittsquerschnitt jedenfalls in dem Bereich, in dem der Kantenbereich seitlich an den Gehäusequerschnitt angrenzt.
- Dies folgt aus den Angaben in Absatz [0036], die in Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel gemäß der nachfolgend eingeblendeten Figur 5 stehen.
- Zunächst heißt es dort, dass die Elektrodenabschnitt-Querschnittfläche nicht auf einer Ebene mit der Gehäusequerschnittfläche ist. Die Kammer verkennt nicht, dass diese Passage lediglich auf ein Ausführungsbeispiel bezogen ist, das nicht geeignet ist, einen weiter gefassten Anspruch zu beschränken. Allerdings formuliert die Klagepatentschrift in der Folge, dass der Elektrodenabschnitt in diesem Fall einen zusätzlichen seitlichen Bereich aufweist, der vorteilhaft ist, weil er die Bindekraft mit dem Lötmaterial erhöhen kann, wodurch die Bindekraft der Komponenten der lichtemittierenden Vorrichtung nach dem anschließenden Bonding-Prozess der Komponenten erhöht wird. In Absatz [0037] führt die Klagepatentschrift als weiteren Vorteil an, dass das Lötmaterial während des Bonding-Prozesses der Komponenten entlang der Seitenfläche des Flügelabschnitts [des Elektrodenabschnitts, Ergänzung durch die Kammer] hochsteigen und die Seitenfläche bedecken kann, und in diesem Fall wenigstens ein Teil des nicht von der Antioxidationsschicht bedeckten Querschnitts von dem Lötmaterial bedeckt werden kann, wodurch die Oxidation des Querschnitts verringert wird. Klagepatentgemäß werden diese Vorteile gerade dadurch erreicht, dass der Flügelabschnitt eine (weitere) Seitenfläche ausbildet. Diese zusätzliche Seitenfläche bildet er gerade dadurch aus, dass die Elektrodenabschnitt-Querschnittfläche nicht auf einer Ebene mit dem Gehäusequerschnitt liegt.
- Bestätigt wird dieses Verständnis durch die Angaben des Klagepatents in Absatz [0035], nach denen die Elektrodenabschnitt-Querschnittfläche und die Gehäusequerschnittfläche miteinander auf einer Ebene sein (d.h. eine ebene Oberfläche bilden) können, was allerdings – wie auch das Bundespatentgericht in seinem Hinweis vom 14.02.2024 (Bl. 372 ff. GA) ausführt – nicht klagepatentgemäß ist. Aus Absatz [0035] ergibt sich ferner, dass die beiden Bauteile, wenn sie nicht miteinander auf einer Ebene sind, keine ebene Oberfläche bilden. Auch dies verdeutlicht, dass der Elektrodenabschnittsquerschnitt jedenfalls dort verortet sein muss, wo der Gehäusequerschnitt und der Kantenbereich aufeinandertreffen.
- Hinzu kommt, dass – soweit erkennbar – der Elektrodenabschnittsquerschnitt bei allen in der Klagepatentschrift dargestellten beispielhaften Gestaltungen unabhängig von seinem konkreten Verlauf (seitlich) unmittelbar an den Gehäusequerschnitt angrenzt.
- 2.
Dass Gehäusequerschnitt und Elektrodenabschnittsquerschnitt gemäß Merkmal 6 nicht höhengleich sind, bedeutet, dass diese Bauteile im Übergangsbereich nicht in einer Ebene liegen dürfen. - Denn nur dann können die in den Absätzen [0036] und [0037] geschilderten Vorteile der klagepatentgemäßen Ausgestaltung erreicht werden, die gerade voraussetzen, dass eine weitere Seitenfläche ausgebildet wird. Dieses Verständnis wird bestätigt durch die Angaben in Absatz [0036], nach denen der Vorteil der Gestaltung gemäß Figur 5 gegenüber der Ausgestaltung gemäß Figur 1 gerade durch die in Figur 5 gezeigte zusätzliche Seitenfläche erreicht wird. Die vorstehende Auslegung steht im Einklang mit den Ausführungen des Bundespatentgerichts im Hinweis vom 14.02.2024 (Bl. 372 ff. GA, dort S. 7). In Anwendung dieser Auslegung hat das Bundespatentgericht zudem erklärt, dass lediglich die Figuren 5 und 7 klagepatentgemäße Ausführungsbeispiele zeigen dürften (S. 5 des Hinweises, Bl. 376 GA).
- Dazu, in welcher Größenordnung der Höhenunterschied sich klagepatentgemäß bewegen soll, gibt die Klagepatentschrift einen Anhaltspunkt, indem sie zu den in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 7 ausgewiesenen Abständen D1 und D3 Werte benennt. In Absatz [0042] beziffert sie den Abstand D1 mit 0,1 mm und den Abstand D3 mit 0,075 mm. Angesichts dieser Angaben ist erkennbar, dass der Höhenunterschied zwischen Elektrodenabschnittsquerschnitt und Gehäusequerschnitt in dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 7 etwa 0,025 mm beträgt. Ein Höhenunterschied in dieser Größenordnung ist daher ausreichend. Dazu, ob auch ein deutlich geringerer Höhenunterschied klagepatentgemäß ist, verhält sich die Klagepatentschrift nicht. Die Funktion des Höhenunterschiedes, eine zusätzliche Seitenfläche zur Erhöhung der Bindekraft mit dem Lötmaterial auszubilden, bestätigt, dass ein deutlich geringerer Höhenunterschied nicht der Lehre des Klagepatents unterfällt, da der klagepatentgemäße Vorteil bei einer entsprechenden Ausgestaltung nicht erreicht würde.
- 3.
Auf Grundlage dieses Verständnisses verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen Merkmal 6 nicht, da ein klagepatentgemäßer Höhenunterschied zwischen dem Gehäusequerschnitt und dem (seitlich) an diesen angrenzenden Elektrodenabschnittsquerschnitt auf Grundlage des vorgetragenen Sach- und Streitstandes jeweils nicht feststellbar ist. - Die Klägerin hat – auch unter Berücksichtigung der mit Schriftsatz vom 12.02.2024 vorgelegten Fotografien – nicht hinreichend substantiiert vorgetragen, dass die angegriffenen Ausführungsformen in dem entsprechenden Bereich jeweils einen der Lehre des Klagepatents entsprechenden Höhenunterschied aufweisen würden. Die seitens der Klägerin mit Schriftsatz vom 12.02.2024 vorgelegten Fotografien belegen einen solchen Höhenunterschied nicht.
- Zu den angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 hat die Klägerin angegeben, bei den entsprechenden Aufnahmen handele es sich um eine 300-fache Vergrößerung, insgesamt hat sie erklärt, es handele sich bei allen Aufnahmen um 200- bis 300-fache Vergrößerungen. Sie hat aber nicht dazu vorgetragen, wie weit der jeweilige Elektrodenabschnittsquerschnitt tatsächlich gegenüber dem Gehäusequerschnitt vorstehen würde und ob und an welcher Stelle sie eine entsprechende Messung vorgenommen hätte. Ohne einen entsprechenden Vortrag sind die seitens der Klägerin vorgelegten Lichtbilder aber schon nicht ergiebig. Den zu den angegriffenen Ausführungsformen 1, 4, 5 und 6 gehörigen Lichtbildern ist zudem – angesichts der erheblichen Vergrößerung – bereits kein relevanter Höhenunterschied zu entnehmen. Hinzu kommt, dass die Beklagte zu den angegriffenen Ausführungsformen 2 bis 5 unter Vorlage von Datenblättern nachvollziehbar vorgetragen hat, dass ein im Rahmen der Produktion wiederholbar herbeigeführter und kontrollierter Höhenunterschied nicht gegeben sei. Auch vor diesem Hintergrund überzeugt der Vortrag der Klägerin nicht. Aus den zu den angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 vorgelegten Lichtbildern ergeben sich etwa durchaus Unterschiede zwischen den Ausführungsformen, obwohl beide denselben Spezifikationen des Datenblatts gemäß Anlage KAP15 unterliegen. Aus der dortigen Zeichnung auf Seite 35 ergibt sich zudem, dass in dem relevanten Bereich Toleranzen von +/- 0,10 mm zulässig sind. Hinzu kommt, dass die Klägerin in der mündlichen Verhandlung selbst vorgetragen hat, durch den Hitzeeintrag beim Verlöten im Herstellungsprozess dürfte sich ein Teil des Gehäuses der angegriffenen Ausführungsformen verflüssigt haben und nach unten gelaufen sein; zudem ließen die hohe Auflösung und starke Vergrößerung eine glatte Oberfläche rau erscheinen. Auch unter Berücksichtigung dieses Vortrages ist nicht erkennbar, dass die angegriffenen Ausführungsformen einen für die Verwirklichung des Merkmals 6 ausreichenden Höhenunterschied zwischen Elektrodenabschnittsquerschnitt und Gehäusequerschnitt aufweisen würden. Vielmehr spricht der Vortrag zur Verflüssigung eines Teils des Gehäuses beim Löten dagegen, dass ein solcher Höhenunterschied bei den angegriffenen Ausführungsformen vorhanden ist, da er nicht eine (gezielte) Herbeiführung eines Höhenunterschiedes belegt, sondern vielmehr verdeutlicht, dass die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Größenordnung überhaupt ein Höhenunterschied vorliegt, dem Zufall unterliegt bzw. eine Herstellungstoleranz darstellt. Der Vortrag, dass in den zu den angegriffenen Ausführungsformen vorgelegten Lichtbildern wegen der hohen Auflösung und starken Vergrößerung glatte Oberflächen rau wirken würden, steht im Einklang damit, dass die Gehäusequerschnitte auf den Lichtbildern im Übergangsbereich zum Teil ausgefranst wirken. Wenn diese Wirkung auf der starken Vergrößerung und hohen Auflösung beruht, lässt sich den Lichtbildern dort auch kein relevanter Höhenunterschied entnehmen.
- Dem seitens der Klägerin zum Vorhandensein eines Höhenunterschiedes angetretenen Beweis auf Einholung eines Sachverständigengutachtens war nicht nachzugehen. Es handelt sich um einen unzulässigen Ausforschungsbeweis. Denn die Klägerin hat zu keiner der sechs angegriffenen Ausführungsformen vorgetragen, welchen konkreten Höhenunterschied die jeweilige angegriffene Ausführungsform an welcher konkreten Stelle aufweisen würde. Ohne einen solchen Vortrag würde ein etwaiges Sachverständigengutachten aber nicht dazu dienen, einen jeweils konkret von der Klägerin vorgetragenen Höhenunterschied zu beweisen, sondern dazu, einen etwaigen Höhenunterschied überhaupt erst zu ermitteln.
-
III.
Da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machen, stehen der Klägerin die gegen die Beklagte geltend gemachten Ansprüche nicht zu. - B.
Die Widerklage hat Erfolg. Sie ist zulässig und begründet. - I.
Die Widerklage ist zulässig. - 1.
Die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen der Widerklage gemäß § 33 ZPO sind gegeben. Insbesondere ist der erforderliche Sachzusammenhang (Konnexität) des mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs mit dem mit der Klage geltend gemachten Anspruch gegeben. Denn die Klage betrifft Ansprüche wegen (vermeintlicher) Verletzung des Klagepatents, während die Widerklage sich gegen bei AT geführte Complaint-Verfahren richtet, die von der Klägerin des Hauptsacheverfahrens gegen Produkte der Beklagten des Hauptsacheverfahrens gerade wegen einer (vermeintlichen) Verletzung des Klagepatents eingeleitet wurden. - 2.
Die Erhebung der Widerklage ist auch nicht rechtsmissbräuchlich. - Zunächst betrifft die insoweit von der Klägerin angeführte Vorschrift des § 8c Abs. 1 UWG lediglich gesetzliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche aus dem UWG, eine analoge Anwendung auf den allgemeinen deliktsrechtlichen Unterlassungsanspruch aus §§ 823, 1004 BGB scheidet aus (Feddersen, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 8c Rn. 9). Ob die Geltendmachung des allgemeinen deliktsrechtlichen Unterlassungsanspruchs rechtsmissbräuchlich ist, ist nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) zu beurteilen. Dabei können auch Umstände, die im Rahmen von § 8c Abs. 1 UWG einen Rechtsmissbrauch begründen, herangezogen werden. Im Übrigen sind aber, weil und soweit die Besonderheiten des wettbewerbsrechtlichen Rechtsschutzes nicht vorliegen, höhere Anforderungen an den Rechtsmissbrauch im Sinne des § 242 BGB zu stellen (Feddersen, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 8c Rn. 9).
- Vorliegend ist die Erhebung der Widerklage bereits nicht nach § 8c Abs. 1 UWG, und damit auch nicht nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben, rechtsmissbräuchlich.
- Zwar trifft es im Ansatz zu, dass die Erhebung der Widerklage gemäß § 8c Abs. 1 UWG rechtsmissbräuchlich sein kann, wenn der Anspruchsberechtigte neben dem Verfügungs- auch ein Hauptsacheverfahren einleitet, ohne dass hierfür eine sachliche Notwendigkeit besteht und ohne abzuwarten, ob eine inhaltsgleiche Verfügung ergeht und als endgültige Regelung anerkannt wird (BGH GRUR 2000, 1089 (1093) – Missbräuchliche Mehrfachverfolgung; Feddersen in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 8c Rn. 35 m.w.N.). Vorliegend bestand aber ein sachlicher Grund für die Einleitung des Hauptsacheverfahrens vor Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens. Denn die Beklagte hatte zunächst versucht, ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen die Klägerin zu betreiben. Allerdings bereitete schon die Zustellung des Antragsschriftsatzes erhebliche Schwierigkeiten, da die deutsche Tochtergesellschaft der in Taiwan ansässigen Klägerin die entsprechenden Unterlagen mit dem Hinweis, die Zustellung müsse bei dem Mutterkonzern in Taiwan (also der Klägerin) erfolgen, die Klägerin habe ihr die Weiterleitung der Dokumente nach Taiwan untersagt, an das Gericht zurückgesandt hat. Um zeitliche Verzögerungen, während derer die Produktsperre bei AT hätte fortdauern können, zu vermeiden, hat die Beklagte in dem bereits laufenden Hauptsacheverfahren, das unter umgekehrtem Rubrum bereits von der anwaltlich vertretenen Klägerin gegen sie, die Beklagte, geführt wurde, Widerklage erhoben. Ein solches Vorgehen ist, wie die Beklagte ausführt, prozessökonomisch und vermeidet Verzögerungen. Die Verfolgung sachfremder Ziele liegt darin nicht. Der Beklagten geht es ersichtlich darum, möglichst schnell gerichtlich überprüfen zu lassen, ob die seitens der Klägerin erhobenen Complaints und die daraufhin erfolgten Produktsperren auf der Verkaufsplattform D rechtswidrig waren. Zudem stand eine zeitnahe Entscheidung über den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung bei Einreichung des Widerklageschriftsatzes wegen der Schwierigkeiten hinsichtlich der Zustellung des Antragsschriftsatzes nicht zu erwarten. Schließlich hat die Beklagte der Klägerin auch nicht die Möglichkeit genommen, eine Abschlusserklärung abzugeben. Durch Erhebung der Widerklage hat sie ihr vielmehr die Möglichkeit eröffnet, insoweit ein – ggfs. sofortiges – Anerkenntnis zu erklären.
- Bei Anwendung der Maßstäbe des § 8c Abs. 1 UWG ist ein Rechtsmissbrauch im Ergebnis daher nicht erkennbar. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht nach dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben.
- II.
Die Widerklage ist – nachdem die Beklagte ihre Anträge in der mündlichen Verhandlung umformuliert hat – vollumfänglich begründet. Die im Wege der Widerklage geltend gemachten Ansprüche stehen der Beklagten gegen die Klägerin zu. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie die geltend gemachten Ansprüche zunächst auf einen Eingriff in den Gewerbebetrieb (§§ 823 Abs. 1, 1004 BGB) und sodann auf § 4 Nr. 4 UWG (gezielte Behinderung) stützt, so dass die Prüfung in dieser Reihenfolge vorgenommen wird. - 1.
Der Beklagten steht der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung wegen eines rechtswidrigen Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1004 BGB analog zu. - a.
Das hier streitgegenständliche Verhalten – namentlich die Erhebung von Complaints („Infringement-Meldung“) gegenüber AT – ist nach den rechtlichen Maßstäben einer Schutzrechtsverwarnung gegenüber einem Abnehmer zu beurteilen (LG Düsseldorf, GRUR-RS 2022, 52103; LG München I, GRUR-RS 2021, 31805; LG München I, GRUR-RS 2020, 29773). Wie bei einer Abnehmerverwarnung wendet sich der Abmahnende mit der Schutzrechtsverletzungsanzeige mit dem Vorwurf einer Schutzrechtsverletzung an einen Dritten. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus dem Vortrag der Klägerin, sie habe nur eine Berechtigungsanfrage stellen und eine Prüfung durch AT herbeiführen wollen. Der Vortrag, dass sie davon ausgehe, dass AT die Beklagte zur Stellungnahme aufgefordert und die Beklagte vermutlich versäumt habe, fristgerecht zu antworten, erfolgt offensichtlich ins Blaue hinein. Dass die Klägerin für ihren Complaint ein „infringement“-Formular nutzte (s. von der Klägerin angegebene URL, unter der das Formular abrufbar ist), in dem unstreitig die betroffenen Produkte und das betroffene Schutzrecht angegeben werden können, deutet bereits darauf hin, dass die Klägerin gegenüber AT erklärt hat, dass – nach ihrer Auffassung – die 30 in den Mitteilungen benannten Produkte das Klagepatent verletzen. Es ist lebensfremd, dass die Klägerin als erfahrene Wirtschaftsteilnehmerin davon ausging, das Verfahren werde den Verlauf einer schlichten Berechtigungsanfrage nehmen. Wäre es ihr wirklich auf eine inhaltliche Überprüfung angekommen, hätte sie die Berechtigungsanfrage unmittelbar an die Beklagte richten können. Dass der Complaint gegenüber AT durchaus dazu führen könnte, dass die dort genannten Produkte auf der Verkaufsplattform D gesperrt werden, ergibt sich unmittelbar aus den von der Klägerin auf Seite 29 des Schriftsatzes vom 11.01.2024 (Bl. 245 GA) eingeblendeten Erläuterungen von AT zu dem von der Klägerin gewählten Complaint-Verfahren. Bereits aus der Überschrift der Erläuterungen folgt, dass es sich bei der das Complaint-Verfahren einleitenden Mitteilung um eine Mitteilung an AT über eine Rechtsverletzung und nicht um eine an AT gerichtete Bitte um Prüfung handelt. Wie die Klägerin angesichts dessen zu der Einschätzung kommt, es handele sich um eine schlichte Berechtigungsanfrage, erschließt sich nicht. Hinzu kommt, dass es in den Erläuterungen wörtlich heißt - „AT hat ein großes Interesse daran, Verstöße zu verhindern, und wir werden umgehend auf Deine Benachrichtigung reagieren, indem wir geeignete Maßnahmen ergreifen, zu denen auch die Entfernung der betreffenden Information oder des betreffenden Produkts gehören kann.“
- Weitere Maßnahmen, die AT auf die Mitteilung möglicherweise würde ergreifen können, sind in den Erläuterungen nicht aufgeführt. Insbesondere hat der letzte Satz der Erläuterungen, nach dem der Mitteiler AT erlaubt, die übermittelten Informationen für die Bearbeitung der Meldung zu verwenden, was auch die Weiterleitung des eingereichten Formulars an alle Parteien beinhalte, die an der Bereitstellung des mutmaßlich rechtsverletzenden Inhalts beteiligt seien, ganz offensichtlich vor allem einen datenschutzrechtlichen Hintergrund und lässt keinerlei Rückschluss darauf zu, dass eine Anhörung oder gar inhaltliche Prüfung durchgeführt werden würde, bevor die Produkte gesperrt würden. Vielmehr kann eine solche Weiterleitung auch dann erfolgen, wenn die Produktsperre bereits erfolgt ist und die Partei, deren Produkt von der Sperre betroffen ist, sich daraufhin an AT wendet. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass AT die Produkte, die als schutzrechtsverletzend gemeldet wurden, nach Erhalt des Complaints – bzw. der infringement- bzw. Rechtsverletzungs-Mitteilung – für die Dauer einer Anhörung weiterer Beteiligter und anschließenden Prüfung online belassen würde. Denn dann könnte AT selbst eine Rechtsverletzung vorgeworfen werden.
- Im Ergebnis steht fest, dass die Klägerin über die Complaints gegen die Produkte der Beklagten versucht, die geschäftlichen Aktivitäten des behaupteten Schutzrechtsverletzers zu unterbinden. Dies wird durch die mit der B GmbH geführte Korrespondenz bestätigt, in der die Prozessbevollmächtigten der Klägerin angeben, die Klägerin habe sie beauftragt, die patentverletzenden Produkte von AT entfernen zu lassen. Wertungsmäßig macht es keinen Unterschied, ob der Dritte – wie im Falle der Abnehmerverwarnung – selbst vom Kauf eines Produkts abgehalten werden soll oder – wie hier – der Verkauf des Produkts dadurch verhindert werden soll, dass ein Händler bzw. eine Internethandelsplattform hierzu aufgefordert wird. Da sie die Complaints selbst erklärt hat, ist die Klägerin ohne Weiteres passivlegitimiert.
- Nach der Rechtsprechung des BGH können unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen einen rechtswidrigen und gegebenenfalls schuldhaften Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB darstellen und Ansprüche auf Schadensersatz und Unterlassung begründen (BGH, GRUR 2011, 152, Rz. 67 – Kinderhochstühle im Internet; BGH GRUR 2005, 882 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH GRUR 2006, 432 Rz. 20 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II; BGH GRUR 2006, 433 Rz. 17 – Unbegründete Abnehmerverwarnung; LG Düsseldorf, GRUR-RS 2022, 52103). Die fehlende Berechtigung der Schutzrechtsverletzungsanzeige gegenüber AT kann sich wie bei der unberechtigten Abnehmerverwarnung aus formellen oder aus materiellen Gründen ergeben (vgl. LG Düsseldorf, GRUR-RS 2022, 52103; LG München I – GRUR-RS 2021, 31805 Rn. 52). Maßgebend ist dabei die objektive Rechtslage (LG Düsseldorf, GRUR-RS 2022, 52103; Köhler/Alexander, in: Bornkamm/Feddersen/Köhler, UWG, 42. Auflage 2024, § 4 Rn. 4.170).
- b.
Die Überprüfung der formellen Anforderungen an die Schutzrechtsverletzungsanzeige ist vorliegend nicht möglich, weil keine der Parteien die Complaints zur Akte gereicht hat. - c.
Die Complaints genügen den materiell-rechtlichen Anforderungen an eine Schutzrechtsverletzungsanzeige nicht. Sie sind materiell unberechtigt, da die zu den dort aufgeführten E gehörigen Produkte das Klagepatent nicht verletzen. - aa.
Soweit die Klägerin den Complaint bezüglich 17 Produkten zurückgenommen und insoweit zu einer angeblichen Verletzung des Klagepatents nicht weiter vorgetragen hat, ist davon auszugehen, dass im Hinblick auf diese Produkte keine Verletzung des Klagepatents vorliegt. Jedenfalls bezüglich einiger Produkte, die etwa gar keine Leuchteinheit aufweisen, obwohl das Klagepatent sich auf eine lichtemittierende Einrichtung bezieht, ist zudem offensichtlich, dass keine Verletzung vorliegt. - bb.
Auch bezüglich der Produkte, zu denen die Klägerin ausführt, sie verletzten das Klagegebrauchsmuster, ist die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt. Denn unstreitig hat die Klägerin die Complaints auf eine vermeintliche Verletzung des Klagepatents gestützt. Eine solche liegt jedoch – davon geht die Kammer angesichts des Vortrags der Klägerin, die insoweit eine Verletzung des Klagepatents nicht mehr geltend macht, sondern sich auf eine vermeintliche Verletzung des Klagegebrauchsmusters beruft – nicht vor. Es trifft auch nicht zu, dass es nicht darauf ankomme, welches Schutzrecht genau verletzt sei, solange überhaupt ein der Klägerin zustehendes Schutzrecht verletzt sei, da der Beklagten ansonsten ein verbotenes Verhalten erlaubt werden würde. Bei einer Schutzrechtsverwarnung muss der andere Teil wissen, welches Schutzrecht Gegenstand der Verwarnung ist, um zu prüfen, ob und wie er sich gegen die Verwarnung verteidigt. Zudem spiegeln Widerklageantrag und Tenor wider, dass es vorliegend allein um Complaints wegen Verletzung des Klagepatents geht. - cc.
Schließlich liegt auch in Bezug auf die angegriffenen Ausführungsformen 2 bis 5 eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vor. Denn keine der angegriffenen Ausführungsformen verletzt die Lehre des Klagepatents. Insoweit wird auf die obigen Ausführungen im Rahmen der Prüfung der Begründetheit der Klage, die hier weitgehend entsprechend gelten, Bezug genommen. - Die Kammer verkennt nicht, dass im Rahmen der Widerklage die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände trägt, aus denen sich eine fehlende Rechtsverletzung ergibt, da es sich insoweit um anspruchsbegründende Tatsachen handelt. Auch in Anwendung dieses Maßstabes geht die Kammer davon aus, dass die vorgenannten angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent nicht verletzen. Denn die Beklagte hat zu den in den angegriffenen Ausführungsformen 2 bis 5 verbauten Leuchtmitteln Datenblätter vorgelegt, die sie von den Herstellern der Leuchtmittel erhalten hat. Aus diesen Datenblättern ergibt sich jeweils, dass Elektrodenabschnittsquerschnitt und Gehäusequerschnitt in einer Ebene liegen. Dies hat die Beklagte unter Bezugnahme auf in den Datenblättern enthaltene Abbildungen nachvollziehbar dargelegt. Das zu der angegriffenen Ausführungsform 4 gehörige Datenblatt (Anlage KAP16) zeigt auf seiner Seite 2 eine Abbildung und eine Zeichnung, aus denen sich ergibt, dass kein Höhenunterschied zwischen den entsprechenden Bereichen besteht. Ebenso verhält es sich mit dem zur angegriffenen Ausführungsform 5 gehörigen Datenblatt (Anlage KAP19), das auf Seite 9 eine Zeichnung enthält, die keinen Höhenunterschied zeigt. Schließlich zeigt auch das zu den angegriffenen Ausführungsformen 2 und 3 gehörige Datenblatt (Anlage KAP15) auf seinem Deckblatt ein Produkt und auf Seite 35 eine Zeichnung, die in dem relevanten Bereich keinen Höhenunterschied ausweisen. Die Klägerin hat – auch unter Berücksichtigung der mit Schriftsatz vom 12.02.2024 vorgelegten hochauflösenden Lichtbilder – diesen Vortrag der Beklagten nicht zu entkräften vermocht. Denn die Klägerin hat schon nicht vorgetragen, wie weit der jeweilige Elektrodenabschnittsquerschnitt tatsächlich gegenüber dem Gehäusequerschnitt vorstehen würde und ob und an welcher Stelle sie eine entsprechende Messung vorgenommen hätte. Zudem bleibt es dabei, dass die Lichtbilder der angegriffenen Ausführungsformen 4 und 5 – angesichts der erheblichen Vergrößerung – schon keinen relevanten Höhenunterschied erkennen lassen. Hinzu kommt wiederum, dass der eigene Vortrag der Klägerin zur Verflüssigung eines Teils des Gehäuses beim Löten und dazu, dass die starke Vergrößerung und hohe Auflösung glatte Oberflächen rau erscheinen lässt, gegen das Vorliegen eines relevanten Höhenunterschiedes spricht. Unter Berücksichtigung der abweichenden Darlegungs- und Beweislast wird auch im Übrigen auf die Ausführungen im Rahmen der Verletzungsprüfung innerhalb der Klage verwiesen. Rein klarstellend sei erwähnt, dass die angegriffene Ausführungsform 6 nicht Gegenstand der Widerklage ist, was die Beklagtenvertreterinnen in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt haben, nachdem die Klägervertreter die angegriffene Ausführungsform 6 keiner der aus dem Tenor ersichtlichen E zuordnen konnten.
- d.
Bezüglich der Rechtswidrigkeit des Eingriffs bestehen keine Bedenken. Denn die Klägerin hat offenbar mehr oder weniger ungeprüft Complaints bezüglich 30 Produkten, von denen mehrere ganz offensichtlich nicht patentverletzend sind, erhoben. Von den in den Complaints insgesamt 30 unter Angabe der E benannten Produkten vertritt die Klägerin nunmehr nur noch bezüglich vier Produkten, dass sie das Klagepatent verletzen würden. Die erforderliche Interessenabwägung geht daher zu Lasten der Klägerin aus. - e.
Die für den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungs- oder Begehungsgefahr liegt vor. Die tatsächlich erfolgten Eingriffe in den Gewerbebetrieb der Beklagten begründen eine Wiederholungsgefahr, die auch nicht entfallen ist. Allein die Rücknahme eines Teils der Complaints lässt die Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung hat die Klägerin nicht abgegeben. - 2.
Der geltend gemachte Beseitigungsanspruch ergibt sich ebenfalls aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1004 BGBG analog wegen eines rechtswidrigen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Zu den Voraussetzungen des Anspruchs wird auf die Ausführungen im Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch verwiesen, die hier (mit Ausnahme der Ausführungen zur Wiederholungsgefahr) entsprechend gelten. Das zusätzliche Erfordernis der fortdauernden Beeinträchtigung ist bezüglich der 14 Produkte, deren E im Tenor zu Ziffer II.2. genannt sind, gegeben, da die Produkte noch gesperrt sind. - 3.
Der Beklagten steht darüber hinaus wegen des rechtswidrigen Eingriffs in ihren Gewerbebetrieb gegen die Klägerin dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB zu, da der Eingriff schuldhaft erfolgte. Die Klägerin handelte bei Abgabe der Complaint-Mitteilungen gegenüber AT jedenfalls fahrlässig. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie erkennen müssen, dass die Complaints unberechtigt waren, da die betroffenen Produkte die Lehre des Klagepatents nicht verletzen. - a.
Soweit die Beklagte als Schaden außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 4.613,64 € geltend macht, ist der Anspruch begründet. Der insoweit seitens der Beklagten angesetzte Gegenstandswert von 50.000,00 € erscheint angesichts der Vielzahl der betroffenen Produkte nicht überhöht und wird von der Klägerin nicht konkret in Abrede gestellt. Auch bezüglich der Berechnung der in Ansatz gebrachten Kosten bestehen keine Bedenken. Die außergerichtlichen Kosten stellen einen kausal durch den Eingriff in den Gewerbebetrieb der Beklagten verursachten Schaden dar. Insoweit ist unerheblich, ob die Klägerin eine etwaige Abmahnung der Beklagten erhalten hat oder nicht. Denn bei den geltend gemachten Kosten handelt es sich nicht um die Kosten einer eigenen Abmahnung der Beklagten, sondern um Kosten, die zur Verteidigung gegen die seitens der Klägerin ausgesprochene unberechtigte Schutzrechtsverwarnung entstanden sind. - b.
Auch soweit die Beklagte bezüglich der noch nicht bezifferbaren Schäden die Feststellung der grundsätzlichen Schadensersatzverpflichtung begehrt, ist die Widerklage zulässig und begründet. Das nach § 256 ZPO erforderliche Interesse an der Feststellung ergibt sich daraus, dass die Beklagte ihren Schaden noch nicht vollständig beziffern kann und ohne Feststellung der Schadensersatzpflicht eine Verjährung des Anspruchs droht. Die Widerklage ist auch insoweit begründet, da die Schadensersatzverpflichtung – wie ausgeführt – dem Grunde nach besteht. - 4.
Der Zinsanspruch folgt aus § 291 BGB, die Höhe der zu leistenden Prozesszinsen ergibt sich aus § 288 Abs. 1 S. 2 BGB. - 5.
Die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche ergeben sich auch unter dem Gesichtspunkt einer gezielten Mitbewerberbehinderung gemäß § 4 Nr. 4 UWG. - a.
Der Unterlassungsanspruch folgt aus §§ 8 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG. - aa.
Bei den Parteien handelt es sich um Mitbewerber im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UWG, da beide in Deutschland Leuchtmittel an Abnehmer vertreiben. - bb.
Die Mitteilung der Complaints gegenüber AT stellt auch eine unlautere geschäftliche Handlung in Form einer gezielten Behinderung der Beklagten als Mitbewerberin der Klägerin dar. Denn – wie im Zusammenhang mit den Ansprüchen wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dargestellt – handelt es sich bei den seitens der Klägerin erhobenen Complaints um unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen. Sie sind darauf gerichtet, den Absatz des Mitbewerbers zu behindern und sind daher als gezielte Behinderung im Sinne von § 4 Nr. 4 UWG zu qualifizieren (vgl. Köhler/Alexander, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 42. Auflage 2024, § 4 Rn. 4.177f.). - cc.
Wiederum hat die Klägerin die durch die erfolgte Verletzung begründete Wiederholungsgefahr nicht durch Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt. - b.
Der Beseitigungsanspruch ist ebenfalls aus §§ 8 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG begründet. - c.
Der geltend gemachte Schadensersatzanspruch beruht auf §§ 9 Abs. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 4 UWG. Wiederum ist das erforderliche Verschulden gegeben, da die Klägerin bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen müssen, dass die von ihr ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnungen unberechtigt waren. Auch unter dieser Anspruchsgrundlage stellen die außergerichtlichen Rechtsverteidigungskosten einen ersatzfähigen Schaden dar. Darüber hinaus ist die auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtete Klage auch zulässig, soweit die Beklagte den Anspruch auf UWG stützt. Auch insoweit ist das nach § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse gegeben. - C.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Voraussetzungen dieser Norm liegen nach der teilweisen Rücknahme des auf Beseitigung gerichteten Antrags vor. - Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit richtet sich nach § 709 ZPO. Entsprechend des Antrags der Beklagten hat die Kammer Teilsicherheiten festgesetzt. Die jeweils aus dem Tenor ersichtlichen Beträge erscheinen insoweit angemessen.
- Streitwert: 600.000,00 EUR, davon entfallen 500.000,00 EUR auf die Klage und 100.000,00 EUR auf die Widerklage.