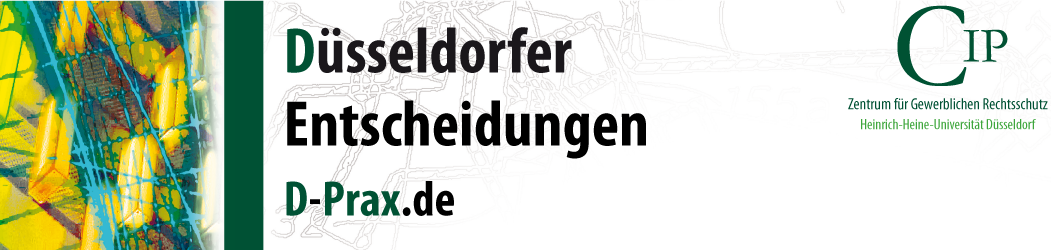Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3350
Oberlandesgericht Düsseldorf
Urteil vom 27. Juni 2024, I-2 U 41/24
Vorinstanz: 4a O 83/20
- I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts vom 29.11.2023 aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung – auch über die Kosten des Berufungsverfahrens – an das Landgericht Düsseldorf zurückverwiesen.
- II. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
- III. Die Revision wird nicht zugelassen.
- Gründe
-
I.
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Patents 1 726 XXA B1 auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.
Am 25.09.2020 erhob die Klägerin die vorliegende Klage (Bl. 1 ff. GA LG). Das Landgericht erließ am 05.10.2020 neben der prozessleitenden Verfügung (Bl. 36 ff. GA LG) einen Beschluss, durch den der Beklagten gemäß § 184 ZPO aufgegeben wurde, binnen eines Monats einen Zustellungsbevollmächtigten in der Bundesrepublik Deutschland zu benennen (Bl. 32 f. GA LG). Am 06.10.2020 leitete das Landgericht – unter Beifügung entsprechender chinesischer Übersetzungen – durch einen Antrag auf Zustellung eines gerichtlichen Schriftstücks im Ausland an die Rechtshilfeabteilung des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen die Auslandszustellung der Klageschrift, der prozessleitenden Verfügung und des Beschlusses nach § 184 ZPO an die Beklagte in China ein (vgl. Bl. 38 GA LG).
Anfragen des Landgerichts nach dem Sachstand des Zustellungsverfahrens blieben im Jahr 2021 erfolglos (vgl. Bl. 37 Rückseite GA LG). Mit Schriftsatz vom 04.01.2022 (Bl. 64 ff. GA LG) beantragte die Klägerin die öffentliche Zustellung der Klage. Mehrere gerichtliche Sachstandsanfragen an das chinesische Justizministerium über das Bundesamt für Justiz sowie die deutsche Botschaft in China blieben auch im Jahr 2022 erfolglos (vgl. Bl. 62 Rückseite GA LG). Mit Schriftsatz vom 27.07.2022 wiederholte die Klägerin ihren Antrag auf öffentliche Zustellung der Klageschrift (Bl. 73 f. GA LG). Im Oktober 2022 erhielt das Landgericht eine offizielle Mitteilung („certificate“) der zuständigen chinesischen Behörde, datiert auf den 06.04.2021, dass die Zustellung fehlgeschlagen und die Beklagte unter der angegebenen Adresse nicht zu finden gewesen sei („No such company at the address provided. The recipient could not be found without more contact details.“, vgl. Bl. 78 ff. GA LG).
Der auf dem Zustellungsersuchen angegebene Name und die Adresse der Beklagten stimmen mit der auf ihrer eigenen Internetseite www.A.cn angegebenen chinesischen Schreibweise überein. Die Klägerin ließ die angegebene Adresse mit Hilfe eines Taxifahrers kontrollieren und konnte bestätigen, dass sich dort – insoweit auch unstreitig – das Firmengelände der Beklagten befindet. Mit Schriftsatz vom 03.11.2022 (Bl. 87 ff. GA LG) beantragte die Klägerin erneut, die öffentliche Zustellung der Klage zu bewilligen.
Mit Beschluss vom 04.11.2022 (Bl. 93 f. GA LG) bewilligte das Landgericht die öffentliche Zustellung der Klageschrift, der prozessleitenden Verfügung und des Beschlusses nach § 184 ZPO. Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung wurde vom 11.11.2022 bis zum 13.12.2022 an der Gerichtstafel des Landgerichts Düsseldorf ausgehängt. Eine Verteidigungsanzeige der Beklagten ging innerhalb der hierzu gesetzten Frist von einem Monat nach Zustellung der Klageschrift (vgl. prozessleitende Verfügung vom 05.10.2020, Bl. 36 ff. GA LG) nicht ein.
Durch Versäumnisurteil vom 21.02.2023 (Bl. 102 ff. GA LG) verurteilte das Landgericht die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung und zum Rückruf und stellte die Schadensersatzpflicht der Beklagten dem Grunde nach fest. Die Adresse der Beklagten ist in dem Versäumnisurteil mit „B, vertreten durch ihren Geschäftsführer, C“ angegeben. An diese Adresse veranlasste das Landgericht am 22.02.2023 die Zustellung des Versäumnisurteils durch Aufgabe zur Post (vgl. Bl. 120 f. GA LG).
Mit Schriftsatz vom 24.02.2023 (Bl. 126 ff. GA LG) beantragte die Klägerin die öffentliche Zustellung des Versäumnisurteils. Durch Verfügung vom 27.02.2023 teilte das Landgericht der Klägerin mit, dass es einer öffentlichen Zustellung des Versäumnisurteils seines Erachtens nach nicht bedürfe, da das Versäumnisurteil der Beklagten wirksam nach § 184 ZPO durch Aufgabe zur Post habe zugestellt werden können.
Mit Schriftsatz vom 03.11.2023 (Bl. 156 f. GA LG) haben sich für die Beklagte ihre jetzigen Prozessbevollmächtigten bestellt und auf Antrag zunächst Akteneinsicht erhalten. Mit Schriftsatz vom 07.11.2023 (Bl. 163 ff. GA LG) haben sie sodann für die Beklagte Einspruch gegen das Versäumnisurteil eingelegt, wobei sie im Hinblick auf die Einspruchsfrist hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt haben.
Die Beklagte hat behauptet, erstmals am 24.10.2023 durch eine chinesische Pressemitteilung der Klägerin Kenntnis von dem hiesigen Verfahren erlangt zu haben. Ihr seien weder die Klageschrift noch das Versäumnisurteil zugegangen. Das Versäumnisurteil sei auch an die falsche Adresse geschickt worden. Richtigerweise laute ihre Adresse – wie auch auf ihrer offiziellen Website angegeben – „D.
Die Beklagte hat vor dem Landgericht ausgeführt, sie wolle sich in der Sache gegen die Klage verteidigen. Sie habe die angegriffene Ausführungsform in China hergestellt und vertrieben, Vertriebshandlungen in Deutschland seien ihr nicht bekannt. Im Übrigen mache die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.
Die Klägerin hat behauptet, unter den E-Mail-Adressen E@A, F.com und G@A.cn mehrfach versucht zu haben, die Beklagte zu kontaktieren und sie bereits am 03.08.2020 abgemahnt zu haben. Auf die E-Mail vom 03.08.2020 habe sie eine Lesebestätigung erhalten. In einer weiteren E-Mail vom 03.09.2020 habe sie sich auf ihre Abmahnung bezogen und unter Beifügung des Entwurfs der Klageschrift angekündigt, Klage beim Landgericht Düsseldorf einzureichen. Diese E-Mail sei der Beklagten ausweislich einer Zustellungserklärung von Microsoft Outlook (vgl. Anlage KAP 13) zugestellt worden.
Das Versäumnisurteil sei vom Gericht an die richtige Adresse gesandt worden. Der Straßenname „H“ sei die englische Übersetzung der chinesischen Zeichen; „H“ sei die Schreibweise des chinesischen Namens in „arabischen“ Buchstaben. Die Abweichung sei nicht geeignet, eine Verwechslung zu begründen. Die mit der Zustellung beauftragte Person könne ohne weiteres erkennen, dass die Adresse – wie bei internationalen Briefen üblich – in englischer Sprache angegeben sei.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei der Beklagten nicht zu gewähren. Diese habe die Einspruchsfrist nicht unverschuldet versäumt. Jedenfalls sei das Versäumnisurteil der Beklagten am 23.08.2023 mit der Sendungsnummer EMS1293017080XXA zugestellt worden. Selbst wenn das Urteil nur einem Pförtner übergeben worden sei, so sei es jedenfalls zurechenbar in den Herrschaftsbereich der Beklagten gelangt, so dass diese Gelegenheit gehabt habe, von seinem Inhalt Kenntnis zu nehmen.
Das Landgericht hat den Einspruch der Beklagten mit Urteil vom 29.11.2023 als unzulässig verworfen und den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist zurückgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
Die Zustellung des Versäumnisurteils sei am 09.03.2023 rechtswirksam durch Aufgabe zur Post bewirkt worden. Die Frist zur Einlegung des Einspruchs habe deshalb am 23.03.2023 geendet. Nachdem der Einspruch der Beklagten erst am 07.11.2023 bei Gericht eingegangen sei, sei dieser verfristet. Wiedereinsetzung sei nicht zu gewähren.
Der Beschluss nach § 184 ZPO, mit dem der Beklagten aufgegeben worden sei, innerhalb einer Frist von einem Monat einen Zustellungsbevollmächtigten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland zu benennen, sei der Beklagten nebst der Klageschrift vom 25.09.2020 und der prozessleitenden Verfügung vom 05.10.2020 wirksam im Wege der öffentlichen Zustellung zugestellt worden. Die Voraussetzungen für die Anordnung der öffentlichen Zustellung hätten vorgelegen, weil die bereits im Oktober 2020 initiierte Auslandszustellung trotz korrekter Anschrift der Beklagten im April 2021 fehlgeschlagen sei, was der Kammer trotz mehrfacher Sachstandsanfragen und Bemühungen um Ermittlung des Zustellungsstatus erst im Oktober 2022 seitens der chinesischen Behörden mitgeteilt worden sei. Der Zustellungsversuch sei ausweislich der Zustellungsbescheinigung gescheitert, weil die Beklagte angeblich unter der angegebenen Adresse nicht auffindbar gewesen sei. Die Klägerin habe jedoch mit Schriftsatz vom 03.11.2022 glaubhaft gemacht, dass die Beklagte tatsächlich unter der angegebenen Adresse ansässig sei. Ein erneuter Zustellungsversuch sei entbehrlich und der Klägerin aufgrund der schon verhältnismäßig langen Dauer des Verfahrens nicht zumutbar gewesen. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass ein erneuter Versuch wiederum lange Zeit in Anspruch genommen hätte; zudem sei der Ausgang ungewiss gewesen.
Die öffentliche Zustellung sei gemäß § 186 ZPO ordnungsgemäß durchgeführt worden. Eine informelle Information der Beklagten sei zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs nicht zwingend geboten gewesen. Nachdem die chinesischen Behörden mitgeteilt hätten, dass die Beklagte unter der angegebenen Anschrift postalisch nicht erreichbar sei, habe eine Information der Beklagten auf dem Postweg keinen Erfolg versprochen. Hinsichtlich der von der Klägerin angegebenen E-Mail-Adressen behaupte die Beklagte ohnehin, dass diese entweder falsch seien oder Kontaktaufnahmen seitens der Klägerin bei ihr nicht angelangt seien. Insofern habe auch dieser Weg keinen Erfolg versprochen.
Die gerichtliche Anordnung gemäß § 184 ZPO habe vorliegend auch im Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 185 ZPO zugestellt werden dürfen. Weder nach dem Wortlaut noch nach dem Sinn und Zweck des § 184 Abs. 1 ZPO sei es erforderlich, die gerichtliche Anordnung nach dieser Vorschrift im Wege einer erfolgreichen Auslandszustellung gemäß § 183 Abs. 2 bis 5 ZPO zuzustellen. Insofern entspreche es gerade dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift, Verzögerungen von Rechtsstreiten bei Beteiligung von im Ausland ansässigen Parteien zu vermeiden.
Die Zustellung des Versäumnisurteils vom 21.02.2023 an die Beklagte durch Aufgabe zur Post sei daher wirksam gewesen. Etwaige Schreibfehler in der Adressangabe hätten jedenfalls keine Verwechslungsgefahr begründet.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sei nicht zu gewähren gewesen, weil die Beklagte fehlendes Verschulden nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht habe. Es sei insofern wenig lebensnah und habe von der Beklagten nicht glaubhaft gemacht werden können, dass sie tatsächlich erst am 24.10.2023 Kenntnis von dem Versäumnisurteil erlangt habe. Insbesondere sei davon auszugehen, dass die Beklagte spätestens mit der Abgabe der Sendungsnummer EMS1293017080XXA am 23.08.2023 bei dem bei der Beklagten beschäftigten Pförtner zurechenbare Kenntnis von dem Versäumnisurteil erlangt habe. Insofern müsse sie sich jedenfalls die Kenntnis ihres Pförtners zurechnen lassen, wenn sie aufgrund eines etwaigen Aufsichts-, Organisations- bzw. Informationsverschuldens selbst keine Kenntnis von dem Versäumnisurteil erlangt habe. -
Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend macht:
Zu Unrecht habe das Landgericht ihren Einspruch als verfristet verworfen. Das Versäumnisurteil vom 21.02.2023 sei nicht wirksam zugestellt worden. Weder hätten die Voraussetzungen des § 184 ZPO vorgelegen noch sei die Aufgabe zur Post ordnungsgemäß erfolgt. Entgegen der Auffassung des Landgerichts habe die gerichtliche Anordnung zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten nicht im Wege der öffentlichen Zustellung nach § 185 ZPO zugestellt werden dürfen. Der Beschluss könne nur dann die gesetzlich vorgesehene Prozessförderungspflicht begründen, wenn er dem Adressaten im Rahmen einer erfolgreichen Auslandszustellung auch tatsächlich zugestellt worden sei. § 184 ZPO solle nur dann als Erleichterung eine inländische Zustellungsfiktion ermöglichen, wenn der Adressat der Anordnung seiner Prozessförderungspflicht nicht nachkomme und keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benenne. Hierfür müsse sich der Adressat aber zwingend seiner Prozessförderungspflicht bewusst sein. Nur die tatsächliche Auslandszustellung könne deshalb die Pflicht und die entsprechende negative Folge für das rechtliche Gehör rechtfertigen.
Im Übrigen hätten bei der Zustellung der Anordnung des § 184 ZPO die Voraussetzungen für eine öffentliche Zustellung nicht vorgelegen. Das Landgericht sei vielmehr verpflichtet gewesen, nach dem Fehlschlagen des ersten Zustellungsversuchs einen erneuten Zustellungsversuch zu unternehmen. Die naheliegende offensichtliche Erklärung für das Fehlschlagen des ersten Zustellungsversuches sei der Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gewesen. Damals habe die Infektionslage zu erheblichen Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Zustellung von Post gerade im grenzüberschreitenden Verkehr geführt. Demgegenüber gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Volksrepublik China grundsätzlich die Zustellung im Wege der Rechtshilfe erschwert habe. Im Zeitpunkt der Entscheidung über die öffentliche Zustellung im November 2022 habe sich die weltweite Lage bezüglich Corona wieder entspannt und es sei aufgrund des Anspruchs der Beklagten auf rechtliches Gehör und ein faires Verfahren geboten gewesen, einen weiteren Zustellungsversuch zu unternehmen, anstatt unmittelbar die öffentliche Zustellung zu bewilligen. Dies gelte insbesondere angesichts des langen Zeitraums zwischen dem ersten Zustellungsversuch im April 2021 und der Bewilligung der öffentlichen Zustellung im November 2022.
Zudem wäre eine informelle Information der Beklagten über den Inhalt der öffentlichen Zustellung zwingend geboten gewesen. Das Landgericht habe nicht nur die korrekte Anschrift der Beklagten gekannt, sondern hätte auf der Website der Beklagten auch ohne weiteres deren E-Mail-Adresse auffinden können. Dennoch habe das Landgericht nicht einmal den Versuch unternommen, mit der Beklagten Kontakt aufzunehmen.
Schließlich sei die Aufgabe des Versäumnisurteils zur Post nach § 184 ZPO auch fehlerhaft durchgeführt worden. Die für die Zusendung verwendete Anschrift sei in mehrfacher Hinsicht unrichtig gewesen, was die Gefahr einer Verwechslung begründet habe.
Jedenfalls aber sei ihr – der Beklagten – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren gewesen. Ein Verschulden bezüglich der fehlenden Kenntnis von dem Versäumnisurteil falle ihr nicht zur Last. Das Landgericht habe insofern die Anforderungen an die Glaubhaftmachung überspannt. Sie – die Beklagte – habe durch die Vorlage zweier eidesstattlicher Versicherungen glaubhaft gemacht, dass sie keine Kenntnis von dem Versäumnisurteil gehabt habe. Das Landgericht hätte zumindest darauf hinweisen müssen, dass ihm dies für die Glaubhaftmachung nicht genüge.
Die Postsendung vom 23.08.2023 habe sie tatsächlich nicht erreicht. Sie habe schon nicht feststellen können, dass eine entsprechende Sendung überhaupt bei ihrem Pförtner abgegeben worden sei. Darüber hinaus sei es nicht die Aufgabe des Pförtners, Post für sie – die Beklagte – entgegenzunehmen. -
Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Landgerichts vom 29.11.2023 abzuändern, das Versäumnisurteil des Landgerichts vom 21.02.2023 aufzuheben und die Klage abzuweisen,
hilfsweise das Urteil des Landgerichts vom 29.11.2023 aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen. -
Die Klägerin beantragt,
die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 29.11.2023 zurückzuweisen,
hilfsweise, die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht Düsseldorf zurückzuverweisen. -
Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend, wobei sie geltend macht:
Der Einspruch der Beklagten vom 07.11.2023 sei verfristet und deshalb zu Recht durch das Landgericht als unzulässig verworfen worden, vgl. § 341 Abs. 1 S. 2 ZPO. Die öffentliche Zustellung der gerichtlichen Anordnung zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten nach § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO habe ebenso wie die Klage selbst nach § 185 ZPO öffentlich zugestellt werden können. § 184 ZPO solle als Erleichterung eine inländische Zustellungsfiktion ermöglichen. Auf diese Weise solle der klägerische Justizgewährungsanspruch und das rechtliche Gehör der Beklagten in Einklang gebracht werden. Es finde mithin eine Interessenabwägung statt, die nach dem gesetzgeberischen Willen mit Einführung des § 184 ZPO zugunsten des Klägers ausgefallen sei. § 184 ZPO greife dabei nicht nur, wenn eine förmliche Zustellung nach § 183 ZPO tatsächlich erfolgt sei. Ausreichend sei auch, dass die nach § 183 ZPO angeordnete Auslandszustellung gescheitert sei. Der Grundgedanke der Prozessförderungspflicht ändere sich nicht, unabhängig davon, ob eine förmliche Zustellung erfolgt oder öffentlich zugestellt worden sei. Denn hiermit solle insbesondere erreicht werden, dass keine andauernden längeren Auslandszustellungen stattfinden müssen, die das Verfahren entgegen dem Grundsatz der Prozessökonomie unverhältnismäßig in die Länge ziehen. Wenn dieser Gedanke schon gelte, wenn nach § 183 ZPO zugestellt wurde, müsse er erst recht für den Fall gelten, dass diese Art der Zustellung scheitere. Es könne der Klägerin, dem Gericht und dem deutschen Rechtsstaat nicht zugemutet werden, dass immer wieder aufs Neue eine öffentliche Zustellung erforderlich sein solle.
Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen. -
II.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig und begründet.
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht den Einspruch der Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom 21.02.2023 zu Unrecht als unzulässig verworfen. Der Einspruch der Beklagten vom 07.11.2023 gegen das Versäumnisurteil vom 21.02.2023 ist zulässig, insbesondere ist er fristgerecht eingelegt worden. -
1.
Es kann dahinstehen, ob das Landgericht das Versäumnisurteil vom 21.02.2023 an die richtige Adresse der Beklagten gesandt hat bzw. ob eine etwaige fehlerhafte Angabe der Anschrift die Gefahr von Verwechslungen begründet hat. Denn durch die Aufgabe des Versäumnisurteils zur Post am 22.02.2023 konnte schon deshalb keine Frist zur Einlegung des Einspruchs nach § 339 Abs. 1 ZPO in Gang gesetzt werden, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Zustellung des Versäumnisurteils durch Aufgabe zur Post gemäß § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO nicht vorlagen.
Die Zustellung durch Aufgabe zur Post ist nach § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO nur zulässig, wenn die betroffene Partei keinen Zustellungsbevollmächtigten benannt hat, obgleich sie dazu gemäß § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO verpflichtet war. Eine solche Verpflichtung besteht für die im Ausland ansässige Partei erst nach Rechtshängigkeit, also nach rechtswirksamer Zustellung der Klageschrift (§§ 261 Abs. 1, 353 Abs. 1 ZPO). Erst dann nämlich besteht ein Prozessrechtsverhältnis, das eine Prozessförderungspflicht, wie sie in § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO bestimmt ist, begründen kann (BGH, NJW 2013, 387 Rn 23). Die Anordnung nach § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO kann dem Zustellungsadressaten zwar grundsätzlich bereits mit dem verfahrenseinleitenden Schriftstück zugestellt werden (Häublein/Müller in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 184 Rn 9; Matthes in Cepl/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage 2022, § 184 Rn 3; Dörndorfer in BeckOK ZPO, 51. Edition, Stand: 01.12.2023, § 184 Rn 3), sie muss aber zwingend im Wege der Zustellung nach § 183 Abs. 2 bis 5 ZPO vorgenommen werden (vgl. BGH, NJW 2011, 2218 Rn 11; BGH, NJW 2011, 1885 Rn 10). Dies ergibt sich bereits aus dem insofern klaren Wortlaut des § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO, darüber hinaus aber auch aus der gesetzgeberischen Intention dieser Vorschrift. § 184 ZPO bezweckt eine beschleunigte Durchführung von Zustellungen, die an sich nach § 183 Abs. 2 bis 5 ZPO im Ausland vorzunehmen wären, weil der Zustellungsadressat im Inland weder einen Wohn- oder Geschäftssitz hat noch sich hier aufhält. Das Gericht kann in diesem Falle anordnen, dass die Partei einen im Inland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten benennt. Eine entsprechende Pflicht zur Benennung eines im Inland ansässigen Zustellungsbevollmächtigten wird aus dem (schon bestehenden) Prozessrechtsverhältnis abgeleitet. Die mit der (fiktiven) Zustellung durch Aufgabe zur Post verbundenen Belastungen für den Empfänger verlangen zwingend, dass ihm die Anordnung nach § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO bekannt ist und er – seine Prozessförderungspflicht missachtend – trotzdem keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennt (vgl. hierzu auch: BPatG, Beschl. v. 07.03.2019 – 30 W (pat) 38/18, BeckRS 2019, 25777 Rn 44). Ist ihm die Anordnung nach § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO hingegen nicht bekannt, so verbietet es der Grundsatz des Anspruchs auf rechtliches Gehör, eine Zustellung durch Aufgabe zur Post gemäß § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO zu fingieren. Insbesondere kann deshalb die Anordnung nach § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO nicht im Wege der öffentlichen Zustellung nach § 185 ZPO zugestellt werden, da es sich auch bei § 185 ZPO um eine fingierte (Inlands-)Zustellung handelt, deren Inhalt dem Adressaten in der Regel nicht zur Kenntnis gelangt. § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO lässt es aber nicht zu, die in § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO vorgesehene Zustellungsfiktion auf eine Zustellung zu gründen, die ebenfalls nur einer Fiktion entspringt. Ist es nicht möglich, Klageschrift, prozessleitende Verfügung und Anordnung nach § 184 Abs. 1 S. 1 ZPO gemäß § 183 Abs. 2 bis 5 ZPO (im Ausland) zuzustellen, bleibt deshalb nur die Möglichkeit, alle weiteren Zustellungen im Wege der öffentlichen Zustellung nach § 185 ZPO (im Inland) zu bewirken, sofern die Voraussetzungen dieser Vorschrift im Einzelfall vorliegen. Dem jeweils zuständigen Gericht kommt hierbei die Aufgabe zu, die zur Bewirkung von Auslandszustellungen erforderlichen Schritte konzentriert, zügig und zielführend nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen, um seiner Prozessförderungspflicht zu genügen und dem Justizgewährungsanspruch des Klägers zu entsprechen. Gelingt dies nicht, kann dieser Umstand aber jedenfalls nicht einseitig zu Lasten des Beklagten gewertet werden.
Der erkennende Senat schließt sich insoweit nach eigener Prüfung der Auffassung des vormals zuständigen 15. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf in seinem Beschluss vom 14.03.2024 (I-15 U 63/23, juris) an, mit dem dieser die Zwangsvollstreckung aus dem Versäumnisurteil des Landgerichts vom 21.02.2024 auf Antrag der Beklagten vorläufig eingestellt hat. Das zweitinstanzliche Vorbringen der Klägerin gibt keinen Anlass zu einer anderweitigen Beurteilung.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts war danach die Einspruchsfrist des § 339 Abs. 1 ZPO noch nicht abgelaufen, als die Einspruchsschrift am 07.11.2023 beim Landgericht eingegangen ist. Die nach Maßgabe des § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO bewirkte Zustellung des Versäumnisurteils durch Aufgabe zur Post hat die Einspruchsfrist des § 339 Abs. 1 ZPO, welche von einer wirksamen Zustellung abhängt (vgl. BGHZ 98, 263, 267), nicht in Lauf setzen können. Wird – wie vorliegend – unter Verstoß gegen § 184 Abs. 1 S.1 ZPO nach § 184 Abs. 1 S. 2 ZPO zugestellt, ist die Zustellung unwirksam; Fristen beginnen nicht zu laufen (BGH, NJW 2011, 2218 Rn 12). Die Aufgabe des Versäumnisurteils zur Post am 22.02.2023 vermochte deshalb keine Fristen in Gang zu setzen. -
2.
Der formgerecht eingelegte Einspruch der Beklagten ist auch nicht auf Grund einer nachfolgenden Heilung des Zustellungsmangels gemäß § 189 ZPO verfristet.
Insofern kann dahinstehen, ob das landgerichtliche Versäumnisurteil am 23.08.2023 unter der Sendungsnummer EMS1293017080XXA einem auf dem Firmengelände der Beklagten tätigen Pförtner übergeben oder im dortigen Empfangsbereich anderweitig hinterlegt wurde. § 189 ZPO ist zwar grundsätzlich auch bei Auslandszustellungen anwendbar (Dörndorfer in BeckOK ZPO, 53. Edition Stand 01.07.2024, § 189 Rn 2), die Heilung von Zustellungsmängeln nach § 189 ZPO setzt aber einen tatsächlichen Zugang des zuzustellenden Dokuments bei dem Zustellungsempfänger voraus. Der geforderte tatsächliche Zugang setzt voraus, dass der Zustellungsadressat von dem Inhalt des zuzustellenden Schriftstückes Kenntnis nehmen konnte (BGH, NJW 2007, 1605), er es also tatsächlich in die Hand bekommen hat (BGH, NZG 2020, 70; BFH, NJW 2014, 2524).
Handelt es sich bei dem Zustellungsadressaten nicht um eine natürliche, sondern um eine juristische Person, so muss das zuzustellende Schriftstück gemäß § 170 Abs. 2, 3 ZPO an den Leiter bzw. einen gesetzlichen Vertreter zugestellt werden. Im Falle des § 189 ZPO bedeutet dies, dass ein gesetzlicher Vertreter der juristischen Person, an die die Zustellung bewirkt werden sollte, das zuzustellende Schriftstück tatsächlich in die Hand bekommen haben muss. Nur dann sind die schutzwürdigen Belange des Adressaten, die durch die förmlichen Zustellungsvorschriften geschützt werden sollen, insbesondere sein Anspruch auf rechtliches Gehör, ausreichend gewahrt (vgl. Dörndorfer in BeckOK ZPO, 53. Edition Stand 01.07.2024, § 189 Rn 1).
Eine Ersatzzustellung nach § 178 ZPO genügt diesen Anforderungen gerade nicht (Häublein/Müller in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 189 Rn 14; Matthes in Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage 2022, § 189 Rn 7). Der in § 189 ZPO geforderte „tatsächliche Zugang“ geht über den materiell-rechtlichen Zugangsbegriff des § 130 BGB hinaus und begnügt sich nicht mit der durch die Begriffe „Machtbereich“ und „Gelegenheit zur Kenntnisnahme“ bewirkten Risikozuweisung (Häublein/Müller in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 189 Rn 13). Für diese Auslegung spricht neben dem Wortlaut des § 189 ZPO („tatsächlich“) vor allem das systematische Argument, dass die Formen der Übermittlung, bei denen der Zugang normativ oder gar fiktiv bestimmt wird, in den Vorschriften über die (Ersatz-) Zustellung abschließend geregelt sind. § 189 ZPO soll gerade nicht dazu führen, dass über den Umweg der nachträglichen Heilung die Vorgaben des förmlichen Zustellungsverfahrens außer Acht gelassen werden, indem es ausreicht, dass das zuzustellende Dokument dem Empfänger „irgendwie“ zugeht (Häublein/Müller in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 189 Rn 2). § 189 ZPO grenzt sich deshalb durch die Bezugnahme auf den „tatsächlichen Zugang“ bei dem Zustellungsempfänger ausdrücklich von der Möglichkeit einer Ersatzzustellung ab.
Ein in diesem Sinne „tatsächlicher Zugang“ der Beklagten zu dem Versäumnisurteil vom 21.02.2023 kann nicht festgestellt werden. Ausweislich der als Anlage B3/B3a zur Akte gereichten beglaubigten Erklärung der ausführenden Niederlassung der I hat der zuständige Postbote die Postsendung im Namen von Frau J selbst unterzeichnet und im Eingangsbereich des Bürogebäudes der Beklagten beim Pförtner zurückgelassen. Der nach den Angaben der Beklagten bei ihr als „Admin Director“ für die Weiterleitung von E-Mails, Post, Briefen und Paketen zuständige Mitarbeiter, Herr K, hat erklärt, die Postsendung nicht erhalten und erst seit dem 24.10.2023 Kenntnis von dem Versäumnisurteil zu haben (vgl. Anlage B2/B2a). Eine gleichlautende Erklärung hat die zuständige Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Beklagten, Frau L, abgegeben (vgl. Anlage B1/1a). Dass ein anderer gesetzlicher Vertreter der Beklagten das Versäumnisurteil tatsächlich erhalten hätte, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Der Pförtner ist kein Vertreter oder Bevollmächtigter im Sinne der §§ 170 bis 172 ZPO. Selbst wenn man also annehmen wollte, das Versäumnisurteil vom 21.02.2023 sei dem im Eingangsbereich des Firmengeländes der Beklagten tätigen Pförtner am 23.08.2023 übergeben worden, konnte hierdurch eine wirksame Zustellung nach § 189 ZPO nicht bewirkt werden. Aus diesem Grunde ist auch am 23.08.2023 keine Frist zur Einlegung des Einspruchs in Gang gesetzt worden. -
3.
Die einmonatige Einspruchsfrist nach § 339 Abs. 2 S. 1 ZPO ist somit frühestens mit Kenntniserlangung der Beklagten vom Inhalt des Versäumnisurteils am 24.10.2023 in Gang gesetzt worden. Mithin war die Einspruchsfrist bei Eingang des Einspruchs der Beklagten am 07.11.2023 noch nicht abgelaufen. -
4.
Da die Einspruchsfrist gewahrt worden ist, bedurfte es keiner Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag der Beklagten. Durch den Einspruch wird vielmehr nach § 342 ZPO der Weg zu der auch vom Bundesverfassungsgericht geforderten Sachentscheidung eröffnet (vgl. BGH, NJW 2002, 827, 829; BGH, NJW 2007, 303) und der Prozess in die Lage zurückversetzt, in der er sich vor Eintritt der Säumnis befand. -
III.
Die Berufung führt zur Zurückverweisung an das Landgericht nach § 538 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Grundsätzlich hat das Berufungsgericht zwar die notwendigen Beweise zu erheben und in der Sache selbst zu entscheiden (§ 538 Abs. 1 ZPO). Das Berufungsgericht darf die Sache, soweit ihre weitere Verhandlung erforderlich ist, allerdings unter Aufhebung des Urteils und des Verfahrens an das Gericht des ersten Rechtszuges in den in § 538 Abs. 2 S. 1 ZPO genannten Fällen zurückverweisen, wenn eine Partei die Zurückverweisung beantragt. Dazu gehört insbesondere der Fall, dass durch das angefochtene Urteil ein Einspruch als unzulässig verworfen wird (§ 538 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO). Von dieser Möglichkeit macht der Senat hier Gebrauch.
Die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung liegen vor. Durch das angefochtene Urteil ist ein Einspruch als unzulässig verworfen worden im Sinne von § 538 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO. Auch liegt ein Zurückverweisungsantrag sowohl der Beklagten als auch der Klägerin vor, wobei für eine Zurückverweisung bereits der Antrag einer Partei (des Berufungsklägers oder des Berufungsbeklagten) ausreichen würde. Dass die Beklagte und die Klägerin die Zurückverweisung jeweils nur hilfsweise beantragt haben, ist unschädlich. Denn der erforderliche Zurückverweisungsantrag der Partei kann auch als Hilfsantrag gestellt werden (OLG Koblenz, Urt. v. 31.5.2007 – 5 U 123/07, BeckRS 2007, 9882 mwN; Heßler in Zöller, ZPO, 35. Aufl., § 538 Rn 56; Volk/Cassardt in Cepl/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage 2022, ZPO § 538 Rn 7).
Da sich der Einspruch der Beklagten als zulässig erweist, ist ferner die weitere Verhandlung erforderlich. An der Erforderlichkeit einer weiteren Verhandlung der Sache kann es zwar fehlen, wenn der Rechtsstreit zur Endentscheidung reif ist (OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.01.2019 – 6 U 79/18, BeckRS 2019, 1816 Rn 54). Das ist hier aber nicht der Fall. Aufgrund des fristgerechten Einspruchs ist die weitere Verhandlung zur Sache erforderlich. Die Parteien haben bisher nicht streitig zur Sache verhandelt. Vielmehr ist das Versäumnisurteil gegen die Beklagte im schriftlichen Vorverfahren mangels Anzeige der Verteidigungsbereitschaft der Beklagten ergangen und das Landgericht hat sodann ohne mündliche Verhandlung über die Verwerfung des Einspruchs nach § 341 Abs. 2 ZPO entschieden.
Die Zurückverweisung ist im Streitfall auch sachgerecht, um die erstinstanzliche Verhandlung und Entscheidung zur Sache zu ermöglichen. Dabei kann dahinstehen, ob bei einspruchsverwerfenden Versäumnisurteilen (§ 538 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO) eine Zurückverweisung ohnehin in der Regel angebracht ist, weil die Entscheidungsreife zumeist noch weit entfernt liegen wird (so: Rimmelspacher in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 538 Rn 77; vgl. auch Heßler in Zöller, ZPO, 35. Aufl., § 538 Rn 34: „ist zurückzuverweisen”). Sie ist jedenfalls im vorliegenden Fall angebracht und interessengerecht. Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Beklagte das Klagepatent verletzt. Das Landgericht hat den Einspruch der Beklagten für unzulässig erachtet und sich damit bisher in der Sache über eine bloße Schlüssigkeitsprüfung hinausgehend weder mit der Auslegung des Klagepatents noch mit dessen Verletzung befasst. Insbesondere hat es sich nicht mit der Frage beschäftigt, ob die Beklagte für den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in Deutschland verantwortlich ist. Dies wird das Landgericht nunmehr nachzuholen haben. Eine erstmalige Befassung des Senats mit den sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen erscheint nicht sachgerecht. -
IV.
Einer Entscheidung über die Kosten der Berufung bedarf es nicht; diese ist der neuen Entscheidung durch das Landgericht vorbehalten (OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.01.2019 – 6 U 79/18, BeckRS 2019, 1816 Rn 54; OLG Hamburg, Urt. v. 21.02.2019 – 3 U 35/15, GRUR-RS 2019, 9106 Rn 106; Heßler in Zöller, ZPO, 35. Auflage, § 538 Rn 58; Rimmelspacher in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 538 Rn 81).
Der Ausspruch zur Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10 ZPO. Auch wenn das Urteil selbst keinen vollstreckungsfähigen Inhalt im eigentlichen Sinn hat, weil das angefochtene Urteil gemäß § 717 Abs. 1 ZPO bereits mit der Verkündung des aufhebenden Urteils außer Kraft tritt, ist die Entscheidung für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gemäß §§ 775 Nr. 1, 776 ZPO darf nämlich das Vollstreckungsorgan die Vollstreckung aus dem erstinstanzlichen Urteil erst einstellen und bereits getroffene Vollstreckungsmaßregeln erst aufheben, wenn eine vollstreckbare Ausfertigung vorgelegt wird (OLG München, Urt. v. 18.09.2002 – 27 U 1011/01, juris Rn 75 = NZM 2002, 1032; OLG Karlsruhe, Urt. v. 28.01.2019 – 6 U 79/18, BeckRS 2019, 1816 Rn 54; OLG Hamburg, Urt. v. 21.02.2019 – 3 U 35/15, GRUR-RS 2019,9106 Rn 106; Heßler in Zöller, ZPO, 35. Auflage, § 538 Rn 59; Rimmelspacher in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 538 Rn 81).
Soweit die Klägerin beantragt hat, den Beschluss des 15. Zivilsenats vom 14.03.2024, mit dem dieser die Zwangsvollstreckung aus dem Versäumnisurteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21.02.2023 einstweilen eingestellt hat, aufzuheben, bestand hierzu kein Anlass. Die mit dem vorgenannten Beschluss angeordnete einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung galt nur für die Dauer des Berufungsverfahrens (vgl. BGH, NJW-RR 2011, 705, 706; Ulrici in BeckOK ZPO, 52. Edition, Stand: 01.03.2024, § 719 Rn 12.2); mit der Verkündung dieses Urteils wird der Beschluss ohne weiteres wirkungslos. Aus den oben unter Ziffer II. dargestellten Gründen war der Beschluss vom 14.03.2024 auch nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufzuheben. Der Beklagten bleibt es unbenommen, vor dem Landgericht einen neuen Antrag auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung zu stellen (vgl. Götz in Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Auflage 2020, § 719 Rn 9; Ulrici in BeckOK ZPO, 52. Edition, Stand: 01.03.2024, § 719 Rn 12.2).
Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
Der Streitwert für das Berufungsverfahren ist – entsprechend der erstinstanzlichen Streitwertfestsetzung im Versäumnisurteil vom 21.02.2023 (Bl. 109 LG-Akte) auf 500.000,00 EUR festzusetzen. Maßgeblich ist insofern der volle Streitwert.