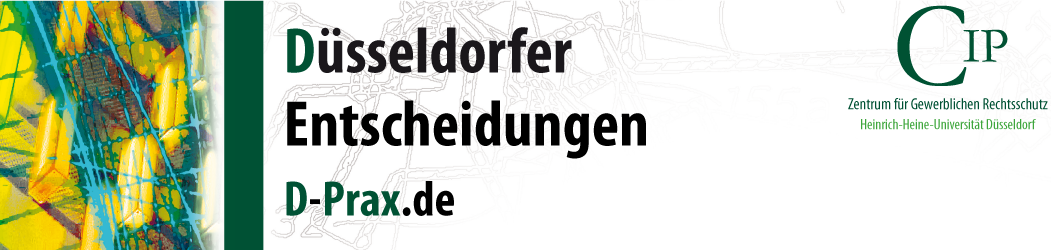Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3351
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 7. Mai 2024, Az. 4a O 3/22
- I. Die Beklagte wird verurteilt,
- 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
- Montageschienen für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses,
- in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
- wenn die Montageschienen einen Montageabschnitt haben, der an seinem ersten Ende einen Spannabschnitt und an seinem dem ersten Ende gegenüber angeordneten zweiten Ende einen Stützabschnitt aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannabschnitt einen Kniehebel aufweist, mit einer Befestigungsseite, über welche der Kniehebel lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt ist, und mit einer Spannseite, die mit der Befestigungsseite einen Winkel einschließt;
- 2. der Klägerin schriftlich Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29. Dezember 2012 begangen hat, und zwar unter Angabe
- (i) der Namen und Anschriften der Lieferanten und anderen Vorbesitzer,
- (ii) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,
- (iii) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,
- wobei zum Nachweis der Angaben die zugehörigen Belege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie mit der Maßgabe vorzulegen sind, dass Daten, auf die sich die geschuldete Auskunft nicht bezieht und hinsichtlich derer ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Beklagten besteht, abgedeckt oder geschwärzt sein können;
- 3. der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis schriftlich darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29. Dezember 2012 begangen hat, und zwar unter Angabe
- (i) der Herstellungsmengen und -zeiten
- (ii) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
- (iii) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
- (iv) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
- (v) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,
- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- 4. die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder im Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gem. Ziffer I. 1. zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;
- 5. die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand auf eigene Kosten aus den Vertriebswegen zurückzurufen, wobei diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, ernsthaft aufgefordert werden, gegen Rückzahlung des bereits gezahlten Kaufpreises und Erstattung der Kosten für die Rückgabe, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben;
- 6. an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 12.681,84 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12.02.2022 zu zahlen.
- II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 29. Dezember 2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- III. Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.
- IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Ziffern I. 1. bis I. 5. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar und hinsichtlich der Ziffern I. 6. und III. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
- Tatbestand
- Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen unmittelbarer wortsinngemäßer Verletzung des Deutschen Patents DE 10 2011 119 XXA B3 (Anlage B&B 5, nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Zahlung von vorgerichtlichen Kosten in Höhe von 12.681,84 Euro nebst Zinsen und Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.
- Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents (vgl. Registerauszug als Anlage B&B 6), welches am 24.11.2011 angemeldet wurde. Das Deutsche Patent- und Markenamt veröffentlichte am 29.11.2012 den Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents. Das Klagepatent steht in Kraft. Es betrifft eine Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses.
- Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet:
- „1. Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses, mit einem Montageabschnitt (1), der an seinem ersten Ende einen Spannabschnitt (2) und an seinem dem ersten Ende gegenüber angeordneten zweiten Ende einen Stützabschnitt (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Spannabschnitt (2) einen Kniehebel (4) aufweist, mit einer Befestigungsseite (4.1), über welche der Kniehebel (4) lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts (1) verschraubt ist, und mit einer Spannseite (4.2), die mit der Befestigungsseite (4.1) einen Winkel einschließt.“
- Zur Veranschaulichung der beanspruchten Lehre werden nachfolgend Figuren 1, 2 und 4 der Klagepatentschrift eingeblendet und beschrieben, welche gem. der Abs. [0015] ff. der Klagepatentschrift zwei unterschiedliche, erfindungsgemäße Ausführungsformen zeigen. Die Figuren 1 und 2 zeigen dieselbe erste Ausführungsform aus verschiedenen Perspektiven:
- Figur 1 zeigt den Montageabschnitt (1) und eine Detailansicht des Spannabschnitts (2) einer ersten Ausführungsform der Erfindung. In Figur 1 grenzt der Spannabschnitt (2) gem. Abs. [0022] der Klagepatentbeschreibung unmittelbar an das erste Ende des Montageabschnitts (1) und umfasst einen Kniehebel (4), mit einer Befestigungsseite (4.1) und einer Spannseite (4.2). Die Spannseite (4.2) und die Befestigungsseite (4.1) schließen einen Winkel alpha ein. Der Montageabschnitt (1) ist gem. Abs. [0022] der Klagepatentbeschreibung in Figur 1 als U-Profil ausgebildet. Die Befestigungsseite (4.1) des Kniehebels (4) ist dabei auf dem freien Ende (1.5) der Umkantung (1.4) schwenkbar gelagert. Die Spannseite (4.2) wird von demjenigen freien Ende des U-Profils gebildet, das von dem Montageabschnitt (1) abgewandt angeordnet ist. Gem. Abs. [0023] der Klagepatentbeschreibung kann die Montageschiene für ihre Montage in einem Schaltschrankgehäuse vorzugsweise mit bereits vormontiertem, jedoch noch nicht fest verschraubtem Kniehebel (4), zwischen der ersten und der zweiten Gehäusewand positioniert werden.
- Nach Abs. [0016], [0024] der Klagepatentbeschreibung zeigt die Figur 2 eine Frontalansicht des Spannabschnitts (2) aus Figur 1.
- Weiter sind in Figur 4 gem. der Abs. [0018] ff. der Klagepatentbeschreibung der Montageabschnitt (1) und der Spannabschnitt (2) in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung abgebildet:
- Bei der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform besteht gem. Abs. [0026] der Klagepatentbeschreibung der Kniehebel (4) aus einem im Wesentlichen rechteckigen Stahlblech, welches parallel zu zwei Blechseiten abgekantet ist. Durch die Abkantung wird zum einen eine Befestigungsseite (4.1) und zum anderen eine Spannseite (4.2) gebildet, wobei diese einen stumpfen Winkel einschließen.
- Die Parteien sind Mitbewerber, u.a. im Bereich von Schaltschränken. Die Klägerin ist ein 1961 gegründeter deutscher Systemanbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software & Service, deren Lösungen in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Die Beklagte ist seit 2019 Teil des Unternehmens „B“, welches auf Verbindungs- und Schutzlösungen im Bereich Elektrik spezialisiert ist.
- Die Klägerin mahnte die Beklagte mit rechts- sowie patentanwaltlichem Schreiben vom 04.10.2021 ab (Anlage B&B1) und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf, welche die Beklagte in der sich anschließenden Korrespondenz nicht abgab.
- Die Beklagte stellt her und bietet auf ihrer deutschsprachigen Website (www.C.com), über die man der Beklagten diesbezüglich eine Angebotsanfrage schicken kann, eine Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses unter der Modellbezeichnung „D“, mit den Artikelnummern E, F, G, H (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen) inländischen Kunden zum Kauf an. Die Produkte hinter den verschiedenen Artikelnummern variieren lediglich bezüglich der Tiefe des Innenprofils und weisen im Übrigen die gleichen Eigenschaften auf, wie sich auch aus den zur jeweiligen angegriffenen Ausführungsform auf der Website der Beklagten zum Download angebotenen identischen Dokumenten (Produktdatenblatt, Bild und Montageanleitung) ergibt. Die angegriffenen Ausführungsformen werden von der Beklagten auch über Drittanbieter, z.B. über „www.I.de“, deutschsprachig angeboten (Anlage B&B 10).
- Auf der Website der Beklagten wird eine angegriffene Ausführungsform (E) in verbautem Zustand, wie nachfolgend eingeblendet, gezeigt (Anlagen B&B 11 und 12),
- sowie in einer von der Beklagten zum Download angebotenen Montageanleitung (Anlage B&B 13) u.a. wie folgt abgebildet:
- Ein Bauteil der angegriffenen Ausführungsformen ist jeweils ein U-förmiges Element, welches an seiner äußeren Seite über zwei kleine Vorsprünge verfügt und in einem aus der Montageschiene herausgelösten Zustand nachfolgend eingeblendet wird, wobei die Abbildungen Seite 13 f. der Klageerwiderung entstammen:
- In die Montageschiene eingesetzt stellt sich jenes U-förmige Element wie folgt dar, wobei die Bezeichnungen von der Beklagten stammen:
- Die Klägerin erwarb zudem ein Muster einer angegriffenen Ausführungsform (G) und reichte dieses als Anlage B&B 9 zur Gerichtsakte.
- Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte mache durch das Herstellen und Anbieten der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Es seien sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 unmittelbar verwirklicht.
- Insbesondere werde das Merkmal, wonach der Spannabschnitt einen Kniehebel aufweise, durch die angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht.
- Ein Kniehebel könne klagepatentgemäß ein einfach gekantetes Blechteil oder ein doppelt gekantetes, U-förmiges Blechteil mit parallelen trapenzförmigen Flanschen sein. Es bedürfe nur irgendeines Bauteils, das zwei unter einem Winkel zueinander angeordnete Seiten aufweise, von denen eine erste für die Befestigung des Bauteils an der Innenausbauschiene und eine zweite für die Verspannung des Bauteils und der daran befestigten Schiene gegenüber einem Objekt, beispielsweise einer Schaltschrankwand, geeignet seien. Die Befestigungs- und Spannseite seien jeweils als Abkantung ausgestaltet. Eine einzige Abkantung reiche aus, um einen erfindungsgemäßen Kniehebel herzustellen. Ein Kniehebel müsse selbst nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht aus zwei unterschiedlichen Bauteilen bestehen, insbesondere nicht aus zwei Armen; ebenso wenig setze der klagepatentgemäße Kniehebel zwei Arme voraus. Ein klagepatentgemäßer Kniehebel sei sogar bevorzugt einstückig ausgebildet.
- Der klagepatentgemäße Kniehebel der angegriffenen Ausführungsformen sei das U-förmige Teil mit den parallelen Flanschen, welches über eine Befestigungsseite an der Schiene um eine (Torxschrauben-)Achse verschwenkbar festgelegt sei, wie die Klägerin durch eine rote Umrandung nachfolgend kenntlich gemacht hat:
- Selbst wenn man – wie die Beklagte – von der Notwendigkeit des Vorliegens zweier Arme für einen klagepatentgemäßen Kniehebel ausgehen wollte, lägen diese bei den angegriffenen Ausführungsformen vor, da nicht ersichtlich sei, wieso nach der Abkantung bei den angegriffenen Ausführungsformen kein neuer Arm beginnen solle.
- Der nach Ansicht der Klägerin vorhandene Kniehebel der angegriffenen Ausführungsformen weise ebenfalls eine Befestigungsseite auf, über welche er lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt sei.
- Dabei bedeute „lösbar“ im Sinne des Klagepatents lediglich, dass die Möglichkeit der Lösung der Spannkraft bestehe. Die Schraube könne weiter in die Montageschiene hinein und wieder hinaus geschraubt werden und damit die Spannkraft variieren. Für die Verwirklichung dieses Merkmales sei nur erforderlich, dass die Schraube für die Bereitstellung einer Spannkraft am Spannabschnitt bewegt werden könne. Der Kniehebel müsse nicht vollständig von der Schiene entfernt werden können.
- Die Befestigungsseite sei das relativ zum Montageabschnitt verschwenkbare Bauteil des Kniehebels, in welches durch ein Langloch in dem Montageabschnitt hindurch eine weitere (Torx-)Schraube eingeschraubt sei, wie nachfolgend von der Klägerin beschriftet wurde:
- Über die im rechten Bild dargestellte weitere (mittige) Torxschraube finde die erforderliche lösbare Verschraubung statt. Sie erfülle die vorgegebene Funktion. Bei den angegriffenen Ausführungsformen bewegten sich – wie von der Beklagten selbst in der Klageerwiderung dargestellt – durch Anziehen der durch ein Langloch eingeführten Schraube (weitere Torxschraube) die Vorsprünge der unteren Basis des U-förmigen Elements in Richtung der Gehäusewand, wodurch Spannkraft bereitgestellt werde. Die (mittige) weitere Torxschraube sei gerade zum Lösen der Spannkraft und damit zum Lösen der Schiene vom Schaltschrankgehäuse geeignet.
- Auch die beiden (seitlichen) Torxschrauben, mit denen der Kniehebel der angegriffenen Ausführungsformen an der Montageschiene verschraubt sei, änderten nichts an dem Vorliegen einer lösbaren Verschraubung.
- Überdies werde das Merkmal, wonach ein Kniehebel eine Spannseite aufweist, die mit der Befestigungsseite einen Winkel einschließt, durch die angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht.
- Die klagepatentgemäße Spannseite sei dabei der Teil des Kniehebels, der mit der Schrankwand verbunden werde. Das Klagepatent erfordere lediglich eine Verbindung der Montageschiene mit der Schrankinnenwand über die Spannseite. Ein Verspannen bzw. ein Verklemmen sei dafür ausreichend. Eine flächige Anpassung sei nicht erforderlich. So beschreibe auch das Klagepatent in Abs. [0026] eine Verbindung der Montageschiene mit der Schrankwand mittels Krallen. Eine Verbindung einer Montageschiene mit der Schrankwand (nur) über Krallen sei daher unschädlich.
- Ausweislich der Montageanleitung der angegriffenen Ausführungsformen sei die Spannseite des Kniehebels unter einem Winkel zu der Befestigungsseite angeordnet. Bei den angegriffenen Ausführungsformen stellten die Krallen des U-förmigen Bauteils die Spannseite bzw. einen Bestandteil der Spannseite dar. Für das Vorhandensein einer klagepatentgemäßen Spannseite verweist die Klägerin zudem auf die in der mündlichen Verhandlung als Anlage zum Sitzungsprotokoll gereichte von ihr kolorierte und beschriftete Abbildung des U-förmigen Bauteils der angegriffenen Ausführungsformen. Erfindungsgemäß werde bei den angegriffenen Ausführungsformen die Montageschiene mit der Schrankwand verklemmt, wobei es sich um die Bereitstellung einer Haltekraft für die Halterung der Schiene am Gehäuse durch Anziehen der Schraubverbindung zwischen Kniehebel und Montageabschnitt handele, wobei die Spannkraft durch elastische Verformung des Stützabschnitts und des Spannabschnitts aufgenommen werde. Unerheblich sei, dass nach dem Vortrag der Beklagten die Stirnseite der beiden Schenkel nicht mit der Innenseite des Schaltschrankes in Kontakt trete.
- Ferner sei der geltend gemachte Rückrufanspruch nicht unverhältnismäßig. Dazu bestreitet die Klägerin mit Nichtwissen, dass ein Rückbau der bereits verbauten Montageschienen besonders aufwändig wäre, zur Beschädigung der Schaltschränke führen könne und deren Gehäuse nicht weiter eingesetzt werden könnten. Nur in extremen Ausnahmefällen sei denkbar, dass ein Anspruch auf Rückruf unverhältnismäßig und ausgeschlossen sein solle, wozu die Behauptungen der Beklagten zu pauschal seien.
- Die Klägerin meint, ihr stehe auch ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die berechtigte Abmahnung der Beklagten zu.
- Ursprünglich hat die Klägerin Auskunft und Rechnungslegung auch in elektronischer Form sowie Zinsen auf die Kosten für das Abmahnschreiben in Höhe von neun Prozentpunkten beantragt.
- Der Klägerin beantragt nunmehr,
- – wie erkannt –
- Hilfsweise, für den Fall ihres Unterliegens, beantragt die Klägerin,
- es ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung (Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen Bank oder Sparkasse) abzuwenden.
- Die Beklagte beantragt,
- die Klage abzuweisen.
- Die Beklagte meint, die geltend gemachten Ansprüche stünden der Klägerin nicht zu.
- Sie ist der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten die Lehre des Klagepatents nicht. Es fehle ihnen an einem klagepatentgemäßen Kniehebel, an einer lösbaren Verschraubung des Kniehebels an dem ersten Ende des Montageabschnitts sowie an einer klagepatentgemäßen Spannseite und damit an allen Merkmalen des kennzeichnenden Teils des geltend gemachten Klagepatentanspruchs.
- Zunächst weise der Spannabschnitt der angegriffenen Ausführungsformen keinen klagepatentgemäßen Kniehebel auf.
- Ein klagepatentgemäßer Kniehebel müsse – vermittels der Spannseite – in jedem Fall Spannkraft ausüben können, auch wenn er entgegen des üblichen Sprachgebrauchs von „Kniehebel“ keine Konstruktion mit einem gelenkigen Knie aufweise. Der Kniehebel könne zwar nach Abs. [0009] des Klagepatents auch einstückig ausgebildet sein, aber müsse nach seiner Funktion so ausgelegt werden, dass ein einstückiger Winkel mit zwei Seiten bzw. Schenkeln nur ausreiche, soweit die eine Seite spanne und die andere Seite unter Ausnutzung dieser Spannkraft befestige. Auch ein einstückiger Kniehebel müsse eine kniehebelgemäße Spannkraft ausüben. Klagepatentgemäß werde mittels der Abkantung die Kraft, die auf die Befestigungsseite durch Anziehen der Schraube aufgebracht werde, auf die Spannseite übertragen; die Spannseite übe sodann eine Spannkraft aus.
- Der Kniehebel verfüge zur Erfüllung seiner Funktion selbst bei einfachster Ausführung stets über zwei (starr miteinander verbundene) Arme, die an der Stelle, an der sie miteinander verbunden seien (am „Knie“), verschwenkbar gelagert seien. Nach dem Klagepatent erfolge die Kraftübertragung nicht, wie sonst bei gewöhnlichen Kniehebeln des Sprachgebrauchs üblich, über ein Gelenk, sondern über eine Schwenkachse, wie sich aus Abs. [0008] und [0023] der Klagepatentschrift ergebe. Daher müsse ein Kniehebel zumindest schwenkbar gelagert sein, wobei die schwenkbare Lagerung zwischen Befestigungsseite und Spannseite erfolgen müsse, denn nur so könne eine kniehebelvergleichbare Spannkraft ausgeübt werden. Entscheidend sei die Hebelwirkung. Die Beklagte hat dies wie nachfolgend auf Basis der Figur 1 des Klagepatents koloriert dargestellt, wobei der erste Arm (blau) die Spannseite umfasse und der zweite Arm (rot) durch einen Abschnitt der Befestigungsseite gebildet werde:
- Der zweite Arm (rot) sei erforderlich, um mittels der Schraube die gewünschte Spannkraft zu erzeugen.
- Einen klagepatentgemäßen Kniehebel wiesen die angegriffenen Ausführungsformen nicht auf, denn sie könnten keine Spannkraft erzeugen. Das U-förmige Bauteil der angegriffenen Ausführungsformen sei nicht zwischen Befestigungs- und Spannseite über ein Knie schwenkbar gelagert, sondern das Verschwenken des Bauteils, welches angeblich der Kniehebel sein solle, erfolge bei den angegriffenen Ausführungsformen nur an seinem einen Ende, so dass der eine Arm des Bauteils nicht in der Lage sei, eine Spannkraft kniehebelgemäß auszuüben, wie von der Beklagten nachfolgend in der Skizze einer angegriffenen Ausführungsform in Blau koloriert dargestellt:
- Das Gelenk sei am Ende des verdrehbaren Elements und nicht am „Knie“ angeordnet, so dass keine Spannkraft ausgeübt werden könne. Das verdrehbare Element verfüge damit auch folglich nicht über die zwei Arme.
- Auch das Merkmal, wonach der Kniehebel eine Befestigungsseite aufweist, über welche er lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt ist, zeigten die angegriffenen Ausführungsformen nicht.
- Die lösbare Verschraubung sei dahingehend zu verstehen, dass – wie in den Figuren 1 und 4 des Klagepatents gezeigt – der Kniehebel auf der Montagschiene nur durch eine lösbare Schraube (9) befestigt sei. Werde diese Schraube vollständig gelöst, werde auch die Verbindung zwischen Kniehebel und Montageschiene klagepatentgemäß vollständig aufgehoben. Eine zusätzliche, dauerhafte Befestigung des Kniehebels am ersten Ende des Montageabschnitts sei dagegen in der Klagepatentschrift nicht vorgesehen. Das Klagepatent sei auf eine räumlich platzsparende und technisch vereinfachte Befestigung der Schiene gerichtet. Wenn das Klagepatent also die lösbare Verbindung behandele, befasse es sich nur mit der Montage der Schiene, nicht aber mit der Demontage der Schiene oder der Aufhebung der Spannkraft.
- Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen keine lösbare Verbindung in diesem Sinne auf. Ihr U-förmiges Element sei durch die beiden (seitlichen) Torxschrauben dauerhaft mit dem seitlichen ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt. Diese beidseitige Verschraubung sei nicht dazu vorgesehen, gelöst zu werden.
- Durch Anziehen der (mittigen) Schraube, welche durch ein Langloch eingeführt werden könne, bewegten sich die Vorsprünge der unteren Basis des U-förmigen Elements in Richtung der Gehäusewand. Eine „lösbar verschraubte“ Verbindung im Sinne des Klagepatents liege indessen nicht vor, da stets die zwei Torxschrauben das U-förmige Element mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt hielten. Die (mittige) Schraube der angegriffenen Ausführungsformen könne auch keine Spannkraft erzeugen, weswegen auch dann keine lösbare Verschraubung gegeben wäre, wenn man bei dieser auf das Lösen der Spannkraft durch Lockern der Schraube abstellen würde.
- Es mangele den angegriffenen Ausführungsformen auch an einer klagepatentgemäßen Spannseite, die mit der Befestigungsseite einen Winkel einschließt.
- Die Beklagte meint, das Klagepatent unterscheide zwei Ausgestaltungen patentgemäßer Spannseiten, die beide dasselbe Wirkprinzip des Spannens offenbarten. Zum einen sei die Spannseite eine Fläche, die gegen die Innenseite des Schaltschrankgehäuses verspannt werde, nämlich nach Abs. [0009] des Klagepatents. Zum anderen bildeten bei einem als U-Profil ausgebildeten Kniehebel die freien Enden der parallelen Schenkel des U-Profils die Spannseite, indem sie beim Anziehen der Schraube (9) die Montageschiene gegen das Schaltschrankgehäuse verspannten, wobei die Spannseite an ihrem von dem Montageabschnitt abgewandten Ende mindestens eine Kralle aufweisen könne. Dies sei u.a. Abs. [0010] und [0011] des Klagepatents zu entnehmen. Die Beklagte hat Figur 2 des Klagepatents entsprechend koloriert:
- Nach der Lehre des Klagepatents müsse zum Spannen der Montageschiene gerade eine Spannkraft über den Kniehebel ausgeübt werden. Dies übergehe die Klägerin vollständig. Die Befestigung der Montageschiene solle gerade nicht durch ein bloßes Verklemmen ohne die durch einen Kniehebel bewirkte Spannkraft erreicht werden. Die vom Kniehebel auf die Spannseite auszuübende Spannkraft müsse unabhängig von ggfs. zusätzlich vorgesehenen Krallen ausgeübt werden, wozu die Beklagte auf Abs. [0023] und [0026] der Klagepatentschrift verweist. Eine klagepatentgemäße Spannseite könne zwar Krallen aufweisen, werde jedoch nicht nur aus diesen gebildet. Die Krallen könnten die wirksame Fixierung der Montageschiene verbessern, aber seien nach der klagepatentgemäßen Lehre nicht erforderlich. Unabhängig von den Berührungspunkten der Spannseite und der Gehäusewand sei zwingend, dass dieser Kontakt über die vom Kniehebel ausgeübte Spannkraft bewirkt werde.
- Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen mangels Übertragung einer Spannkraft auf ihre Stirnseite keine Spannseite auf, über welche die Montagschiene in dem Schaltschrankgehäuse mittels Spannkraft fixiert werde. Die Beklagte verweist u.a. auf die nachfolgend eingeblendeten Ablichtungen der angegriffenen Ausführungsformen:
- Hierzu erläutert sie, die Stirnseiten der beiden Schenkel des U-förmigen Elements seien im Vergleich zur Stirnseite der Basis stets und in jedem Einbauzustand zurückversetzt, so dass diese seitlichen Stirnseiten konstruktionsbedingt niemals mit der Innenseite des Schaltschranks in Kontakt träten und somit auch keine Spannkraft ausüben oder Fixierung bewirken könnten. Allein die zusätzlichen Vorsprünge, die an der Stirnseite der Basis des U-förmigen Profils ausgebildet seien, grüben sich in die Schrankinnenwand. Die in der oben eingeblendeten Abbildung als Basis bezeichnete Unterseite des U-Profils sei lediglich diejenige Seite des U-förmigen Elements, mittels derer das U-förmige Element an der Montageschiene befestigt werde, ohne dass jedoch ein Kniehebel oder Spannkraft zum Einsatz kämen. Stattdessen bewege sich durch Anziehen der Schraube die Stirnseite der Basis auf das Montageprofil zu und gleichzeitig (bedingt durch die Verortung der Schwenkachse) in Richtung Schrankinnenwand, wo sich die Krallen vergraben würden. Es werde nichts verspannt, sondern nur eine Seite eines U-förmigen Elements mittels der Schraube verklemmt. Mithin trage der gesamte obere Teil des U-förmigen Elements (die beiden parallelen Schenkel des U-Profils) nicht zum Spannen bei. Lediglich die beiden Vorsprünge der (unteren) Basis des U-förmigen Elements arretierten tatsächlich die Montageschiene in dem Schaltschrankgehäuse. Dort werde jedoch keine Spannkraft erzeugt.
- Überdies wäre ein etwaiger Rückruf bereits verbauter Montageschienen unverhältnismäßig, da dieser den Rückbau der verbauten angegriffenen Ausführungsformen aus den Schaltschrankgehäusen erfordere. Über die Vorsprünge an ihren beiden Enden seien die Montageschienen in den Innenwänden der Schaltschrankgehäuse arretiert, wodurch Arretierungslöcher entstünden. Durch diese Beschädigung der Innenwände der Schaltschränke würde eine nach dem Rückbau erforderliche sichere Neumontage erschwert. Der Rückbau wäre zudem aufwändig und erfordere ggfs. geschultes Fachpersonal, da Schaltschränke elektrische und elektronische Komponenten enthielten, die zunächst ausgebaut werden und nach Austausch der Montageschienen wieder installiert werden müssten. Der Ausbau könne auch zur Beschädigung der Schaltschrankgehäuse führen. Durch den aufwändigen Ausbauvorgang wären die Schaltschränke vorübergehend für die Abnehmer nicht nutzbar. Dies führe zu einem Imageschaden für die Beklagte, der in keinem Verhältnis zur geringen Relevanz der – nur einen kleinen Teil eines gesamten Schaltschranks darstellenden – Montageschienen für den Abnehmer stehen würde. Der vermeintliche Schaden für die Klägerin sei demgegenüber nur gering. Die Klägerin könne sich hinsichtlich der Unverhältnismäßigkeit des Rückbaus nicht auf ein Bestreiten mit Nichtwissen beschränken, da sie selbst Montageschienen vertreibe und daher die Problemkreise beim Ausbau kenne.
- Für die Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die ausgetauschten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 19.03.2024 verwiesen.
- Entscheidungsgründe
- Die Klage ist zulässig und begründet.
- Die Beklagte verletzt durch das Angebot der angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen die Lehre des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß (hierzu unter I.). Der Klägerin stehen gegen die Beklagte wegen des Herstellens und des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Erstattung der Abmahnkosten gem. §§ 139, 140a, 140b PatG i. V. m. §§ 242, 259 BGB sowie §§ 683 Abs. 1, 677, 670 BGB zu (hierzu unter II.).
-
I.
Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der Lehre des Anspruchs 1 des Klagepatents unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. -
1.
Das Klagepatent, dessen in Anlage B&B 5 eingereichter Patentschrift die nachfolgend ohne Quellenangaben zitierten Absätze entstammen, betrifft gem. Abs. [0001] eine Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses mit einem Montageabschnitt, der an seinem ersten Ende einen Spannabschnitt und an seinem dem ersten Ende gegenüber angeordneten zweiten Ende einen Stützabschnitt aufweist. -
a)
Das Klagepatent benennt in Abs. [0002] eine gattungsgemäße Montageschiene gemäß der DE 10 2008 052 XXC A1 sowie weitere Innenausbauschienen gemäß der DE 197 37 XXD C2, der DE 196 47 XXE C1 und der DE 298 06 XXE U1 als bekannt. Die drei zuletzt genannten beschreibt das Klagepatent nicht näher. Das Klagepatent schildert, dass bei der zuerst genannten DE 10 2008 052 XXC A1 der Stützabschnitt dazu ausgebildet ist, sich an der Rückwand des Schaltschrankgehäuses abzustützen, wobei der Spannabschnitt mittels Spannmitteln im Bereich der Vorderseite des Schaltschrankgehäuses verspannbar ist. Für das Verspannen weist der Spannabschnitt einen zur Vorderseite des Schaltschrankgehäuses gerichteten Schenkel auf, der an den Montageabschnitt angeschlossen ist, sowie eine Abwinklung, die im Winkel zum Schenkel orientiert ist, wobei die Abwinklung mindestens ein Stellglied aufweist, welches zumindest bereichsweise eine Spannfläche ausbildet. Laut des Klagepatents weist die Abwinklung eine Bohrung auf, die mit einer Gewindeaufnahme einer Schweißmutter fluchtet, die auf der der Spannfläche abgewandten Seite der Abwinklung aufgeschweißt ist. Das Klagepatent schildert schließlich, dass als Spannmittel eine Schraube vorgesehen ist, die in die Schweißmutter einbringbar ist und über welche auf die Rückseite der Spannfläche eine Spannkraft ausgeübt werden kann. -
b)
Aus Sicht des Klagepatents weist die vorbeschriebene Montageschiene drei Nachteile gem. Abs. [0003] auf. Erstens sei sie vergleichsweise umständlich in dem Schaltschrankgehäuse zu montieren, weil für die Betätigung der Spannschrauben der Spannabschnitt mit einem entsprechenden Werkzeug, beispielsweise einem Inbus- Schlüssel, hintergriffen werden muss. Denn für eine ausreichende Fixierung der Montageschiene in dem Schaltschrankgehäuse sind dabei laut des Klagepatents zwei Spannschrauben notwendig. Diese müssen bei der Befestigung der Montageschiene in dem Schaltschrankgehäuse gleichzeitig, d.h. schrittweise abwechselnd, angezogen werden, um ein Verkanten der Montageschiene in dem Schaltschrankgehäuse zu vermeiden. Zweitens nimmt der Spannabschnitt laut der Klagepatentbeschreibung viel Platz in Anspruch, wodurch die nutzbare Länge des Montageabschnitts begrenzt wird. Drittens ist die dem Stand der Technik bekannte Montageschiene gem. Abs. [0003] aufwändig in der Herstellung, da sie einer Vielzahl von Abkantungen bedarf. -
c)
Das Klagepatent beschreibt es ausgehend hiervon in Abs. [0004] als seine Aufgabe, eine gattungsgemäße Montageschiene vorzuschlagen, die einfach in ein Schaltschrankgehäuse zu montieren ist, die eine große nutzbare Länge des Montageabschnitts aufweist, die sich einfacher technischer Mittel bedient und die mit geringem Aufwand herstellbar ist. -
2.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung in Form einer Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses gemäß seines Anspruchs 1 vor. Dieser lässt sich anhand der folgenden Merkmalsgliederung darstellen: - 1. Montageschiene für den Innenausbau eines Schaltschrankgehäuses
- 2. Die Montageschiene weist einen Montageabschnitt (1) auf.
- 2.1. Der Montageabschnitt (1) weist an seinem ersten Ende einen Spannabschnitt (2) auf.
- 2.2. Der Montageabschnitt (1) weist an seinem dem ersten Ende gegenüber angeordneten zweiten Ende einen Stützabschnitt (3) auf.
- 3. Der Spannabschnitt (2) weist einen Kniehebel (4) auf.
- 3.1. Der Kniehebel (4) weist eine Befestigungsseite (4.1) auf, über welche der Kniehebel (4) lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts (1) verschraubt ist.
- 3.2. Der Kniehebel (4) weist weiter eine Spannseite (4.2) auf, die mit der Befestigungsseite (4.1) einen Winkel einschließt.
-
3.
Vor dem Hintergrund des Streits der Parteien bedarf von den Merkmalen des geltend gemachten Anspruchs des Klagepatents die Auslegung der gesamten Merkmalsgruppe 3 der Erörterung. Alle anderen Merkmale des geltend gemachten Anspruchs sind zu Recht zwischen den Parteien unstreitig, so dass es weiterer Ausführungen hierzu nicht bedarf. -
a)
Ein klagepatentgemäßer Kniehebel kann ein ein- oder mehrstückiges Bauteil sein, das unter einem Winkel zueinander angeordnete Spann- und Befestigungsseiten aufweisen muss, wobei die Spannseite bei der Montage mit einer Seite eines Schrankinnengehäuses in Kontakt ist und über die Befestigungsseite der Kniehebel mit dem ersten Ende der Montageseite verschraubt ist. In räumlich-körperlicher Hinsicht erfordert das Klagepatent keine weiteren als die im Anspruch genannten Eigenschaften. Wegen der Einzelheiten zur Befestigungs- und Spannseite wird auf die noch folgende Auslegung zu Merkmalen 3.1 und 3.2 verwiesen. In funktionaler Hinsicht hat ein erfindungsgemäßer Kniehebel ein Verspannen der Montageschiene im Sinne einer Fixierung durch Verklemmung zwischen zwei Schrankinnenwänden zu leisten. -
aa)
Der geltend gemachte Anspruch gibt hinsichtlich der räumlich-körperlichen Eigenschaften des Kniehebels gemäß Merkmalsgruppe 3 vor, dass der Kniehebel sich am Spannabschnitt, der am ersten Ende des Montageabschnitts der Montageschiene liegt, befinden muss und eine Befestigungs- sowie eine Spannseite aufweist. Weiterhin muss der Kniehebel mit seinen beiden Seiten (Spann- und Befestigungsseite) einen Winkel einschließen (vgl. Merkmal 3.2). Der Winkel muss gem. Abs. [0006] lediglich größer als 0 Grad und kleiner als 180 Grad sein. Weiterhin muss der Kniehebel über seine Befestigungsseite lösbar mit dem ersten Ende des Montagabschnitts verschraubt werden können (Merkmal 3.1). -
bb)
Vorliegend kann nicht auf eine übliche Definition eines Kniehebels aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, wonach dieser – jedenfalls nach dem Vortrag der Beklagten – aus zwei miteinander gelenkig verbundenen Hebelelementen besteht, zurückgegriffen werden. Eine Patentschrift stellt im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe ihr eigenes Lexikon dar (BGH, GRUR 1999, 909, 911 – Spannschraube; BGH, GRUR 2005, 754, 755 – werkstoffeinstückig; BGH, GRUR 2015, 875, 876 – Rotorelemente; BGH GRUR 2016, 361, 362 – Fugenband). Selbst gebräuchliche Fachbegriffe dürfen niemals unbesehen der Auslegung eines technischen Schutzrechts zugrunde gelegt werden. Die Merkmale eines Schutzanspruchs sind nicht anhand der Definition in Fachbüchern oder dergleichen auszulegen, sondern es ist das fachmännische Verständnis anhand der Beschreibung des Schutzrechts selbst zu ermitteln (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.10.2015, Az. I-15 U 25/14, S. 15). - Nach diesen Maßgaben weicht das klagepatentgemäße Verständnis eines Kniehebels von dem üblichen Sprachgebrauch ab. Ein klagepatengemäßer Kniehebel ist nicht auf eine Ausführungsform beschränkt und erfordert insbesondere kein gelenkiges, Hebelwirkung erzeugendes Knie. Er kann verschiedene Eigenschaften aufweisen und gem. Abs. [0009] sowie der Figur 4 (bevorzugt) sogar einstückig ausgebildet sein und aus zwei Abkantungen bestehen, die durch einen Winkel miteinander starr verbunden sind. Er kann ebenso gem. Abs. [0010] sowie Figuren 1 und 2 als U-Profil ausgebildet sein, welches parallele Flansche aufweist, die trapezförmig ausgebildet sind. Ob das U-profilförmige Bauteil ein- oder mehrstückig sein soll, ist nicht ausgeführt. In jeder Ausführungsform weist der klagepatentgemäße Kniehebel in Verbindung mit den Merkmalen 3.1 und 3.2 des geltend gemachten Anspruchs jedenfalls zwei Seiten auf, nämlich Befestigungs- und Spannseite, die einen Winkel einschließen. Miteinander gelenkig (über ein Knie) verbundene Hebelelemente, wie sie etwa ein Kniehebel nach üblicher Definition kennt, sieht das Klagepatent für einen erfindungsgemäßen Kniehebel nicht vor, wie etwa aus den erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen gemäß der Figuren hervorgeht.
-
cc)
Funktional erfordert das Klagepatent aus Sicht des Fachmanns, dass der Kniehebel ein Verspannen der Montageschiene zwischen den Innenwänden des Schrankgehäuses leistet. Hierfür reicht es erfindungsgemäß aus, wenn durch Betätigung der Schraube an der Befestigungsseite bewirkt wird, dass die Spannseite einen Kontakt zum Schrankinnengehäuse herstellen kann und so die Montageschiene fixiert bzw. eingeklemmt wird. Für Details hinsichtlich der Spannseite wird auf die Ausführungen zu Merkmal 3.2 verwiesen. Ein klagepatentgemäßer Kniehebel erfordert in funktionaler Hinsicht weder eine Verschwenkung, noch die Ausnutzung von Hebelwirkung zum Verspannen. -
(1)
Bei der Auslegung ist auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt. Merkmale und Begriffe in der Patentschrift sind grundsätzlich so auszulegen, wie dies angesichts der ihnen nach dem offenbarten Erfindungsgedanken zugedachten technischen Funktion angemessen ist (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; BGH, GRUR 2009, 655 – Trägerplatte). Dabei ist zu fragen, welche objektive Problemstellung dem technischen Schutzrecht zugrunde liegt und wie sie gelöst werden soll. Insbesondere kommt es darauf an, welche – nicht nur bevorzugten, sondern zwingenden – Vorteile mit dem Merkmal erzielt und welche Nachteile des vorbekannten Standes der Technik – nicht nur bevorzugt, sondern zwingend – mit dem Merkmal beseitigt werden sollen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2000, 599 – Staubsaugerfilter; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.07.2014 – I-15 U 29/14). Das Verständnis des Fachmanns wird sich entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck eines bestimmten Merkmals orientieren (BGH, GRUR 2001, 232 – Brieflocher; OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015 – I-15 U 106/14, Rn. 273). -
(2)
Nach dieser Maßgabe erkennt der Fachmann, dass funktional ein Verspannen der Montageschiene zwischen den Schrankinnenwänden erforderlich ist sowie, dass durch die Nutzung des Kniehebels – auch wenn dies im Anspruch nicht erwähnt ist – ein Verspannen bewirkt werden soll. Dass ein Verspannen gerade durch den Kniehebel stattfinden soll, versteht der Fachmann etwa aus der Beschreibung der Aufgabe des Klagepatents, aus der Formulierung „Spannseite“ sowie aus verschiedenen Stellen der Beschreibung, etwa aus Abs. [0009] a.E. („beim Verspannen des Kniehebels“). - Von „Spannkraft“ ist wörtlich nur in der Darstellung des Stands der Technik in Abs. [0002] die Rede, wo als Spannmittel eine Schraube vorgesehen, die in eine Schweißmutter einbringbar ist und über welche auf die Rückseite der Spannfläche eine Spannkraft ausgeübt werden kann. Aus der Aufgabe des Klagepatents, eine in Abs. [0002] beschriebene, aus Sicht des Klagepatents gattungsgemäße, Montageschiene hinsichtlich ihrer in Abs. [0003] beschriebenen Nachteile zu verbessern, ergibt sich, dass der Kniehebel grundsätzlich dem Verspannen der Montageschiene zwischen den Seiten des Schaltschrankgehäuses mittels einer Schraube als Spannmittel dient. Der Fachmann erkennt aus der Klagepatentschrift, dass die (stumpfe) Schraube (9) nicht in die Schrankwand gedreht wird, sondern nur Kniehebel und Montageabschnitt verbindet sowie, dass die Montageschiene – zzgl. etwaiger Löcher durch optionale Krallen (s.u.) – nur zwischen Vorder- und Rückseite des Schranks eingeklemmt ist.
- Unter Spannkraft bzw. Verspannen in diesem Zusammenhang versteht der Fachmann mithin aufgrund der Funktion der Montageschiene an sich, dass die Montageschiene zwischen zwei Gehäuseseiten eingespannt und dort zum Halten gebracht werden kann. Hierbei macht es für die erfindungsgemäße Lehre keinen Unterschied, ob die Montageschiene mittels Hebelwirkung verspannt wurde oder verklemmt ist, solange sie durch eine durch Betätigung der Spannschraube ausgeübte Wirkung so positioniert wird bzw. die einzelnen Bauteile sich so bewegen, dass die Schiene eingeklemmt fixiert wird. Das Verspannen erfolgt derart, dass auf der einen Seite der Montageschiene ein Teil der Spannseite mit einer Gehäusewand in Kontakt steht und auf der anderen Seite der Montageschiene diese über einen Stützabschnitt an der gegenüberliegenden Gehäusewand abgestützt wird (vgl. z.B. Abs. [0023] a.E.), so dass am Ende der Montage die Montageschiene zwischen zwei Gehäuseinnenwänden verklemmt ist. Dabei können in einer Ausführungsform gem. Abs. [0011] Krallen für eine besondere Fixierung vorgesehen sein, jedoch sind diese für eine klagepatentgemäße Fixierung nicht zwingend erforderlich (siehe auch unten zu Merkmal 3.2).
-
(3)
Ein Verschwenken sieht der Fachmann in funktionaler Hinsicht nicht als zwingend für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre an. Vielmehr überlässt ihm das Klagepatent, wie ein Verspannen im Einzelfall bewirkt wird. - Zwar zeigen die Ausführungsbeispiele im Zusammenhang mit dem Verspannen jeweils eine Verschwenkung. So soll etwa gem. Abs. [0008], [0023] durch Verschrauben der Schraube der Kniehebel um eine von der Umkantung gebildete Schwenkachse herum verschwenkt werden. Gem. Abs. [0023] wird durch das Anziehen der Schraube (9) die Befestigungsseite (4.1) an die Montageseite (1.1) angenähert, was zur Folge hat, dass der Kniehebel (4) um das freie Ende (1.5) der Umkantung (1.4) verschwenkt wird, wobei mit dem Verschwenken des Kniehebels (4) auch das untere Ende der Spannseite (4.2) in Richtung der Gehäusewand (10) geschwenkt wird. Über die Verschwenkung auf der Umkantung kann eine Hebelkraft ausgelöst werden, vgl. Abs. [0008] (mittig).
- Eine Verschwenkung um eine Umkantung wird gleichwohl von dem geltend gemachten Anspruch 1 nicht zwingend für die Funktion des Verspannens gefordert. Das Klagepatent gibt nicht vor, dass ein Verspannen nur im Wege des Verschwenkens um eine Umkantung erreicht werden kann. In den Anspruch hat eine Verschwenkung keinen Einzug gefunden. Die Ausführungsbeispiele können den weiter gefassten Anspruch insoweit nicht beschränken. Zudem ist es gem. Abs. [0008] (am Anfang) nur bevorzugt, dass das erste Ende des Montagabschnitts eine Umkantung aufweist, um deren Schwenkachse herum der Kniehebel verschwenkt werden kann. Eine solche muss demnach nicht zwingend vorhanden sein. Die Umkantung der Montageschiene hat keinen Niederschlag im Anspruchswort gefunden, wobei insoweit der Vorrang des Anspruchs vor der Beschreibung gilt.
-
dd)
Ein klagepatentgemäßer Kniehebel erfordert weiterhin auch nicht zwei Arme. Zu „Armen“ oder dem Erfordernis von zwei Elementen oder Bauteilen, aus denen der Kniehebel bestehen müsste, macht das Klagepatent keine Vorgabe. Vielmehr kann der Kniehebel gem. Abs. [0009] sogar bevorzugt einstückig ausgebildet sein. Hinsichtlich seiner Funktion sind ebenfalls keine zwei Arme erforderlich, solange ein Verspannen auch anders, z.B. über eine gelenkige Verbindung, erreicht werden kann. -
ee)
Bis auf den Umstand, dass der Kniehebel sich am Spannabschnitt des Montageabschnitts befindet, ist es dem Fachmann überlassen, wie Montageabschnitt und Kniehebel genau zueinander angeordnet sind. Der Anspruch lässt dies offen. Das Klagepatent beschreibt zwar, dass der Kniehebel, wenn er als U-Profil ausgestaltet ist, von außen auf dem Montageabschnitt aufsitzen und zudem mit seiner Innenseite dem Montageabschnitt zugewandt sein kann. Dies ergibt sich aus Abs. [0010], wonach das U-Profil des Kniehebels entlang seiner Innenseite auf dem Montageabschnitt aufgesetzt ist. Hierfür sprechen auch die Figuren, die einen Kniehebel aufweisen. Der Kniehebel ist jeweils auf der Außenseite, d.h. mit der dem Schaltschrank abgewandten Seite, angebracht. Jedoch können Ausführungsbeispiele, um welche es sich bei Abs. [0010] und Figuren 1, 2 handelt, den Anspruch nicht beschränken. Das Klagepatent erläutert in funktionaler Hinsicht zudem nicht, ob es einen Unterschied macht, ob der Kniehebel mit seiner Innen- oder seiner Außenseite der Montageschiene zugewandt ist. Es ist vielmehr vorliegend mit Blick auf die vorstehend erläuterte Funktion des Kniehebels auch von der klagepatentgemäßen Lehre umfasst, wenn der Kniehebel nicht von außen auf dem Montageabschnitt aufsitzt, solange seine Funktion erfüllt wird. -
b)
Das Merkmal 3.1 ist dahingehend auszulegen, dass der Kniehebel lösbar mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt sein muss, wobei es für die Lösbarkeit genügt, wenn über das Lösen der (in die Befestigungsseite gedrehten) Schraube die Fixierung der Montageschiene an den Innenseiten des Schaltschrankgehäuses gelöst werden kann. Nicht erforderlich für eine Lösbarkeit in diesem Sinne ist, dass die Bauteile des Kniehebels und des Montageabschnitts nur durch diese Schraube miteinander verbunden sind und komplett voneinander getrennt werden können. -
aa)
Was „lösbar“ im Rahmen des Merkmals 3.1 bedeutet, gibt der Anspruch nicht ausdrücklich vor. Nach dem Anspruchswortlaut muss nur die Verschraubung auf der Befestigungsseite des Kniehebels, welche den Kniehebel mit dem ersten Ende des Montageabschnitts verschraubt, lösbar ausgestaltet sein. Der Merkmalsteil „lösbar“ ist nur auf die Verschraubung dieser Bauteile bezogen, so dass Schrauben, die sich an anderer Stelle befinden, z.B. nicht an der Befestigungsseite, klagepatentgemäß das Erfordernis der Lösbarkeit nicht erfüllen müssen. Ein anderes Verständnis des Fachmanns ergibt sich auch nicht aus der Klagepatentbeschreibung. Zwar sind den Beschreibungen und den Figuren nur Kniehebel zu entnehmen, die nur eine Verschraubung bzw. Schraube aufweisen. Gleichwohl ist diesem Umstand nicht zwangsläufig zu entnehmen, dass es sich bei der lösbaren Verschraubung gem. Merkmal 3.1 um die einzige Verbindung zwischen Montageabschnitt und Kniehebel handeln darf oder, dass daneben keine weiteren Verschraubungen möglich wären. Zwar sieht es das Klagepatent als nachteilig an, wenn mehr als eine (Spann-)Schraube benötigt wird, siehe Abs. [0003]. Weitere Schrauben, die funktional keine Spannschrauben darstellen, sind jedoch unschädlich. -
bb)
Die Spannschraube bzw. das Anziehen der Spannschraube dient letztlich der Fixierung der Montageschiene im Schaltschrankgehäuse, was sich bereits aus den Erläuterungen des Klagepatents zum Stand der Technik in Abs. [0003] ergibt. Durch Anziehen der Schraube nach Merkmal 3.1 soll das untere Ende der Spannseite (4.2) in Richtung der Gehäusewand (10) geschwenkt werden. Durch das Festziehen der Schraube (9) auf den Kniehebel wird etwa gem. Abs. [0026] Kraft ausgeübt, die auf die Wand des Schrankgehäuses übertragen wird. Durch die lösbare Schraubverbindung muss demnach nicht zwangsläufig ein komplettes Loslösen des Kniehebels von dem Montageabschnitt bzw. der Schiene erreicht werden, sondern die lösbare Verbindung soll in funktionaler Hinsicht ein Lockern oder Fixieren der Montageschiene im Schaltschrank erlauben, vgl. [0023]. -
cc)
Die Befestigungsseite ist klagepatentgemäß diejenige Seite des Kniehebels, über die die Schraube, welche letztlich die Verklemmung auslöst, den Kniehebel mit dem Montageabschnitt verbindet und die sich durch Anziehen der Schraube an die Montageseite annähert, vgl. Abs. [0023]. Als maßgeblich erkennt der Fachmann demnach, dass die Verschraubung über diese Seite erfolgt. -
c)
Die Spannseite ist der Teil des Kniehebels, über den das Verspannen letztlich bewirkt wird und der bei Montage der Montageschiene mit einer Innenwand des Schrankgehäuses in Kontakt tritt. Die Spannseite muss außerdem einen zwischen über 0 und unter 180 Grad liegenden Winkel mit der Befestigungsseite einschließen. Sie kann klagepatentgemäß Krallen – als erfindungsgemäße Teile der Spannseite – aufweisen. Erfindungsgemäß genügt es, wenn der Kontakt zwischen Spannseite und Innengehäuse über die Krallen der Spannseite erfolgt. -
aa)
Der Fachmann entnimmt schon dem Begriff „Spannseite“, dass sie am Verspannen mitwirkt, d.h. dass sie eingespannt wird, und damit mit der (Spann-)Schraube in einem Wirkungszusammenhang steht. Die Spannseite muss funktional erforderlich in eingebautem Zustand die Wand des Schaltschrankgehäuses jedenfalls mit einem Teil von sich berühren, da eine Verklemmung zwischen den Schrankwänden sonst nicht zustande kommen kann. -
bb)
Bei einer Ausführungsform gem. Figur 1, deren Kniehebel als U-Profil ausgebildet ist, wird die Spannseite gem. Abs. [0010], [0022] gerade von demjenigen freien Ende des U-Profils gebildet, das von dem Montageabschnitt abgewandt angeordnet ist. Eine bestimmte Fläche oder Breite muss die Spannseite demnach nicht aufweisen, sondern sie kann auch nur eine Kante oder eine Seite eines flächigen Bauteils sein, solange sie vom Montageabschnitt abgewandt angeordnet ist. Aus der dem Montageabschnitt abgewandten Anordnung in Zusammenschau mit den diese Ausführungsform beschreibenden Figuren (z.B. Figur 1) und der Funktion des Verspannens versteht der Fachmann, dass die Spannseite dem Schrankinnengehäuse zugewandt ist. Bei einer anderen klagepatentgemäßen Ausführungsform kann die Spannseite wiederum eine Fläche darstellen bzw. jedenfalls ein flächiges Bauteil beinhalten. So ergibt sich aus Abs. [0009] und [0026], dass das Ausführungsbeispiel gem. Figur 4 es als anspruchsgemäß wiedergibt, wenn die Spannseite durch eine Abkantung gebildet ist. Auch bei dieser Ausführungsform versteht der Fachmann in Zusammenschau mit Figur 4, dass die Spannseite der Gehäusewand (10) zugewandt ist. Auch aus dem Umstand, dass sich bei dieser Ausführungsform mit flächiger Spannseite gem. Abs. [0009] Krallen der Spannseite beim Verspannen des Kniehebels in das Schrankgehäuse eingraben können (aber nicht müssen), erkennt der Fachmann, dass eine klagepatentgemäße Spannseite der einen Seite der inneren Gehäusewand zugewandt ist und nach Montage mit dieser in Berührung stehen soll. -
cc)
Eine klagepatentgemäße Spannseite kann Krallen aufweisen. Die mit (8) gekennzeichneten Krallen erkennt der Fachmann nicht als gesondertes Bauteil, sondern als anspruchsgemäßen Bestandteil der Spannseite. Dies ergibt sich für den Fachmann aus verschiedenen Stellen der Klagepatentbeschreibung. So erläutert etwa Abs. [0022] in Erläuterung der Figur 1, dass die Spannseite an ihrem Ende Krallen „aufweist“. Weiterhin lehrt Abs. [0023], dass am unteren Ende der Spannseite Krallen vorgesehen sind. Ebenso lehrt Abs. [0024], dass „die Krallen an der Spannseite“ zu erkennen sind. Weiterhin entnimmt der Fachmann auch den Figuren gerade nicht, dass eine bauteilige Trennung zwischen den Krallen und der Spannseite vorhanden oder erforderlich wäre; eher ist das Gegenteil der Fall. - Weiterhin genügt es gem. Abs. [0026] jedenfalls für die Ausführungsform, bei der der Kniehebel einstückig ausgebildet ist, dass eine erfindungsgemäße Spannseite beim Verspannen der Montageschiene sogar im Wesentlichen ausschließlich über ihre Krallen (8) mit der Gehäusewand (10) in Kontakt tritt, so dass die gesamte durch das Festziehen der Schraube (9) auf den Kniehebel ausgeübte Kraft über die spitzen Krallen (8) auf die Gehäusewand (10) übertragen wird. In einer Ausführungsform, in der der Kniehebel als U-Profil ausgebildet ist, können die Krallen (8) am unteren Ende der Spannseite aufgrund der in diesem Ausführungsbeispiel vorgesehenen Hebelwirkung des Kniehebels auf die Gehäusewand zu geschwenkt und in die flächige Gehäusewand (10) getrieben werden. Hieraus folgert der Fachmann, dass die Spannseite grundsätzlich mit der Gehäusewand in Kontakt treten muss, aber es im Rahmen der Lehre hierfür genügt, wenn der Kontakt über die Krallen der Spannseite erfolgt. Dies erkennt der Fachmann auch in funktionaler Hinsicht als ausreichend, solange durch einen bloßen Kontakt der Krallen mit der Gehäusewand eine hinreichende Verklemmung der Montageschiene zwischen den Schaltschrankgehäusewänden – nämlich über an der Spannseite befindliche Krallen auf der einen Seite und einen Stützabschnitt der Schiene an der anderen Seite – erfolgt.
-
4.
Unter Zugrundelegung der vorstehenden Erwägungen zum Verständnis der beanspruchten Lehre handelt es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um Montageschienen nach Anspruch 1 des Klagepatents, da sie alle Merkmale des geltend gemachten Anspruchs verwirklichen. -
a)
Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen insbesondere alle Merkmale der Merkmalsgruppe 3. Das U-förmige Bauteil der angegriffenen Ausführungsformen stellt einen erfindungsgemäßen Kniehebel dar. - Das U-förmige Bauteil bewirkt ein erfindungsgemäßes Verspannen zwischen den Gehäusewänden. Zwar behauptet die Beklagte, die angegriffenen Ausführungsformen könnten keine Spannkraft erzeugen. Die Beklagte trägt jedoch selbst vor, dass durch Anziehen der mittigen Schraube durch das Langloch sich die Vorsprünge der unteren Basis des U-förmigen Elements in Richtung der Gehäusewand bewegen. Sie räumt ein, dass sich durch Anziehen der Schraube die Stirnseite der Basis des U-Profils durch die Schwenkachse der angegriffenen Ausführungsformen in Richtung der Schrankinnenwand, wo sich die Krallen dann vergraben, bewegt. Die Basis des U-Profils wird dabei mittels der Schraube – auch nach dem Vortrag der Beklagten – verklemmt. Dies ist nach der Auslegung der Kammer ausreichend für die Verwirklichung des Merkmals 3. Dass der Kniehebel der angegriffenen Ausführungsformen nicht verschwenkbar über ein Knie gelagert ist oder keine Hebelwirkung ausnutzt, führt ebenso wenig aus der Verletzung hinaus wie der Umstand, dass der Kniehebel nicht über zwei Arme verfügt. Dass die Verschwenkung des Kniehebels der angegriffenen Ausführungsformen nur an einer Seite erfolgt, ist ausreichend, da über diese Verschwenkung – ausgelöst durch Festdrehen der Spannschraube – die Vorsprünge der Basis des U-förmigen Bauteils in die Schrankinnenwand gedrückt werden können.
- Die klagepatentgemäße Spannseite stellt die Stirnseite der Basis des U-Profils mit ihren Vorsprüngen dar, da dies die Seite ist, die sich durch Bewegen der mittigen Schraube auf die Schrankwand zubewegt und durch das Eingraben der Vorsprünge in die Schrankwand den fixierenden Kontakt herstellt. Soweit die Basis des U-Profils nur über die Vorsprünge (Krallen) mit der Schrankinnenwand in Kontakt steht sowie, soweit die Schenkel des U-Profils zurückstehen und die Schrankwand nicht berühren, ist dies nach der Auslegung der Kammer für die Verletzung unschädlich. Denn das Klagepatent versteht die Krallen, d.h. die Vorsprünge der angegriffenen Ausführungsformen, – wie aufgezeigt – als Bestandteile der Spannseite.
- Weiterhin stellt die Fläche des U-Profils, welche parallel zur Montageschiene verläuft und in welcher sich das vorgebohrte Loch für die mittige Torxschraube befindet, die Befestigungsseite dar, da über diese die Verschraubung zwischen U-förmigem Bauteil und dem einen Ende des Montageabschnitts stattfindet. Die über diese Seite stattfindende Verschraubung ist auch lösbar im Sinne des Merkmals 3.1, da durch ein Anziehen und Lockern der Schraube das Herstellen oder Aufheben der Verklemmung der Schiene im Schrankinnengehäuse möglich ist. Dass sich jeweils seitlich von dem U-förmigen Bauteil noch zwei – etwaig unlösbare – Torxschrauben befinden, welche als gelenkige Verbindung dienen, führt nicht aus der Verletzung heraus, da das Klagepatent weitere Schrauben, die keine Spannschrauben darstellen, nicht ausschließt. Gleichwohl geht die Kammer davon aus, dass auch die seitlichen Torxschrauben grundsätzlich derart herausgedreht werden könnten, dass im Zweifel eine vollständige Trennbarkeit des U-förmigen Bauteils der angegriffenen Ausführungsformen von der Montageschiene herbeiführbar wäre.
- Die Befestigungs- und Spannseite des U-förmigen Bauteils stehen auch in einem (etwa rechtwinkligen) Winkel zueinander bzw. schließen diesen ein, da die Fläche mit dem Langloch für die Schraube und die Basis des U-Profils quer zueinanderstehen.
- Die angegriffenen Ausführungsformen erfüllen schließlich auch die in Abs. [0004] gestellten Aufgaben. So sind sie ebenfalls einfach in einem Schaltschrankgehäuse durch Positionieren und Anziehen nur einer (mittigen) Torxschraube zu montieren. Auch weist der Montageabschnitt der angegriffenen Ausführungsformen eine große nutzbare Länge auf, da die zum Verspannen bzw. Verklemmen zu nutzende Torxschraube sich am äußeren Ende des Montageabschnitts befindet und im Vergleich zum kritisierten Stand der Technik mit mehreren Spannschrauben eben nur eine Spannschraube vorhanden ist.
-
b)
Die Verwirklichung der übrigen Merkmale des geltend gemachten Anspruchs, d.h. solche außerhalb der Merkmalsgruppe 3, durch die angegriffenen Ausführungsformen steht zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit. -
II.
Aufgrund des Herstellens und des Vertriebs bzw. Anbietens der angegriffenen Ausführungsformen durch die Beklagte (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG) in Deutschland, etwa über die Website www.C.com oder www.I.de, ergeben sich die zuerkannten Rechtsfolgen. -
1.
Der Unterlassungsanspruch beruht auf § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes im Inland ohne Berechtigung erfolgt. Die Verwirklichung der Benutzungshandlungen verursacht vorliegend eine Wiederholungsgefahr für alle in § 9 PatG, hier § 9 S. 2 Nr. 1 PatG, geschützten Handlungen. -
2.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus § 139 Abs. 2 PatG folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. - Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin aber noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.
-
3.
Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, ihren Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsformen ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Rechnungslegungspflicht folgt aus §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. -
4.
Der Klägerin steht auch ein Vernichtungsanspruch nach § 140a Abs. 1 S. 1 PatG zu. Eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung nach § 140a Abs. 4 PatG ist seitens der (darlegungs- und beweisbelasteten) Beklagten nicht vorgetragen und auch ohne Weiteres nicht ersichtlich. -
5.
Die Klägerin kann die Beklagte aus § 140a Abs. 3 PatG auch auf Rückruf patentverletzender Erzeugnisse in Anspruch nehmen. Der Anspruch ist vorliegend nicht wegen Unverhältnismäßigkeit i.S.d. § 140a Abs. 4 PatG ausgeschlossen. - Nach § 140a Abs. 4 PatG sind Vernichtungs- und Rückrufansprüche ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen. Bei § 140a Abs. 4 PatG handelt sich um einen Ausnahmetatbestand, der eng auszulegen ist. Die Interessen des Verletzers und des Schutzrechtsinhabers sind zu diesem Zweck gegeneinander abzuwägen, wobei von einem Rückruf nur abzusehen ist, wenn berechtigte Belange des Verletzers deutlich überwiegen. Dabei sind unter anderem ein Verschulden und der Verschuldensgrad, die Schwere des Eingriffs in das Schutzrecht, das Bestehen und das Ausmaß einer Wiederholungsgefahr sowie der Gedanke der Generalprävention und der Sanktionscharakter des Rückrufs zu berücksichtigen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.07.2021 – I-15 U 42/20, GRUR-RS 2021, 21416, Rn. 101). Maßgeblich sind die vom Patentverletzer darzulegenden und zu beweisenden Umstände des Einzelfalls (Grabinski/Zülch/Tochtermann in Benkard, PatG, 12. Aufl. 2023, § 140a Rn. 8, 8a). Hohe Kosten des Rückrufs machen diese nicht per se unverhältnismäßig. Gewisse Schäden beim Verletzer sind oft unvermeidbare Folge der Ansprüche aus § 140a PatG und stellen dessen Verhältnismäßigkeit nicht ohne Weiteres in Frage. Zu berücksichtigen ist auch, welche Alternativen es gibt, um einen rechtswidrigen Zustand zu beseitigen und wie wirtschaftlich schwerwiegend der rechtswidrige Zustand für den Schutzrechtsinhaber ist. Ein uneingeschränkter Rückruf kann ausnahmsweise unverhältnismäßig sein, wenn sein Zweck ebenso effektiv auf andere Weise als durch „vollständigen“ Rückruf des Erzeugnisses gegen Erstattung des Kaufpreises erreicht werden kann (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2018, 22632 – Beheizbarer Boden). Eine Unverhältnismäßigkeit kann sich beispielsweise daraus ergeben, dass das patentverletzende Bauteil bereits in eine größere Einheit (etwa ein Fahrzeug) verbaut ist und dessen Demontage erhebliche wirtschaftliche Folgen für den Beklagten mit sich bringen würde, etwa, weil bei einem Fahrzeug nach der Demontage kein Verkauf als Neuwagen möglich ist (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Kap. D. Rn. 1090).
- Nach diesen Maßstäben ist der Rückruf vorliegend nicht unverhältnismäßig. Der Umstand, dass die Montageschienen bereits verbaut sowie mit Kabeln ausgekleidet sind und nunmehr wieder ausgebaut werden müssten, begegnet keinen hinreichenden Bedenken. Zu beachten ist zunächst, dass es sich bei den Montageschienen schon nach ihrer Bezeichnung um Bauteile handelt, die erst montiert werden und nicht von vorneherein als Einheit mit dem jeweiligen Schaltschrank zusammen produziert oder geliefert werden. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Montageschienen auch grundsätzlich zur Demontage ohne größere Schäden konzipiert sind. Bei Montageschienen liegt es gerade in der Natur der Sache, dass diese verbaut werden. Würde der bloße Ausbau eines Produktes bereits für die Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs sprechen, würde dies für eine Vielzahl aller einzubauenden Gegenstände gelten, was der Kammer insbesondere mit Blick auf den Ausnahmecharakter des § 140a Abs. 4 PatG nicht sachgerecht erscheint.
- Ebenso liegt es in der Natur von Montageprodukten, dass diese jedenfalls vorübergehend fest mit anderen Gegenständen verbunden werden und dabei Löcher in die Substanz des anderen Gegenstands gebohrt oder gedrückt werden können. Die von der Beklagtenseite hier dargelegten Arretierungslöcher in den Schaltschränken stellen sich als hinnehmbare Folge dar und vermögen eine unverhältnismäßige Substanzverletzung oder gar Unbrauchbarkeit der Schaltschränke nach Ausbau nicht zu begründen. Soweit durch die verbleibenden Arretierungslöcher eine Neumontage erschwert wird, sind gewisse Schwierigkeiten hinzunehmen. Dass eine Neumontage ausgeschlossen oder aufgrund derart großer Beschädigung unzweckmäßig wäre, ist weder vorgetragen, noch ersichtlich. Auch der Umstand, dass Kabel bzw. elektrische Leitungen durch die verbauten Montageschienen verlaufen und der Ausbau ggfs. geschultes Fachpersonal erfordert – wie die Beklagte u.a. in der mündlichen Verhandlung mittels einer Abbildung eines mit Montageschienen und einer Vielzahl von Kabeln bestückten Schaltschrankes vorgetragen hat – vermag eine Unverhältnismäßigkeit nicht zu begründen. Das Erfordernis besonderen Aufwands oder des Einsatzes von Fachpersonal liegt vielmehr in der Natur des patentverletzenden Produkts selbst. Dieser bloße Umstand führt nicht zu einem Überwiegen der Belange des Patentverletzers. Die Beklagte hat auch keine Alternative vorgetragen, den rechtswidrigen Zustand anderweitig als durch Ausbau der Montageschienen zu beseitigen.
- Schließlich ist ein gewisser Imageschaden von der Beklagten, welche die Patentverletzung zumindest fahrlässig verschuldet hat, hinzunehmen und ist jedem Rückruf-Vorgang, der auf § 140a PatG beruht, stets immanent. Demnach war unerheblich, ob sich die Abnehmer für einen Schaltschrank und nicht für die konkreten Montageschienen entscheiden. Selbst wenn – wie von der darlegungsbelasteten Beklagten pauschal behauptet – der Schaden der Klägerin demgegenüber nur klein wäre, ergibt sich eine Unverhältnismäßigkeit vorliegend nicht. Dass die berechtigten Belange der patentverletzenden Beklagten vorliegend aufgrund des Aufwandes und wegen etwaiger Beschädigungen der Schaltschränke beim Ausbau der zurückzurufenden Montageschienen deutlich überwiegend würden, ist jedenfalls nicht feststellbar. Von dem gesetzlichen Grundfall des § 140a Abs. 3 PatG war daher nicht abzuweichen.
-
6.
Weiterhin hat die Klägerin einen Anspruch auf Zahlung von 12.681,84 EUR nebst Zinsen als Ersatz für Kosten der anwaltlichen Abmahnung vom 04.10.2021 aus §§ 683 Abs. 1, 677, 670 BGB (Geschäftsführung ohne Auftrag). -
a)
Die Kosten einer Abmahnung sind nur erstattungsfähig, wenn die Abmahnung einen gewissen Mindestinhalt aufweist. Die Abmahnung muss den Abgemahnten in die Lage versetzen, den Verletzungsvorwurf zu überprüfen und durch sein Verhalten eine Klage zu vermeiden. Dazu muss in der Abmahnung der Sachverhalt, der den Vorwurf rechtswidrigen Verhaltens begründen soll, also die begangene Verletzungshandlung, genau angegeben und der darin erblickte Verstoß so klar und eindeutig bezeichnet sein, dass der Abgemahnte die gebotenen Folgerungen ziehen kann (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.11.2011 – I-20 W 132/11). - Diese Informationen gehen hier aus dem als Anlage B&B 1 vorgelegten Schreiben vom 04.10.2021 hervor. Das Abmahnschreiben enthält jedenfalls das vermeintlich verletzte Patent mit seiner Patentnummer sowie eine Darstellung der vorgeworfenen Verletzungshandlung unter Nennung der angegriffenen Ausführungsformen, so dass alle Informationen enthalten sind, die die Beklagte benötigt, um den Verletzungsvorwurf zu überprüfen. Dabei war zu beachten, dass der Sachverhalt nicht sehr komplex ist und es darum nicht zwingend der weiteren Erläuterungen der Klägerin bedurfte.
-
b)
Die Klägerin kann auch Ersatz der für die Einschaltung eines Patentanwalts im Rahmen der Abmahnung entstandenen Gebühren verlangen. Dies ist der Fall, wenn die Einschaltung eines Patentanwalts im Einzelfall erforderlich war, was regelmäßig zu bejahen ist (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 16. Aufl., 2024, Kap. C Rn. 54). Die Erforderlichkeit ist jedoch nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 – Kosten des Patentanwalts II). Die Klägerin trägt – insoweit unbestritten – vor, die Mitwirkung eines Patentanwalts sei vorliegend aufgrund der bei der Verletzungsanalyse aufkommenden technischen Fragestellungen erforderlich gewesen. Aus der Abmahnung vom 04.10.2021 geht hervor, dass Recherchen zum Rechtsbestand und zur Registerlage des Klagepatents stattgefunden haben, mithin typische patentanwaltliche Aufgaben. Aufgrund des technischen Sachverhalts und der grundsätzlich erforderlichen Analyse der angegriffenen Ausführungsformen war die Einschaltung eines Patentanwalts hier auch im Einzelfall notwendig. -
c)
Die Klägerin kann die Abmahnkosten auch in der geltend gemachten Höhe ersetzt verlangen. Die Summe von 12.681,84 EUR (2 x 6.340,92 EUR) beruht auf der zweimaligen Geltendmachung (Rechts- und Patentwalt) einer 1,5 RVG-Mittelgebühr aus einem Gegenstandswert von 500.000,00 EUR. - Die Gebührenhöhe ergibt sich hier aus Nr. 2300 des Vergütungsverzeichnisses, wo ein Rahmen von 0,5 bis 2,5 Gebühren vorgesehen ist. Innerhalb dieses Rahmens ist nach § 14 Abs. 1 RVG die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen. Soweit ein Sachverhalt vorliegt, der aufgrund des Umfangs oder der Schwierigkeit beim Tätigwerden des Rechtsanwalts ein Übersteigen der Regelgebühr von 1,3 zulässt, ist dem Rechtsanwalt ein Ermessen bei der Gebührenfestsetzung in einem Toleranzbereich von 20 % einzuräumen (BGH, GRUR-RR 2012, 491 – Toleranzbereich).
- Ein Übersteigen der 1,3 Gebühr ist hier zulässig, da es sich um einen Patentverletzungsstreitfall handelt (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 16. Aufl. 2024, Kap. C Rn. 71), der auch nicht ausnahmsweise völlig unkompliziert ist. Unter Berücksichtigung des der Klägerin bzw. des ihren rechtsanwaltlichen Vertretern somit zustehenden Ermessenspielraums bei der Festsetzung der Geschäftsgebühr erscheint eine 1,5 Gebühr angemessen.
- Auch der von der Klägerin zugrunde gelegte Gegenstandswert von 500.000,00 EUR war angemessen. Im Verhältnis zum Verletzer ist derjenige Betrag zugrunde zu legen, der dem berechtigen Anspruchsbegehren entspricht (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 16. Aufl., 2024, Kap. C Rn. 70). Die Klägerin trägt insoweit unwidersprochen vor, dass angesichts ihres Begehrens ein Gegenstandswert von 500.000,00 EUR anzusetzen ist. Die Klägerin legt dar, der weltweit führende Systemanbieter, zu dessen Produktportfolio auch Schaltschränke gehören, zu sein. Weiterhin sind Streit- bzw. Gegenstandswerte in Patentverletzungsverfahren regelmäßig im mittleren sechsstelligen Bereich anzusiedeln, so dass ein Gegenstandswert von 500.000,00 EUR noch angemessen erscheint.
-
d)
Der Anspruch auf Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten auf den Erstattungsbetrag ab Rechtshängigkeit (hier: 11.02.2022) besteht ab dem 12.02.2022 und ergibt sich aus §§ 291, 288 Abs. 1 S.2 BGB. -
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92 Abs. 2 Nr.1 ZPO. Soweit die Klägerin die Klage geringfügig, etwa hinsichtlich eines Teils der ursprünglich geltend gemachten Zinsforderung (Ziff. I.6.), zurückgenommen hat, waren ihr grundsätzlich die diesbezüglichen Kosten gem. § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO aufzuerlegen. Die dahingehende Zuvielforderung war jedoch nur untergeordneter Natur i.S.d. § 92 Abs. 2 Nr.1 ZPO, so dass der Beklagten die Gesamtkosten aufzuerlegen waren. - Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.
-
IV.
Der Streitwert wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.