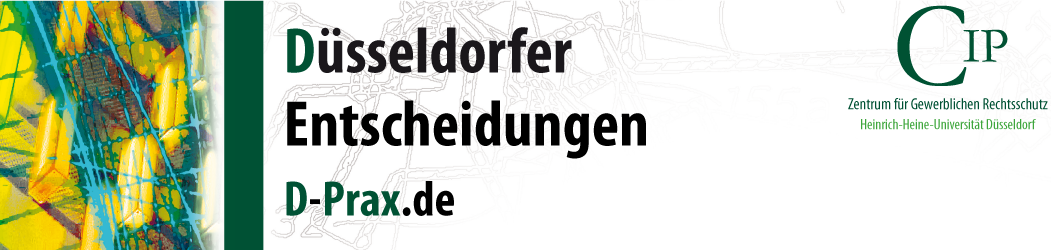Düsseldorfer Entscheidungen Nr. 3402
Landgericht Düsseldorf
Urteil vom 12. November 2024, Az. 4c O 10/22
- I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Widerklage wird abgewiesen.
III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. - Tatbestand
- Die Klägerin verfolgt aus Patentrecht gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung. Außerdem begehrt sie die Zahlung von vorgerichtlichen Abmahnkosten.
- Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patents EP 3 088 XXX B1 (Anlage K1, deutsche Übersetzung Anlage K1a, im Folgenden: Klagepatent). Die Anmeldung des Klagepatents ist am 7. April 2016 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 28. April 2015 (FR XXX) erfolgt. Die Anmeldung wurde am 2. November 2016 offengelegt, der Hinweis auf die Patenterteilung am 7. März 2018. Das Klagepatent steht auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft.
- Das Klagepatent betrifft ein Elektrohaushaltsgerät zum Bügeln, das einen Dampferzeuger umfasst, der mit einer Entleerungsöffnung ausgestattet ist.
- Anspruch 1 des in französischer Sprache angemeldeten Klagepatents lautet in seiner ursprünglichen Fassung:
- „Appareil électroménager de repassage comportant un bôitier (20) renfermant un générateur de vapeur comprenant un orifice de vidange (42) permettant l’évacuation du tartre, un bouchon (43) amovible venant fermer ledit orifice de vidange (42), accessible de l’extérieur du boîtier (20), et un cache (5) venant masquer ledit bouchon (43), caractérisé en ce que le cache (5) est rendu solidaire du bôitier (20) par une charnière (6), le cache (5) pouvant occuper une position fermée dans laquelle il masque le bouchon (43) et une position ouverte dans laquelle il libère l’accès au bouchon (43).“
- Übersetzt lautet diese Anspruchsfassung:
- „Elektrisches Haushaltsgerät zum Bügeln, das ein Gehäuse (20) aufweist, das einen Dampferzeuger einschließt, der eine Entleerungsöffnung (42), die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht, einen lösbaren Stopfen (43), der die Entleerungsöffnung (42) verschließt, die von außerhalb des Gehäuses (20) zugänglich ist, und eine Abdeckung (5) umfasst, die den Stopfen (43) maskiert, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (5) mit dem Gehäuse (20) durch ein Scharnier (6) fest verbunden ist, wobei die Abdeckung (5) eine geschlossene Stellung, in der sie den Stopfen (43) maskiert, und eine offene Stellung einnehmen kann, in der sie den Zugang zu dem Stopfen (43) freigibt.“
- Unteranspruch 4 heißt in französischer Verfahrenssprache:
- „Appareil électroménager selon l’une quelconque des revendications 2 à 3, caractérisé en ce que la charnière (6) est disposée sous l’orifice de vidange (42) et en ce que le cache (5) en position ouverte s’étend sous la sortie de l’orifice de vidange (42), le cache (5) présentant une forme creuse qui collecte le liquide s’écoulant par l’orifice de vidange (42).“
- und in deutscher Übersetzung:
- „Elektrisches Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Scharnier (6) unterhalb der Entleerungsöffnung (42) angeordnet ist, und dass sich die Abdeckung (5) in der offenen Stellung unterhalb der Entleerungsöffnung (42) erstreckt, wobei die Abdeckung (5) eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung (42) fließt.“
- Auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten vom 15. Juli 2022 (Anlagenkonvolut B4) hat das Bundespatentgericht (BPatG) das Klagepatent mit Urteil vom 14. Mai 2024 in eingeschränkter Fassung, nämlich in der Fassung des Hilfsantrags 1, aufrechterhalten (vgl. Anlage B12; im Folgenden auch: BPatGU). Der Klagepatentanspruch 1 lautet in der nunmehr geltenden Fassung (Änderungen diesseits hervorgehoben):
- Elektrisches Haushaltsgerät zum Bügeln, das ein Gehäuse (20) aufweist, das einen Dampferzeuger einschließt, der eine Entleerungsöffnung (42), die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht, einen lösbaren Stopfen (43), der die Entleerungsöffnung (42) verschließt, die von außerhalb des Gehäuses (20) zugänglich ist, und eine Abdeckung (5) umfasst, die den Stopfen (43) maskiert, wobei die Abdeckung (5) mit dem Gehäuse (20) durch ein Scharnier (6) fest verbunden ist, wobei die Abdeckung (5) eine geschlossene Stellung, in der sie den Stopfen (43) maskiert, und eine offene Stellung einnehmen kann, in der sie den Zugang zu dem Stopfen (43) freigibt, dadurch gekennzeichnet, dass das Scharnier (6) unterhalb der Entleerungsöffnung (42) angeordnet ist, und dass sich die Abdeckung (5) in der offenen Stellung unterhalb der Entleerungsöffnung (42) erstreckt, wobei die Abdeckung (5) eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung (42) fließt.
- Folgende Figuren sind der Klagepatentschrift zur Veranschaulichung der Lehre des Klagepatents entnommen:
- Die Figur 1 zeigt eine Perspektivansicht eines Bügelgeräts gemäß einer spezifischen erfindungsgemäßen Ausführungsform, auf der die Abdeckung der Entleerungsöffnung in geschlossener Stellung dargestellt ist. Die Figur 5 zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie V-V aus Abbildung 4 und die Figuren 6 und 7 sind perspektivische Detailansichten der Abdeckung in der offenen bzw. geschlossenen Stellung.
- Die Klägerin ist ein in XXX ansässiger Hersteller von Elektrokleingeräten und Haushaltswaren. Zu der Unternehmensgruppe und den Marken der Klägerin gehören, unter anderem, A, B, C und D.
- Bei dem Unternehmen der Beklagten handelt es sich um die deutsche Tochtergesellschaft der E., einem XXX Hersteller von Haushaltswaren mit Sitz in XXX. Zu der Unternehmensgruppe und den Marken der Beklagten gehören beispielsweise F G und H.
- Die Beklagte vertreibt unter anderem Dampfbügelstationen, beispielsweise unter der Bezeichnung „F XXX1“, darunter die Modelle „F XXX1 XXXA”, „F XXX1 XXXB“, „F XXX1 XXXC” (vgl. Bedienungsanleitung, vorgelegt als Anlage K5) und „F XXX1 XXXD” (im Folgenden auch: angegriffene Ausführungsform(en)) und bietet diese über ihre deutsche Website https://www.FG.com/XXX an. Zudem können die angegriffenen Ausführungsformen über den von der Beklagten betriebenen Online-Shop erworben werden (Anlage K4). Zur Veranschaulichung werden Abbildungen der angegriffenen Ausführungsformen (entnommen der Klageschrift Seite 25, Bl. 27 GA) eingefügt:
- Die angegriffenen Ausführungsformen verfügen über das sog. XXX System zur Entfernung von Kesselsteinen während eines Entkalkungsvorgangs. Die dazu vorgesehene seitliche Öffnung an den angegriffenen Ausführungsformen sieht aus wie folgt (entnommen der Klageschrift Seite 26, Bl. 28 GA):
- Der Bedienungsanleitung nach der Anlage K5 sind zum Entleerungsvorgang die nachfolgend dargestellten Grafiken zu entnehmen:
- Vorgerichtlich mahnte die Klägerin die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 12. Januar 2022 ab und forderte sie insbesondere zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf (Anlage K6). Mit anwaltlichem Schreiben vom 2. Februar 2022 (Anlage K7) ließ die Beklagte die gegen sie geltend gemachten Ansprüche sowie die diesen zugrundeliegende Patentverletzung zurückweisen.
- Die Klägerin ist der Ansicht, dass die Klage begründet sei. Die angegriffenen Ausführungsformen würden wortsinngemäßen unmittelbaren Gebrauch von der Lehre des Klagepatents machen. Die mit den Scharnieren angebrachte Abdeckung entspreche einer erfindungsgemäßen Abdeckung. Das Klagepatent lasse es zu, dass ein Befestigungsaufsatz an der Gehäusewand mit einer erfindungsgemäßen Abdeckung zusammenwirke. Insbesondere sei selbst in der erfindungsgemäßen Lehre eine Verriegelungszunge vorgesehen, welche in der geschlossenen Position in eine entsprechende Öffnung der Abdeckung eingreife. Bezogen auf die angegriffenen Ausführungsformen sei der am Gehäuse befestigte durchsichtige Teil des Abdeckungskastens dem Gehäuse zuzurechnen, sodass insgesamt eine erfindungsgemäße Abdeckung vorliege. Für ein Gießen des Scharniers mit der Abdeckung sei es ausreichend, einen Teil des Scharniers durch denselben Gießvorgang zu erhalten. Dies sei bei den angegriffenen Ausführungsformen der Fall, weil jedenfalls die eine Hälfte des Scharniers mit dem beweglichen Teil der Abdeckung gegossen werden könne.
- Für die Maskierung des Stopfens durch die Abdeckung sei nach dem Klagepatent nicht erforderlich, dass die Abdeckung intransparent ausgestaltet sei. Allenfalls diskutiere das Klagepatent ein intransparentes Material für die Unterschale. Hinweise für die Abdeckung würden sich daraus nicht ergeben; das Klagepatent gebe nicht einmal das Material für die Abdeckung vor.
- Für ein Sammeln der Flüssigkeit in der Abdeckung sei ausreichend, wenn die Flüssigkeit durch seitliche Begrenzungen der Abdeckung kanalisiert werde. Bereits dann liege ein kontrolliertes und zielgerichtetes Ableiten der Flüssigkeit vor. Ein Anhäufen sei dagegen von der erfindungsgemäßen Lehre nicht vorgesehen.
- Die Beklagte könne sich nicht erfolgreich auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen. Dies scheitere schon daran, dass das vorbenutzte Gerät vor Anmeldung des Klagepatents nicht mehr vertrieben worden sei. Auch sei nicht zu erkennen, dass das vorbenutzte Gerät technisch demjenigen entspreche, das in der Bedienungsanleitung abgebildet worden sei. Die Klägerin erklärt sich deshalb mit Nichtwissen dazu, dass die Fotos in der Bedienungsanleitung (Anlage B 3) auch das beschriebene oder das in Anlage B 3A aufgeführte Produkt zeigen würden. Ferner werde die Lehre des Klagepatents nicht benutzt. Es gebe keine von außerhalb des Gehäuses zugängliche Entleerungsöffnung, da der Wassertank vorgesetzt sei. Gleichermaßen fehle es an einem erfindungsgemäßen Scharnier, das mit dem Gehäuse verbunden sei.
- Nachdem das BPatG das Klagepatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 eingeschränkt aufrechterhalten hat,
- beantragt die Klägerin,
- A. die Beklagte zu verurteilen,
-
I. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an der Geschäftsführerin der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,
1. Elektrische Haushaltsgeräte zum Bügeln,
umfassend ein Gehäuse, das einen Dampferzeuger einschließt, eine Entleerungsöffnung, die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht, einen lösbaren Stopfen, der die Entleerungsöffnung verschließt, die von außerhalb des Gehäuses zugänglich ist, und eine Abdeckung, die den Stopfen maskiert,
in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen,
bei denen die Abdeckung mit dem Gehäuse durch ein Scharnier fest verbunden ist, wobei die Abdeckung eine geschlossene Stellung, in der sie den Stopfen maskiert, und eine offene Stellung einnehmen kann, in der sie den Zugang zu dem Stopfen freigibt, das Scharnier unterhalb der Entleerungsöffnung angeordnet ist, und sich die Abdeckung in der offenen Stellung unterhalb der Entleerungsöffnung erstreckt, wobei die Abdeckung eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung fließt; - II. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer A. I. bezeichneten Handlungen seit dem 07.03.2018 begangen hat, und zwar unter Angabe
-
1. der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer;
2. der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;
3. der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden; - wobei zum Nachweis der Angaben entsprechende Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;
- III. der Klägerin in einer geordneten Aufstellung unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen, Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziffer A. I. bezeichneten Handlungen seit dem 07.04.2018 begangen hat, und zwar unter Angabe:
-
1. der Herstellungsmengen und -zeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen;
2. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer;
3. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger;
4. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, der Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume jeder Kampagne;
5. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, - wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;
- IV. die in der Bundesrepublik Deutschland jeweils in ihrem unmittelbaren und/oder mittelbaren Besitz und/oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter A. I. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben;
- V. die unter A. I. bezeichneten gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des … vom …) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;
- VI. an die Klägerin EUR 8.051,18 nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 3. Februar 2022 zu zahlen;
- B. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu A. I. bezeichneten und seit dem 07.04.2018 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.
- Die Beklagte beantragt,
-
die Klage abzuweisen,
hilfsweise den Rechtsstreit gemäß § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung in dem den deutschen Teil des europäischen Patents 3 XXX XXX (DPMA Az. 60 2016 001 785.7) betreffenden Nichtigkeitsberufungsverfahrens vor dem BGH auszusetzen; -
weiter hilfsweise für den Fall einer Verurteilung zur Rechnungslegung (Klageantrag A.III.):
die Klage abzuweisen, soweit die Klägerin Rechnungslegung „unter Vorlage von Belegen, wie Rechnungen, Lieferscheinen oder Quittungen“ beantragt hat; -
weiter hilfsweise für den Fall der Verurteilung zur Rechnungslegung unter Belegvorlage (Klageantrag A.III.):
der Beklagten nachzulassen, geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der rechnungslegungspflichtigen Daten schwärzen zu dürfen; -
hilfsweise für den Fall der Verurteilung zur Vernichtung:
der Beklagten nachzulassen, nach ihrer (der Beklagten) Wahl anstelle der Vernichtung bei den im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziffer A.I. bezeichneten Erzeugnissen unter Aufsicht eines von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollziehers jeweils den transparenten Kunststoff-Schutzkasten zu entfernen und sodann dem Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten (Kosten der Beklagten) herauszugeben; -
hilfsweise:
das Urteil in Bezug auf die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung nur gegen einheitliche Teilsicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären, wobei eine gemeinsame Teilsicherheit von mindestens EUR 950.000,00 vorgeschlagen wird. - Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Klage unbegründet sei und die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent nicht verletze.
- Das Klagepatent wolle eine feste Verbindung zwischen dem Gehäuse und der Abdeckung bereitstellen, wobei als Verbindungsmittel ein Scharnier zum Einsatz kommen solle. Der in der angegriffenen Ausführungsform angebrachte Schutzkasten werde durch zwei Bauteile gebildet. Es sei nicht allein der klappbare Teil, der den Zugang zum Stopfen versperre. Vielmehr wirke dabei das starr am Gehäuse angebrachte Teil mit. Ohne diesen starren Teil wäre ein Zugang zum Stopfen von oben weiterhin möglich; insbesondere wäre auch die Draufsicht nicht versperrt. Insoweit fehle es dem starren Teil des Schutzgehäuses an einer Scharnierverbindung mit dem Gehäuse, weil die Verbindung mittels Gewinde oder Rastnasen erfolge. Eine Scharnierverbindung bestehe nur zwischen den Elementen des Schutzkastens, aber nicht mit dem Gehäuse. Insoweit sei der starre Teil auch nicht dem Gehäuse zuzurechnen. Da der Schutzkasten zudem aus einem transparenten Material bestehe, fehle es an einer Maskierung der Abdeckung durch den Stopfen.
- Ferner verlange das Klagepatent ein Maskieren des Stopfens durch die Abdeckung, wofür ein visuelles Verdecken durch intransparentes Material erforderlich sei. Dies ergebe sich aus Differenzierung zwischen Material für Unterschale und Oberschale. Die in den angegriffenen Ausführungsformen benutzte Abdeckung bestehe aber, was unstreitig ist, aus transparentem Material.
- Ein Sammeln der Flüssigkeit in der hohlen Form der Abdeckung sei nur gegeben, wenn sich die Flüssigkeit darin zumindest zeitweise akkumuliere. Ein unmittelbares Ausfließen der Flüssigkeit sei nicht erfindungsgemäß. Bei den angegriffenen Ausführungsformen fließe die austretende Flüssigkeit allerdings direkt aus der Entleerungsöffnung, ohne gesammelt zu werden. Nur bei einem solchen Anspruchsverständnis sei keine neuheitsschädliche Vorwegnahme gegenüber der Anleitung und der I Dampfbügelstation Modell XXX (Anlage B8a; im Folgenden auch: N3) gegeben.
- Die Beklagte könne der behaupteten Patentverletzung zudem ein privates Vorbenutzungsrecht entgegenhalten. Die Dampfbügelstationen des Typs „F XXX2 XXXA“ (im Folgenden auch: Vorbenutzungsform N1) nähmen die Lehre des Klagepatents vorweg. Die N1 sei vor dem Prioritätszeitpunkt vertrieben worden. Hierzu behauptet die Beklagte, dass sie seit dem Jahr 2006 Dampfbügelstationen hergestellt und vertrieben habe, konkret auch das Gerät mit der Bezeichnung „F XXX2 XXXA“. Schon aus dessen Betriebsanleitung (Anlage B3) ergebe sich die erfindungsgemäße Lehre. Der Betrieb, in dem das Vorbenutzungsrecht entstanden sei, sei auf ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die E F G GmbH übergegangen. Zuvor sei der Betrieb von einer F GmbH, zugeordnet zum H-Konzern, auf die Muttergesellschaft der Beklagten, die E, übergegangen. Das Tochterunternehmen der Beklagten führe die Haushaltsgeräte-Sparte der F GmbH für die Beklagte und die Muttergesellschaft der Beklagten als selbständigen Betriebsteil an ihrem Standort in XXX fort. Einen Verzichtswillen hinsichtlich der Ausübung des Vorbenutzungsrechtes habe die Beklagte zu keiner Zeit zu erkennen gegeben.
- Der Beklagten stehe ein Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten zu, da die Abmahnung der Klägerin mangels Verletzung des Klagepatents zu Unrecht erfolgt sei. Die Klägerin habe insbesondere schuldhaft gehandelt, da ihr als herstellendes Weltunternehmen auf dem Markt der Haushaltsgeräte jedenfalls die im Nichtigkeitsverfahren diskutierten neuheitsschädlichen Entgegenhaltungen als Produkte ihrer direkten Wettbewerber hätten bekannt gewesen sein müssen.
- Die Beklagte beantragt daher widerklagend,
-
die Klägerin zu verurteilen, an die Beklagte EUR 16.102,36 nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen.
Die Klägerin beantragt,
die Widerklage abzuweisen. - Ihre Abmahnung sei begründet gewesen. Die geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte bestünden.
- Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zur Akte gereichten Schriftstücke nebst Anlagen Bezug genommen.
- Entscheidungsgründe
-
A.
Die zulässige Klage ist unbegründet. Ebenso ist die Widerklage zulässig aber unbegründet. -
I.
Das Klagepatent betrifft ein elektrisches Haushaltsgerät zum Bügeln, das ein Gehäuse aufweist, das einen Dampferzeuger einschließt, der eine Entleerungsöffnung, die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht, umfasst, und betrifft insbesondere ein Gerät, das einen lösbaren Stopfen, der von außerhalb des Gehäuses zugänglich ist und die Entleerungsöffnung verschließt, und eine Abdeckung, die den Stopfen maskiert, umfasst (Abs. [0001]). - Aus dem Stand der Technik waren, wie in Abs. [0002] erläutert ist, Bügelgeräte bekannt, die ein Gehäuse aufweisen, das einen Behälter für die Erzeugung von Dampf unter Druck einschließt, der durch eine Kordel mit einem Bügeleisen verbunden ist, wobei der Behälter eine Entleerungsöffnung umfasst, die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht und durch einen lösbaren Stopfen verschlossen ist, der von außerhalb des Gehäuses zugänglich ist. Gängig war dabei, den Stopfen aus Metall auszubilden, damit er den hohen Temperaturen im Behälter standhalten kann. Der Stopfen ist auf die Entleerungsöffnung aufgeschraubt. Damit sich der Anwender nicht beim Berühren des metallischen Teils des Stopfens verbrennt, kann Letzterer mit einem Kunststoffteil versehen sein, das üblicherweise durch Umspritzen um den Stopfen realisiert ist, wobei besagtes Kunststoffteil vorzugsweise eine geeignete Form aufweisen kann, um die Handhabung des Stopfens zu erleichtern.
- Nachteilig an derart umspritzten Stopfen war die relativ teure Herstellung. Zudem stand das Kunststoffteil in direktem Kontakt mit dem Metallteil, weshalb für den Anwender bei angeschaltetem Gerät eine Verbrennungsgefahr bestand (Abs. [0003]). Um diesen Nachteil zu beheben, war es bekannt, den Metallstopfen mit einer lösbaren Kunststoffabdeckung zu versehen. Diese war am Gehäuse, aber nicht mehr am Stopfen befestigt. Diese Lösung war kostengünstiger und bot eine bessere Wärmeisolierung (Abs. [0004]). Der Nachteil dieser Lösung wiederum, wie in Abs. [0005] beschrieben, bestand darin, dass der Stopfen leicht verloren gehen könnte und die Gerätenutzung wenig ergonomisch war, was zu einer Benutzung ohne Abdeckung führte, wodurch die Verbrennungsgefahr umso größer war.
- Das Klagepatent stellt sich daher die Aufgabe, die genannten Nachteile durch ein elektrisches Haushaltsgerät mit verbesserten Sicherheits- und Ergonomieeigenschaften zu überwinden.
- Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent in Anspruch 1 eine Vorrichtung mit den nachfolgenden Eigenschaften vor:
-
1. Elektrisches Haushaltsgerät zum Bügeln, das
1.1 ein Gehäuse (20) aufweist, das einen Dampferzeuger einschließt,
1.2 der eine Entleerungsöffnung (42), die die Entfernung von Kesselstein ermöglicht,
1.3 einen lösbaren Stopfen (43), der die Entleerungsöffnung (42) verschließt, die von außerhalb des Gehäuses (20) zugänglich ist, und
1.4 eine Abdeckung (5) umfasst, die den Stopfen (43) maskiert, dadurch gekennzeichnet, dass
1.4.1 die Abdeckung (5) mit dem Gehäuse (20) durch ein Scharnier (6) fest verbunden ist,
1.4.2 wobei die Abdeckung (5) eine geschlossene Stellung, in der sie den Stopfen (43) maskiert, und
1.4.3 eine offene Stellung einnehmen kann, in der sie den Zugang zu dem Stopfen (43) freigibt.
4. Elektrisches Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
4.1 das Scharnier (6) unterhalb der Entleerungsöffnung (42) angeordnet ist, und dass sich
4.2 die Abdeckung (5) in der offenen Stellung unterhalb der Entleerungsöffnung (42) erstreckt,
4.3 wobei die Abdeckung (5) eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung (42) fließt. -
II.
Nach der eingeschränkten Aufrechterhaltung des Klagepatentanspruchs durch das BPatG steht insbesondere das Merkmal 4.3 zwischen den Parteien in Streit. Da die Kammer bereits dessen Verwirklichung nicht festzustellen vermag, kommt es auf Ausführungen zu den weiteren Merkmalen nicht mehr an. - 1.
- In Merkmal 4.3 stellt das Klagepatent eine Abdeckung unter Schutz, die eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung fließt.
- Das Klagepatent verlangt für ein erfindungsgemäßes Sammeln von Flüssigkeit in der Abdeckung ein zumindest zeitweiliges Ansammeln oder Anstauen von Flüssigkeit in der hohlen Form. Bis zum Ableiten der Flüssigkeit vollständig von der Vorrichtung weg etwa in ein Spülbecken soll die Flüssigkeit zusammengeführt und -gehalten werden. Das Sammeln soll durch die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Abdeckung bedingt sein, die zumindest für ein Zeitmoment eine Anhäufung der Flüssigkeit bewirkt, wobei nicht erforderlich ist, dass die Abdeckung hierzu ringsherum geschlossen ist, solange sie die austretende Flüssigkeit konzentrieren kann, um sie sodann abzuleiten. Ein Hindurchfließen, lediglich kanalisiert durch zwei parallel zueinander ausgerichtete Seitenwände der hohlen Form, ohne eine zwischenzeitige Kumulation, genügt für ein erfindungsgemäßes Sammeln nicht.
- Da das Klagepatent den Begriff des Sammelns von Flüssigkeit nicht definiert, ist dessen Auslegung anhand des Anspruchs sowie insbesondere der Klagepatentschrift vorzunehmen.
- Zunächst spricht die allgemeine philologische Bedeutung des in der originalen französischen Anspruchsfassung genutzten Verbs „collecter“ sowie dessen wörtliche Übersetzung in die deutsche Sprache mit „sammeln“ für dieses Verständnis. Danach meint „sammeln“ etwas an einer bestimmten Stelle zusammenzutragen und zu einer größeren Menge zu vereinigen. Dinge werden angehäuft, mithin angesammelt. Bezogen auf einen bestimmten Raum vergrößert sich die Menge an Gegenständen, wird mithin konzentriert.
- Zwar ist der allgemeine Sprachgebrauch für die Auslegung des Klagepatentanspruchs grundsätzlich nicht zwingend. Der Fachmann hat nämlich stets vor Augen, dass es bei der Auslegung eines patentgemäßen Begriffs nicht auf das allgemeine Sprachverständnis auf dem jeweiligen technischen Gebiet ankommt, sondern jedes Patent gleichsam sein eigenes Lexikon für das Verständnis der in ihm verwendeten Begrifflichkeiten enthält. Verwendete Begriffe können folglich auch in einer vom allgemeinen technischen Sprachgebrauch verschiedenen Art und Weise aufzufassen sein (BGH, GRUR 2016, 361 – Fugenband; BGH, GRUR 2015, 875 – Rotorelemente; BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube). Für die Auslegung eines Patents ist damit nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe allein maßgeblich, sondern deren technischer Sinn, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist; maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2020, 53264 – Schutzbügel).
- Mit der Ausgestaltung der Abdeckung als hohle Form, welche Flüssigkeit sammeln kann, bezweckt das Klagepatent hier in technischer Hinsicht, einen geregelten Ablaufmechanismus für die aus der Entleerungsöffnung austretende Flüssigkeit bereitzustellen. Die Flüssigkeit soll nicht in der Form, wie sie aus dem Gehäuseinneren austritt, sondern in einer kontrollierten Weise abgeleitet werden, wozu sie zunächst zusammengeführt und zeitweise -gehalten wird, bevor sie schließlich in ein Spülbecken mündet. Dadurch ist es möglich, das Gerät ohne Verschmutzung des Gehäuses zu entleeren. Zugleich dient das Sammeln der Flüssigkeit dazu, die ebenfalls heraustretenden Kesselsteine sichtbar zu machen. Die Entleerungsflüssigkeit wird auf diese Weise zunächst in der Abdeckung konzentriert und angehäuft, was dem Nutzer einen Überblick über den Verkalkungszustand verschafft, bevor sie in ein Spülbecken abgegeben wird.
- Die Zusammenschau mit den Unteransprüchen 5 und 6 bekräftigt das dargelegte Verständnis. Denn Unteranspruch 5 schützt gegenüber dem nun als Merkmalsgruppe 4 in den Anspruch 1 aufgenommenen Unteranspruch 4 eine Abdeckung, die in der offenen Stellung ein freies Ende aufweist, das gegenüber dem Scharnier angeordnet ist, das nach unten geneigt ist. Dadurch wird das Ziel, die Flüssigkeit aus dem Gerät kontrolliert abzugeben, weiter gefördert, indem der Abfluss der Flüssigkeit aufgrund der Neigung der Abdeckung erleichtert wird. Der Unteranspruch 6 baut hierauf auf, indem er dem Hohlraum der Abdeckung eine durch eine Umfangswand begrenzte Bodenwand zuweist, und zudem eine Austrittsöffnung in der Umfangswand vorsieht. Durch diese weitere Konkretisierung, neben der zunächst hohlen Form der Abdeckung als solcher in Unteranspruch 4 und sodann deren Neigung in Unteranspruch 6, wird das Ableiten der Flüssigkeit zusätzlich durch eine Öffnung erleichtert. Somit ist auch aus der Gesamtschau der unselbständigen Unteransprüche nicht zu erkennen, dass schon parallel verlaufende seitliche Eingrenzungen der Abdeckung ein erfindungsgemäßes Sammeln bereitstellen könnten, das sowohl einen kontrollierten Abfluss als auch eine Kenntnisnahme der Kesselsteine ermöglicht.
- Mit diesen Ausführungen, wonach dem Sammeln in Merkmal 4.3 ein bestimmtes Verständnis beizumessen ist, welches eine Gleichsetzung mit einem (parallelen) Kanalisieren ausschließt, steht in Einklang, dass auch die Klagepatentbeschreibung klar zwischen verschiedenen Begrifflichkeiten im Umgang mit der Flüssigkeit unterscheidet, von denen sich mit dem „Sammeln“ jedoch nur eine im Patentanspruch wiederfindet (vgl. OLG Düsseldorf Urt. v. 26.11.2020 – 2 U 65/19, GRUR-RS 2020, 37856 Rn. 62, beck-online).
- In den Beschreibungsstellen Abs. [0013] und [0014] ist beschrieben:
- „[…] wobei sich die Abdeckung in der offenen Stellung unterhalb des Ausgangs der Entleerungsöffnung erstreckt und eine hohle Form aufweist, welche die Flüssigkeit sammelt, die durch die Entleerungsöffnung fließt.“
- „So lässt sich die Abdeckung in der offenen Stellung als Sammler für die aus der Entleerungsöffnung fließende Flüssigkeit nutzen, was verhindert, dass die Flüssigkeit unkontrolliert am Gehäuse entlang herunterrinnt, es verschmutzt und ins Gerät läuft.“
- Hierin kommt zum Ausdruck, dass die erfindungsgemäße Lehre der Abdeckung eine bestimmte Funktion bei der Ableitung des Wassers beimisst. Sie soll die Möglichkeit bieten, Flüssigkeit zu sammeln, also in gedrängter Form in sich aufzunehmen, bedingt durch ihre eigene räumlich-körperliche Ausgestaltung. So wird die Flüssigkeit daran gehindert, das Gehäuse der Vorrichtung zu verschmutzen. Diesen Beschreibungspassagen ist kein Hinweis zu entnehmen, wonach ein parallel ausgerichteter Kanal ein erfindungsgemäßes Sammeln bewirken könnte. Das Klagepatent zeigt vielmehr, dass es diesen Begriff kennt, aber nur in einem allgemeineren Kontext benutzt.
- So heißt in den Beschreibungsstellen [0017], [0023] und [0049], wobei es in der französischen Fassung „canaliser“ heißt und im hiesigen Rechtsstreit keine Partei, vor allem die Klägerin nicht, die deutsche Übersetzung mit „kontrolliertem Ableiten“ als falsch angesehen hat:
- „Durch ein derartiges Merkmal lässt sich die Abdeckung zur kontrollierten Ableitung der Flüssigkeit aus der Entleerungsöffnung in ein Spülbecken verwenden.“
- „So kann das Scharnier das aus der Entleerungsöffnung in die Abdeckung fließende Wasser kontrolliert ableiten.“
- „Besagte Flüssigkeit fließt damit schwerkraftbedingt in den Hohlraum 50 der Abdeckung 5 und anschließend durch die am freien Ende der Abdeckung 5 eingelassene Öffnung 54 ins Spülbecken, wobei besagte Öffnung als Ausgießer wirkt. Bei diesem Entleerungsvorgang hat die Abdeckung 5 den Vorteil, die aus der Entleerungsöffnung 42 ausgetretene Flüssigkeit kontrolliert abzuleiten, was verhindert, dass die Flüssigkeit unkontrolliert am Gehäuse 20 entlang herunterrinnt und ins Innere des Letzteren hineinzulaufen droht.“
-
Diese Beschreibungsstellen zeigen, dass das Klagepatent zur Beschreibung der Abdeckung und deren technischer Funktion neben dem Begriff des Sammelns auch eine weitere Begrifflichkeit kennt und benutzt. Das in die Abdeckung fließende Wasser soll letztlich durch die Bereitstellung einer entsprechend dazu ausgelegten Abdeckung kontrolliert abgeleitet werden. Dazu sieht die erfindungsgemäße Lehre zunächst vor, das austretende Wasser in der Abdeckung anzusammeln, bevor es über die Austrittsöffnung, die bevorzugterweise vorgesehen werden kann, in ein Spülbecken abgegeben wird. Der Abdeckung kommt zunächst die Aufgabe des Zusammenführens und Anhäufens der Flüssigkeit zu und nachgelagert („anschließend“) deren Ableitung.
In diesem Zusammenhang und nach dem allgemeinen Sprachverständnis von „kanalisieren“ bzw. „kontrolliert ableiten“ könnte hierfür lediglich eine Abdeckung mit einer hohlen Form und seitlichen Begrenzungen ausreichen, weil schon dadurch die austretende Flüssigkeit in bestimmte Bahnen und eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Es sind der Klagepatentschrift jedoch keine Hinweise zu entnehmen, wonach canaliser/kontrolliertes Ableiten und sammeln in ihrer Bedeutung deckungsgleich zu verstehen sein könnten. Ausgeschlossen ist nicht, dass das kontrollierte Ableiten dem Sammeln übergeordnet ist und ein Sammeln auch ein Kanalisieren sein kann. Andersherum gilt dies jedoch nicht. Durch diejenigen Beschreibungsstellen und vor allem durch die im Klagepatentanspruch gewählte Begrifflichkeit macht das Klagepatent deutlich, dass ein Sammeln ein „Mehr“ jedenfalls gegenüber einem bloßen Kanalisieren durch bloß parallel ausgerichtete Seitenwände verlangt. Dies erschließt sich auch vor dem Hintergrund, dass die Abdeckung dem Nutzer Erkenntnisse über den Verkalkungszustand des Geräts geben soll, indem die austretenden Kesselsteine sichtbar gemacht werden, wozu es erforderlich ist, austretende Flüssigkeit zumindest zwischenzeitlich in der Abdeckung zu konzentrieren, weil sich der Nutzer nur so einen Überblick über den Zustand des Geräts verschaffen kann. Abs. [0050] besagt insoweit: - „Darüber hinaus hat die Abdeckung 5 auch den Vorteil, die aus der Entleerungsöffnung 42 austretenden Kesselsteinpartikel besser sichtbar zu machen, sodass der Anwender den Verkalkungszustand des Behälters 4 besser einschätzen und die Entleerungsvorgänge dementsprechend zeitlich beabstanden kann.“
- Es bedarf eines derartigen Anstiegs des Flüssigkeitsspiegels innerhalb einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, der von einem bloß kontrollierten, in irgendwelchen Bahnen gelenkten, Abfließen unterschieden werden kann. Allein seitliche Begrenzungen sind jedenfalls dann nicht ausreichend, wenn sie nur ein Hindurchfließen bereitstellen und nicht auch so auf die Flüssigkeit einwirken, dass sie erkennbar zusammengeführt wird.
- Bestärkt wird dieses Verständnis eines Sammelns unter Ausschluss bloß paralleler Seitenwände der Abdeckung auch durch die Betrachtung von Abs. [0017], welcher sich auf den Abs. [0016] rückbezieht:
- „Durch ein derartiges Merkmal lässt sich die Abdeckung zur kontrollierten Ableitung der Flüssigkeit aus der Entleerungsöffnung in ein Spülbecken verwenden. Darüber hinaus ist durch eine solche Abdeckung die Menge an Kesselstein, die aus der Entleerungsöffnung fließt, besser ersichtlich, wobei der Großteil des Kesselsteins im Hohlraum hängenbleibt, bevor er durch die Austrittsöffnung abfließt.“
- In Abs. [0016] waren zuvor eine Bodenwand, Umfangswand sowie Austrittsöffnung in der Abdeckung beschrieben. Nicht zwingend unter Bezug auf eine Austrittsöffnung erachtet das Klagepatent bei einer solchen Abdeckung jedenfalls den Hohlraum für (mit)entscheidend, dass die Kesselsteine sichtbar werden. Diese sollen im Hohlraum hängen bleiben. Dies gibt dem Fachmann für die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Abdeckung den Anhalt, einen ungehinderten Abfluss der Flüssigkeit, wie er bei parallelen Seitenwänden gegeben ist, auszuschließen. Dass dem ungehinderten Abfließen die Konstruktion der Abdeckung entgegenwirken soll, ergibt sich auch bei einer Betrachtung des Abs. [0041]:
- „Die Umfangswand 52 umfasst am gegenüber dem Scharnier 6 angeordneten freien Ende der Abdeckung 5 eine Durchtrittsöffnung 54, durch die sämtliche im Hohlraum 50 vorhandene Flüssigkeit ablaufen kann, wenn die Abdeckung 5 die offene Stellung einnimmt, […]“
- Hier beschreibt das Klagepatent die Abgabe von Flüssigkeit aus der Abdeckung über eine – bevorzugte – Durchtrittsöffnung und spricht zugleich von „vorhandener“ Flüssigkeit. Flüssigkeit ist aber nur dann in der Abdeckung vorhanden, wenn sie sich zumindest während einer gewissen Zeit darin befindet, mithin vorgehalten wird, und nicht nur durchfließt. Auch bei einer bloß seitlichen Einfassung wird aber nur die räumliche Ausdehnung der Flüssigkeit aus der Entleerungsöffnung überhaupt verhindert, allerdings noch nicht, dass die Flüssigkeit auch über die Abdeckung kontrolliert geleitet wird; es verbleibt vielmehr bei einem Hindurchfließen innerhalb dieser Seitenbegrenzung.
- Überdies unterstützt die Abgrenzung vom Stand der Technik dieses Verständnis vom Sammeln. Denn das Merkmal 4.3 ist zur Abgrenzung der erfindungsgemäßen Lehre von der Benutzungsform nach der N3 in den Anspruch aufgenommen worden. Die N3 sieht eine Abdeckung für den Stopfen vor, die nach unten zu öffnen ist und über die austretende Flüssigkeit in ein Spülbecken abgegeben werden kann. Zur Veranschaulichung wird nachfolgend das entsprechende Bild aus dem BPatGU eingeblendet (Anlage B12, S. 41):
- Die Abdeckung weist eine runde, leicht hohle Form auf, die vom BPatG auch als Hohlraum beschrieben wird. Auf dem Lichtbild ist nach unten ablaufende Flüssigkeit zu erkennen. Das BPatG beschreibt den Verlauf der Flüssigkeit als „Hindurchfließen“ durch die Abdeckung (vgl. Anlage B12, S. 40). Die Beschreibung des BPatG meint, dass eine zumindest zeitweilige Kumulation von Flüssigkeit in der Abdeckung nicht gegeben ist. Ein seitliches Ablaufen, das eine seitliche Einfassung erforderlich machen könnte, ist dem Foto dagegen nicht zu entnehmen. Nach dem Verständnis des BPatG, dessen Ausführungen insoweit im Hinblick auf Merkmal 4.3 an die Stelle der Klagepatentbeschreibung treten bzw. hinzutreten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. A, Rn. 126; 137), würde auch eine bloße seitliche Begrenzung der Abdeckung der N3, zur Bildung eines Kanals, ein „Hindurchfließen“ der Flüssigkeit durch die Abdeckung nicht ausschließen.
- Die Ausführungen des BPatG zur N10 (vgl. Anlage B12, S. 50 f.) stehen der Würdigung der N3 jedenfalls auch nicht entgegen. Das BPatG hat das Merkmal 4.3. von der N10 als neuheitsschädlich getroffen angesehen. Eine Vorrichtung nach der N10 kann wie folgt dargestellt werden:
- Die hier offenbarte Abdeckung 101 weist eine Rippe 102 auf, welche auf die austretende Flüssigkeit einwirkt und diese in ihrer Richtung lenkt (vgl. Abs. [0043] der N10; Anlage B4-Anlage A10). Daher fließt auch in dieser Offenbarung das Wasser aus der Vorrichtung nicht bloß durch eine Abdeckung mit parallel verlaufenden Seitenflächen hindurch.
-
2.
Ausgehend von diesem Verständnis machen die angegriffenen Ausführungsformen keinen Gebrauch von Merkmal 4.3. - Ihrer unstreitigen räumlich-körperlichen Ausgestaltung nach ist ein Sammeln von aus der Entleerungsöffnung austretender Flüssigkeit dort nicht möglich. Der Entleerungsvorgang wird nochmals bildlich wie folgt veranschaulicht:
- Die austretende Flüssigkeit wird demnach unmittelbar durch die durchsichtige Abdeckklappe hindurchgeleitet. Aufgrund eines fehlenden Endabschnitts kommt es nicht zu einer Anhäufung. Dieser Vorgang wird ebenso in der Bedienungsanleitung verdeutlicht, indem dort die Abbildungen zur Entleerung der Flüssigkeit ein direktes Ableiten der Flüssigkeit beispielsweise in ein Spülbecken zeigen. Die parallel zueinander verlaufenden Seitenwände der Abdeckung führen nicht dazu, dass die Flüssigkeit zusammengeführt und bis zur ihrer Abgabe in das Spülbecken zusammengehalten wird. Vielmehr wird sie in der Form, wie sie aus der Entleerungsöffnung tritt, abgeleitet. Dass wenigstens vorübergehend Flüssigkeit zunächst in der Abdeckung gesammelt würde, ist nicht zu erkennen und so auch von der Klägerin nicht behauptet worden.
-
III.
Mangels Verletzung des Klagepatents stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nicht zu. -
B.
Die zulässige Widerklage ist unbegründet. Die Beklagte hat gegen die Klägerin keinen Anspruch auf Zahlung der ihr vorgerichtlich entstandenen Rechtsanwaltsgebühren aus dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gem. § 823 Abs. 1 BGB. - Ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist im Falle einer Schutzrechtsverwarnung dann anzunehmen, wenn der vermeintlich Berechtigte auf Grundlage eines objektiv unberechtigten gewerblichen Schutzrechtes an den Inhaber des Gewerbebetriebs ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren richtet (BGH, NJW-RR 1997, 1404; OLG Düsseldorf, BeckRS 2011, 2161; BeckOK BGB/Förster, 68. Ed. 1.11.2023, BGB § 823 Rn. 203; BeckOGK/Spindler, 1.12.2023, BGB § 823 Rn. 223).
- Diese Anforderungen sind hinsichtlich des Schreibens der Klägerin vom 12. Januar 2022 (Anlage K6) an die Beklagte erfüllt. Darin hat sich die Klägerin auf das ihr zustehende Klagepatent berufen und die ihrer Ansicht nach gegebenen Verletzungshandlungen der Beklagten dargelegt. Verknüpft hat sie dies mit der Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung binnen drei Wochen. Damit hat die Klägerin unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, die Einstellung der Benutzungshandlungen durch die Beklagte erreichen zu wollen. Diese Aufforderung war aber unberechtigt, weil, wie vorstehend unter lit. A ausgeführt, zugunsten der Klägerin tatsächlich kein Unterlassungsanspruch in der geltend gemachten Form bestand.
-
Die mit Schreiben vom 12. Januar 2022 erfolgte Abmahnung ist auch rechtswidrig.
Zwar ist die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht durch das Vorliegen des Eingriffs als solchem indiziert, sondern muss stets im Rahmen einer Interessen- und Güterabwägung festgestellt werden (BeckOGK/Spindler, 1.12.2023, BGB § 823 Rn. 214; MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, BGB § 823 Rn. 370). Indes ist kein legitimes Interesse eines Schutzrechtsinhabers ersichtlich, einem Wettbewerber bei nicht bestehendem Schutzrecht ernsthaft und endgültig zur – nicht geschuldeten – Unterlassung aufzufordern. Damit fällt die Interessenabwägung vorliegend zugunsten der Beklagten als zu Unrecht abgemahnter Wettbewerberin aus. Es sind keine rechtfertigenden Gründe ersichtlich, weshalb sie dieses Verhalten der Klägerin tolerieren müsste. -
Die Klägerin hat bei Abfassung ihrer Abmahnung allerdings nicht schuldhaft gehandelt.
Verschulden im Rahmen der deliktischen Haftung setzt Vorsatz oder Fahrlässigkeit voraus, § 823 Abs. 1 BGB. Bezugspunkt des Vorsatzes sind diejenigen Aspekte, welche die Eigenschaft der Abmahnung als rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb begründen. - Vorliegend muss sich der Vorsatz demnach auch auf das spätere rückwirkende Wegfallen desjenigen Schutzrechtes, auf das die Abmahnung gestützt ist, erstrecken. Ein Vorsatz der Klägerin insoweit ist nicht ersichtlich und wird von der Beklagten nicht behauptet.
-
Die Klägerin hat hinsichtlich des nur eingeschränkten Rechtsbestandes des geltend gemachten Schutzrechtes auch nicht fahrlässig gehandelt.
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 2 BGB. Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt ein (vermeintlicher) Gläubiger nicht schon dann, wenn er nicht erkennt, dass seine Forderung in der Sache nicht berechtigt ist (BGHZ 179, 238, 246). Dies würde dem Gläubiger die Durchsetzung seiner Rechte unzumutbar erschweren, da seine Berechtigung nur in einem Rechtsstreit sicher zu klären ist (BGHZ 179, 238, 246; BGH, GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh). Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entspricht der Gläubiger vielmehr regelmäßig schon dann, wenn er sorgfältig prüft, ob der eigene Rechtsstandpunkt plausibel ist (BGH, GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh; vgl. BGHZ 179, 238, 246; BGH, NJW 2011, 1063, 1065; NJW 2008, 1147, 1148). Dies gilt nicht nur hinsichtlich tatsächlicher Voraussetzungen des geltend gemachten Rechts, sondern auch bei einer unklaren Rechtslage (BGH GRUR, 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh; NJW 2011, 1063, 1065; Staudinger/Caspers (2019) BGB § 276, Rn. 58). Ein Schutzrechtsinhaber setzt sich deshalb im Falle einer unberechtigten Verwarnung nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns aus, wenn er sich seine Überzeugung durch gewissenhafte Prüfung gebildet oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von vernünftigen und billigen Überlegungen hat leiten lassen (BGH, GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh). Art und Umfang der Sorgfaltspflichten desjenigen, der eine Abmahnung ausspricht, werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand seines Schutzrechtes vertrauen darf. Bei einem geprüften Schutzrecht kann vom Rechtsinhaber keine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt werden, als sie der Erteilungsbehörde möglich war (BGH, GRUR 2018, 832, 841 – Ballerinaschuh; GRUR 2006, 432, 433 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II). - Vorliegend hat die Klägerin bei Abgabe der Abmahnung nicht schuldhaft gehandelt. Es sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass sie zu dieser Zeit über besseres Wissen bezüglich des Rechtsbestandes des Klagepatents hätte verfügen müssen, dass sie mit der Einschränkung in der nun vorliegenden Form konkret hätte rechnen müssen. Die Beklagte meint dies unter Verweis auf die von Produkten anderer großer Hersteller, welche die Lehre des Klagepatents neuheitsschädlich vorwegnehmen würden. Dies hätte der Klägerin auffallen müssen. Diese Argumentation der Beklagten verfängt allerdings nicht. Denn zunächst ist schon nicht festzustellen, dass die Klägerin tatsächlich Kenntnis von den neuheitsschädlichen Produkten hatte oder hätte haben müssen, weil sie konkrete Berührungspunkte mit diesen Unternehmen sowie Produkten hatte. Die Beklagte hat hierzu keine näheren Ausführungen gemacht, sodass nicht anzunehmen ist, dass sich die Klägerin bewusst der Kenntnisnahme dieser Produkte verschlossen und wider besseren Wissens die Abmahnung ausgesprochen hat. Im Übrigen ist fraglich, ob bereits eine in Kenntnis der Produkte ausgesprochene Abmahnung schuldhaft wäre. Denn dies würde ferner voraussetzen, dass sich die Neuheitsschädlichkeit derart eindeutig aufgedrängt haben muss, dass die Klägerin sich auf den formalen Erteilungsakt des Klagepatents nicht mehr verlassen durfte. Hierfür sind jedoch ebenso wenig Anhaltspunkte gegeben. Vielmehr zeigen gerade die innerhalb des vorliegenden Rechtsstreits gestellten Klageanträge in unterschiedlichen Anspruchsfassungen, dass die Klägerin mitunter sogar erst kurzfristig auf (Rechtsbestands-) Einwände der Beklagten – und zudem nur vorsorglich – reagiert hat, da gerade die konkrete Diskussion um bestimmte Merkmale nicht von vornherein absehbar und eindeutig, sondern abhängig von der jeweiligen Auslegung war. Insofern aber ist der Klägerin kein Vorwurf zu machen, eine gegenüber der Klägerin andere rechtlich vertretbare Ansicht zum Anspruchsverständnis zu vertreten.
- Mangels bestehenden Schadensersatzanspruchs steht der Beklagten auch der zugehörige Zinsanspruch nicht zu.
-
C.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 ZPO. Da durch die hinzuzuaddierende Widerklage zwar Gebührensprung ausgelöst wird, aber aufgrund der Kostendegression nur marginale Mehrkosten entstanden sind, waren der Klägerin insgesamt die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. - Streitwert: 1.016.102,36 Euro (§ 45 Abs. 1 S. 1 GKG)